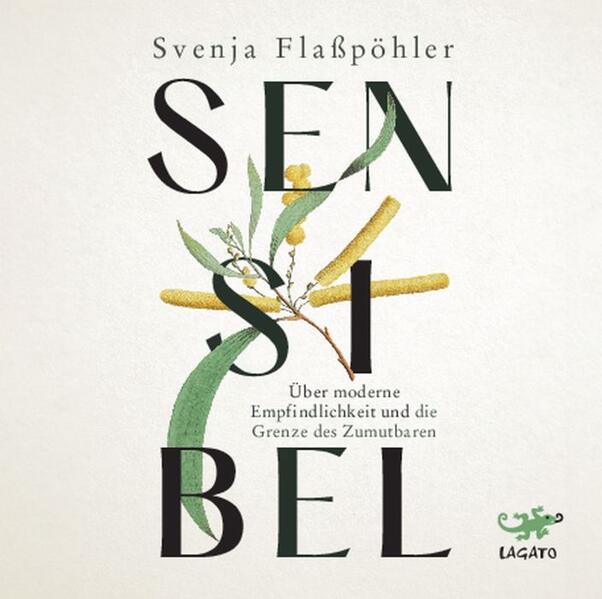
Zustellung: Di, 03.12. - Do, 05.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mehr denn je sind wir damit beschäftigt, das Limit des Zumutbaren neu zu justieren. Wo liegt die Grenze des Sagbaren? Ab wann ist eine Berührung eine Belästigung? Svenja Flaßpöhler tritt einen Schritt zurück und beleuchtet den Glutkern des Konflikts: die zunehmende Sensibilisierung des Selbst und der Gesellschaft. »Sensibel« ist ein hochaktuelles, philosophisches und gleichzeitig unterhaltsames Hörbuch, das die Sensibilität dialektisch durchleuchtet und zu dem Schluss kommt: Die Resilienz ist die Schwester der Sensibilität. Die Zukunft meistern können sie nur gemeinsam.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Oktober 2021
Sprache
deutsch
Ausgabe
Ungekürzt
Laufzeit
357 Minuten
Autor/Autorin
Svenja Flaßpöhler
Sprecher/Sprecherin
Sonngard Dressler
Verlag/Hersteller
Produktart
CD
Gewicht
59 g
Größe (L/B/H)
5/144/155 mm
GTIN
9783955679361
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 16.10.2021
Besprechung vom 16.10.2021
Wie viel Widerstreit gilt es auszuhalten?
Sind so empfindlich die Leute: Svenja Flaßpöhler denkt über Vorteile und Gefahren einer Sensibilisierung der Gesellschaft nach.
Von Kai Spanke
Die Philosophin Svenja Flaßpöhler beschäftigt sich in ihren Büchern gerne mit Reizthemen. Über Pornographie hat sie genauso geschrieben wie über selbstbestimmtes Sterben. Aus diesem Grund schätzt man sie als Gast in Diskussionsrunden, wo sie meinungsstark und streitbar auftritt. Als sie vor zwei Jahren von Peter Unfried und Harald Welzer für die taz zur sich steigernden sozialen Empfindlichkeit befragt wurde, gab sie zu bedenken, unsere Gesellschaft sei kaum noch in der Lage, Ambivalenz auszuhalten. Dass jemand etwa ein begabter Musiker, zugleich aber auch ein Kinderschänder sein könne, sei nicht mehr vermittelbar. Deswegen habe Michael Jackson keinen Anspruch auf einen Platz im kulturellen Gedächtnis. "Da zeigt sich eine neue Form von Sensibilität", resümierte die Chefredakteurin vom Philosophie Magazin, und das könne schnell "vom Progressiven ins Regressive kippen und zu moralischem Totalitarismus führen".
Solche Warnungen finden sich auch in dem Buch, das Flaßpöhler nun über die Entstehung moderner "Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren" geschrieben hat. Gleichwohl verzichtet sie diesmal auf die kratzige, von Thea Dorn entlehnte Diktion. Dafür bringt sie ein ganzes Bataillon von Gewährsleuten in Stellung, um die Vor- und Nachteile gesteigerter Sensibilität auf der einen und unverwüstlicher Resilienz auf der anderen Seite herauszuarbeiten: Norbert Elias und Ernst Jünger, Klaus Theweleit und Friedrich Nietzsche, Georg Simmel und Paul Valéry, Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa, Thomas Nagel und Michel Foucault. Die Autorin bricht triftige Thesen dieser Stichwortgeber auf wenig Raum herunter und sinniert über Gewalt, Grenzen der Empathie und Traumata - freilich auf Kosten systematischer Klarheit und zugunsten assoziativ-flotter Betrachtungen.
So geht es vom Zeitalter der Empfindsamkeit, deren Literatur den Lesern einen bislang unbekannten Blick auf das Verhältnis von Frauen und Männern erlaubte, mit Siebenmeilenstiefeln in die Wiener Moderne. Gerade noch in Gedanken bei Samuel Richardson und Jean-Jacques Rousseau, liegt man ein paar Absätze später auf der Couch von Sigmund Freud. Das Postulat, das diesen Spagat rechtfertigen soll: Sowohl in den Briefromanen des achtzehnten Jahrhunderts als auch in der therapeutischen Praxis vollziehe sich eine Aufwertung des Erzählens - und der einfühlsamen Betrachtung des Erzählten.
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts fangen Sprachwissenschaftler der Autorin zufolge damit an, sich immer stärker für Zeichen zu interessieren. Das habe der Linguist Ferdinand de Saussure zu verantworten, dessen Idee einer Sprache, die als eigenes System Bedeutungen aus sich selbst hervorbringt, am Ende von Dekonstruktivisten infrage gestellt wurde. Jacques Derrida etwa argumentierte: Sollte nichts als die stets gleiche Wiederholung den Anschein einer sprachlichen Struktur nahelegen, ließe sich die Bedeutung mit einem anderen Gebrauch von Zeichen womöglich verändern.
Auftritt Judith Butler. Die Philosophin habe Derridas Ausführungen einfach auf die Geschlechterfrage übertragen: "Der sprachliche Akt immergleicher Bezeichnung erweckt lediglich den Anschein, als gebe es von Natur aus zwei fixe Geschlechtsidentitäten mit heterosexuellem Begehren." Tatsächlich seien solche Identitäten aber nur der Effekt eines bestimmten Sprachgebrauchs. Und wie ist das nun mit Triggerwarnungen und dem Gendern? Flaßpöhler sucht den Kompromiss. Ja, Sprache könne verletzen, man müsse sie vorsichtig verwenden und Rücksicht nehmen. Doch gerade weil sie in ihrer Bedeutungsdimension nicht fixiert sei, spreche "aus dekonstruktiver Sicht viel, wenn nicht gar alles gegen starre, kontextunabhängige Vorgaben".
Homosexuelle seien beispielsweise lange mit dem Wort "queer" diskriminiert worden. Heute führten sie den Begriff als Ausdruck des Selbstbewusstseins im Munde. Butler schreibt: "Das Wort, das verwundet, wird in der neuen Anwendung, die sein früheres Wirkungsgebiet zerstört, zum Instrument des Widerstands." Worauf Flaßpöhler hinauswill: Wer auf Differenzen beharrt und sie sprachlich zementiert, schreibt Identitäten fest. Das könne nicht Sinn einer Sensibilisierung sein. Konstruktiv erscheint der Autorin gegenseitiges Verständnis: für die, die sagen, der Einzelne müsse an sich arbeiten und widerstandsfähiger werden, und für jene, die fordern, die soziale Umgebung habe sich zu ändern. An einem lässt Flaßpöhler keinen Zweifel: Die Sensibilisierung der Gesellschaft markiert einen zivilisatorischen Fortschritt.
Svenja Flaßpöhler: "Sensibel". Über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2021. 240 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sensibel, Audio-CD, MP3" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.










