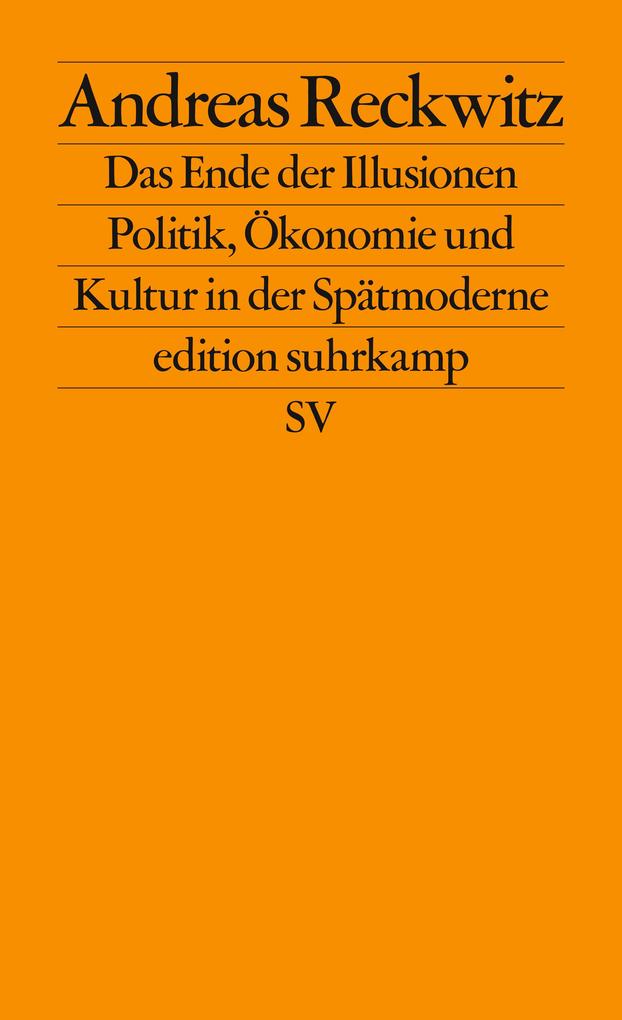
Zustellung: Mo, 02.12. - Mi, 04.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Noch vor wenigen Jahren richtete sich die westliche Öffentlichkeit in der scheinbaren Gewissheit des gesellschaftlichen Fortschritts ein: Der weltweite Siegeszug von Demokratie und Marktwirtschaft schien unaufhaltsam, Liberalisierung und Emanzipation, Wissensgesellschaft und Pluralisierung der Lebensstile schienen die Leitbegriffe der Zukunft. Spätestens mit dem Brexit und der Wahl Donald Trumps folgte die schmerzhafte Einsicht, dass es sich dabei um Illusionen gehandelt hatte.
Tatsächlich wird erst jetzt das Ausmaß des Strukturwandels der Gesellschaft sichtbar: Die alte industrielle Moderne ist von einer Spätmoderne abgelöst worden, die von neuen Polarisierungen und Paradoxien geprägt ist - Fortschritt und Unbehagen liegen dicht beieinander. In einer Reihe von Essays arbeitet Andreas Reckwitz die zentralen Strukturmerkmale der Gegenwart pointiert heraus: die neue Klassengesellschaft, die Eigenschaften einer postindustriellen Ökonomie, den Konflikt um Kultur und Identität, die aus dem Imperativ der Selbstverwirklichung resultierende Erschöpfung und die Krise der Liberalismus.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Oktober 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
305
Reihe
edition suhrkamp
Autor/Autorin
Andreas Reckwitz
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
196 g
Größe (L/B/H)
171/111/20 mm
ISBN
9783518127353
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Nach der wegweisenden Studie Gesellschaft der Singularitäten beschäftigt sich Andreas Reckwitz in seiner Essaysammlung mit dem Strukturwandel der Gesellschaft. Der Soziologe seziert die neue Klassengesellschaft, die postindustrielle Ökonomie, die Konflikte um Kultur und Identität und den Imperativ der Selbstverwirklichung, woraus Erschöpfung und Demokratiemüdigkeit entspringen. « DIE ZEIT
»Das Buch analysiert nicht nur die Erschöpfung der liberalen Fortschrittserzählung, sondern stellt auch Kategorien bereit, um das politische Geschehen neu zu bestimmen. « Isolde Charim, taz. die tageszeitung
»Wer wissen will, warum es die alten Sicherheiten, die die BRD zu garantieren schien, so aus der Kurve getragen hat, muss Reckwitz lesen. Eine elegant-intelligente Tour de Force durch Politik, Ökonomie und Kultur. « Jan Küveler, DIE WELT
»Der Soziologe Andreas Reckwitz entschlüsselt die Entwicklungsdynamiken gegenwärtiger Gesellschaften zwischen Öffnung und Regulierung. Und siehe da: Ein neuer Liberalismus hätte gute Chancen. « Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung
»Nun lässt [Reckwitz] mit dem Ende der Illusionen eine ebenso erhellende Sammlung von fünf Essays folgen, die an [ Die Gesellschaft der Singularitäten ] anschließen und seine Einblicke in den aktuellen Zustand von Politk, Wirtschaft und Gesellschaft vertiefen. Manch ein Phänomen, vor dem wir bislang rätselnd standen, wird dadurch entschlüsselt. « Gunther Hartwig, Südwest Presse
»Ein erhellendes, dringendes Buch. « Svenja Flaßpöhler, Philosphie Magazin
»Das im wissenschaftlichen Stil verfasste Buch bietet auf soziologischer Basis einen realistischen Befund gegenwärtiger westlicher Gesellschaften. . . . Unbedingt für wissenschaftliche Bibliotheken zu empfehlen. « Werner Lenz, Die Österreichische Volkshochschule
»Provokante und gerade darin oft simplifizierende Thesen sind [Andreas Reckwitz ] Sache nicht, dystopische Dramatisierungsrhetorik liegt ihm so fern wie trotziger Fortschrittsoptimismus. Wer so auf die Wirklichkeit schaut, sieht mehr und begreift besser, was er sieht. « Ulrich Bröckling, Soziopolis
»Nach der Lektüre seines Buches darf man sich gespannt auf den nächsten großen Wurf von Andreas Reckwitz freuen. « Aschot Manutscharjan, Das Parlament
»Das Buch analysiert nicht nur die Erschöpfung der liberalen Fortschrittserzählung, sondern stellt auch Kategorien bereit, um das politische Geschehen neu zu bestimmen. « Isolde Charim, taz. die tageszeitung
»Wer wissen will, warum es die alten Sicherheiten, die die BRD zu garantieren schien, so aus der Kurve getragen hat, muss Reckwitz lesen. Eine elegant-intelligente Tour de Force durch Politik, Ökonomie und Kultur. « Jan Küveler, DIE WELT
»Der Soziologe Andreas Reckwitz entschlüsselt die Entwicklungsdynamiken gegenwärtiger Gesellschaften zwischen Öffnung und Regulierung. Und siehe da: Ein neuer Liberalismus hätte gute Chancen. « Jens Bisky, Süddeutsche Zeitung
»Nun lässt [Reckwitz] mit dem Ende der Illusionen eine ebenso erhellende Sammlung von fünf Essays folgen, die an [ Die Gesellschaft der Singularitäten ] anschließen und seine Einblicke in den aktuellen Zustand von Politk, Wirtschaft und Gesellschaft vertiefen. Manch ein Phänomen, vor dem wir bislang rätselnd standen, wird dadurch entschlüsselt. « Gunther Hartwig, Südwest Presse
»Ein erhellendes, dringendes Buch. « Svenja Flaßpöhler, Philosphie Magazin
»Das im wissenschaftlichen Stil verfasste Buch bietet auf soziologischer Basis einen realistischen Befund gegenwärtiger westlicher Gesellschaften. . . . Unbedingt für wissenschaftliche Bibliotheken zu empfehlen. « Werner Lenz, Die Österreichische Volkshochschule
»Provokante und gerade darin oft simplifizierende Thesen sind [Andreas Reckwitz ] Sache nicht, dystopische Dramatisierungsrhetorik liegt ihm so fern wie trotziger Fortschrittsoptimismus. Wer so auf die Wirklichkeit schaut, sieht mehr und begreift besser, was er sieht. « Ulrich Bröckling, Soziopolis
»Nach der Lektüre seines Buches darf man sich gespannt auf den nächsten großen Wurf von Andreas Reckwitz freuen. « Aschot Manutscharjan, Das Parlament
 Besprechung vom 18.02.2020
Besprechung vom 18.02.2020
Selbstverwirklichung ist anstrengend
Geteilte kulturelle Grundwerte müssen sein: Der Soziologe Andreas Reckwitz hat einige Wünsche an das linksliberale Milieu.
Einem größeren Publikum ist der Soziologe Andreas Reckwitz vor zwei Jahren mit seiner Diagnose einer "Gesellschaft der Singularitäten" bekanntgeworden. In ihr verbreite sich "großflächig eine soziale Logik der Singularisierung", die darauf hinauslaufe, dass qualitative Differenzen, Individualität, Unverwechselbarkeit, der Wunsch nach Selbstentfaltung und die Erwartung eines außergewöhnlichen Lebens das Signum der Zeit ausmachten. Reckwitz nennt das eine "Kulturalisierung der Lebensformen".
Mit dieser Diagnose beginnt auch das nun vorgelegte Buch. Das Hauptmotiv freilich besteht in der titelgebenden Figur eines "Endes der Illusionen". Gemeint ist die Illusion eines Liberalismus, der offensichtlich an die Grenzen seines eigenen Fortschrittsoptimismus gerate. Reckwitz dekliniert dies in fünf Aufsätzen durch. Zunächst unterscheidet er zwei Formen der Kulturalisierung, eine öffnende und eine eher essentialisierende. Daran schließt sich eine Klassenanalyse an, die eine neue Mittelklasse von einer alten Mittelklasse und einer prekären Klasse unterscheidet. Der dritte Aufsatz widmet sich einer Analyse des kognitiv-kulturellen Kapitalismus, hauptsächlich bestehend aus dem Nachweis, dass Produkte und Dienstleistungen neben dem Materiellen nicht nur kognitive Wertschöpfungsanteile haben, sondern zunehmend kulturelle dazukommen. Danach werden in zwei Kapiteln Lösungsperspektiven formuliert. Mit Ausnahme des ersten Kapitels sind die Aufsätze eigens für diesen Band verfasst worden.
Stärker als in dem Vorgängerbuch geht Reckwitz hier auch auf die Kosten einer singularistischen Lebensform ein: Sättigungserfahrungen, Steigerungslogiken und Konkurrenz der Singularitäten, Zwang zur Selbstoptimierung und nicht zuletzt das Zu-Markte-Tragen der eigenen Unverwechselbarkeit. Der Erfolg und die Anschlussfähigkeit dieser Diagnose hängen ganz offensichtlich damit zusammen, dass Reckwitz hier einen Nerv getroffen hat. Dem Rezensenten sind dabei Texte von Ulrich Beck aus den neunziger Jahren in den Sinn gekommen. Dessen süffige Diagnosen haben letztlich dem damaligen urban-rot-grünen Milieu die entscheidenden Chiffren der Selbstbeschreibung geliefert - nicht nur als Apologie des Eigenen inszeniert, sondern mit einer guten Portion Selbstkritik versehen. So ähnlich funktioniert auch der Ansatz von Reckwitz, der einen von kreativwirtschaftlichen, linksliberalen und -libertären Elementen geprägten Lebensstil ins Visier nimmt, ein Milieu mit ziemlicher semantischer Durchsetzungskraft. Am Erfolg der Diagnose kann man sehen, wie anerkennungsbedürftig auch dieses Milieu ist.
Und wie damals wird heute in der fachwissenschaftlichen Kritik öfter darauf hingewiesen, dass Reckwitz' Diagnose womöglich nur für dieses Milieu taugt. Reckwitz geht auf solche Kritiken nicht explizit ein, aber als eine implizite Reaktion darauf kann man das neue Buch doch lesen. Denn den Fokus richtet er nun auf die Grenzen der diagnostizierten Lebensform: auf intrinsische Grenzen, die sich deren Steigerungslogik und Sättigungsgrad verdanken, und auf äußere Grenzen, die vor allem mit der Tendenz zur Schließung eines an rechtem und linkem Populismus und entsprechenden identitären Angeboten orientierten Milieus zu tun haben. Reckwitz sieht sowohl in einer übertriebenen Kultur der Öffnung als auch in der übertriebenen Kultur der Schließung Reaktionen auf das Ende der industriegesellschaftlichen Sicherheiten, Institutionenarrangements und Anerkennungsbedingungen unterschiedlicher Klassen. Letztlich relativiert er damit seine Diagnose einer Gesellschaft der Singularitäten, indem er explizit auf deren milieuspezifische Basis verweist.
Bestechend sind Reckwitz' Beschreibungen des kognitiv-kulturellen Kapitalismus und seiner Folgen, vor allem der Hinweis darauf, dass es nicht nur um kognitive Güter geht, sondern explizit um deren Kulturalisierung. Hier gelingen ihm überzeugende Einsichten und Diagnosen. Aber wo er Lösungsvorschläge macht, wird die Begrenztheit seines soziologischen Modells sichtbar.
In dem Kapitel über "erschöpfte Selbstverwirklichung" ist Reckwitz ganz in der Binnenlogik jenes Milieus, in dem wohl die stärksten Resonanzen auf seine Diagnosen erwartbar sind. Nachvollziehbar werden die Belastungen des spätmodernen Selbst und seine Enttäuschungen beschrieben. Als Remedium freilich wird aus der soziologischen Diagnose schlichte Ratgeberliteratur: Man solle doch versuchen, die Widersprüche auszuhalten, eine stärkere Distanz zu den eigenen Emotionen einnehmen und solidarische Dauerbeziehungen aufbauen. Hört sich gut an, behauptet aber, dass die Erschöpfung des Selbst durch guten Willen aufgehoben werden kann. War das nicht die Logik, die zu jener Überlastung geführt haben soll?
Das letzte Kapitel, in dem politische Lösungen andiskutiert werden, bleibt ähnlich unentschieden. Reckwitz argumentiert, dass der "apertistische", also öffnende Liberalismus der urbanen linksliberalen Singularier sich zugunsten eines "einbettenden Liberalismus" zurücknehmen solle. Ganz ähnlich wie das erschöpfte Selbst müsste solcher Liberalismus Distanz zu den eigenen Fortschrittsideen einüben und kulturelle Regelwerke schaffen, um so etwas wie kollektive Identitäten zu ermöglichen.
Das ist logisch gedacht: Wenn der linksliberale Universalismus der "singulären" Milieus eine Überforderung für die anderen Klassen ist, muss das Allgemeine eben etwas entgegenkommender, inkludierender eingerichtet werden. Auf der Ebene der Herstellung wirtschaftlicher und materieller Sicherheit ist da etwas dran - aber auf der Ebene der kulturellen Differenzen bleibt auch dieser Vorschlag auf dem Terrain der Ratgeberliteratur.
Das Buch schließt mit einem Appell an die "Arbeit an kulturellen Grundwerten und einer von allen geteilten kulturellen Praxis sowie deren Vermittlung und Durchsetzung" - was ein wenig an Leitkultur erinnert. Reckwitz' Rede von den "Regeln", auf die man sich zu einigen habe, ist dabei in schönstem scholastischem Habitus verfasst, wie Pierre Bourdieu gesagt hätte: Der Intellektuelle stellt sich die Ordnung der Gesellschaft als das Problem der Konsistenz verbindlicher Regeln vor. Schon die Frage, warum sich wer in welcher Situation an die Regel halten kann und will, kommt hier nicht vor, obwohl Reckwitz betont, sein Liberalismus rechne "mit der Eigendynamik und Nichtdeterminierbarkeit der Gesellschaft". Aber worin soll sich dieser neue Liberalismus dann einbetten? In den Staat? In den Nationalstaat? Oder doch in die Gesellschaft? Und was heißt das dann?
Es ist tatsächlich nur ein kurzes lucidum intervallum, in dem jene Eigendynamik und Nichtdeterminiertheit aufscheint - ist doch gerade das die gesellschaftstheoretische Herausforderung, die eine kulturalisierende Soziologie wie die von Reckwitz gar nicht recht sehen kann. So rechnen die Lösungsvorschläge von Reckwitz nicht wirklich mit der Eigendynamik politischer, ökonomischer, rechtlicher und nicht zuletzt medialer Logiken. Nur deshalb sehen sie so plausibel aus. Sie tun so, als könne man kulturelle Selbstverpflichtungen dekretieren, als könnten sich Lebensformen durch guten Willen ändern - und treffen so das Selbstbild genau jenes Milieus, an dem die Diagnose ansetzt, welche eben dieses Milieu so beeindruckt. Als Begriff von Gesellschaft bleibt dann nur die Common-Sense-Idee des "Wir alle", bestimmt durch von allen geteilte Regeln.
So stellt man sich Gesellschaftsdesign vielleicht als kreativwirtschaftlichen Akt vor, aber soziologisch kann das nicht überzeugen. Von der Eigendynamik und Nichtregierbarkeit einer funktional differenzierten, dezentralen, bisweilen steuerungsresistenten Gesellschaft wird man vor diesem Hintergrund eher überrascht werden. Selbsterschöpfung ist dann geradezu vorprogrammiert.
ARMIN NASSEHI
Andreas Reckwitz:
"Das Ende der Illusionen". Politik, Ökonomie und
Kultur in der Spätmoderne.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 305 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 06.02.2022
Spätmoderne treffend analysiert









