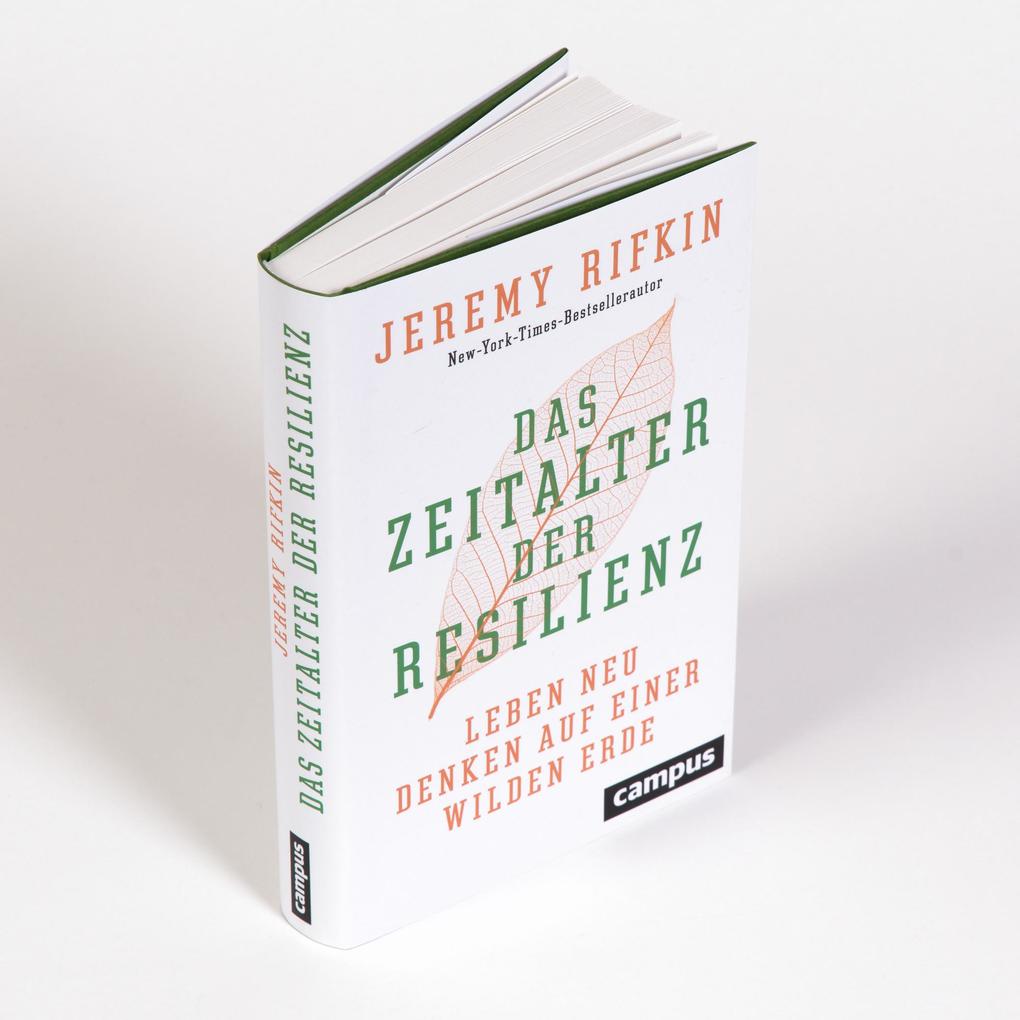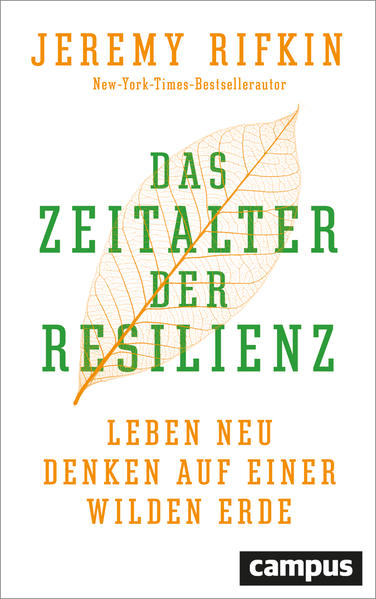
Zustellung: Do, 30.01. - Sa, 01.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Geschichte der Menschheit und die Zukunft unserer Spezies auf der Erde - beides zusammen muss ganz neu gedacht werden. Der Ökonom und Bestsellerautor Jeremy Rifkin zeigt, wie die Inbesitznahme der Erde und das industrielle Effizienzdenken alle Lebensbereiche durchdrungen und uns an den Rand des ökologischen Untergangs geführt haben. Nur ein radikaler Wandel unseres Selbstbildes kann uns noch retten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse stellen dem Homo oeconomicus einen Menschen entgegen, der sich als Ökosystem begreift, sich an seine Umwelt anpasst und widerstandsfähig wird, statt die Natur auszubeuten. Rifkin liefert die übergreifende Erzählung für den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen globalen Weg vom Zeitalter des Fortschritts zum Zeitalter der Resilienz.»Jeremy Rifkin schlägt vor, dass wir die Natur als unser Klassenzimmer betrachten und es wagen, jeden Aspekt unserer Existenz neu zu überdenken, damit das Leben auf der Erde wieder aufblühen kann. Ein Dialog, der längst überfällig ist. «Jane Goodall»Brillant - Mit 'Das Zeitalter der Resilienz' beweist Rifkin erneut, dass er einer der großen Vordenker unserer Zeit ist. «Sigmar Gabriel
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Oktober 2022
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
359
Autor/Autorin
Jeremy Rifkin
Übersetzung
Jürgen Neubauer
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
Lesebändchen
Gewicht
574 g
Größe (L/B/H)
220/143/31 mm
ISBN
9783593506647
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Es mag immer die Frage bleiben, wie weit man ein System mit einer so starren Dynamik, wie sie der Kapitalismus hat, von innen erneuern kann. Wenn ein so vernünftiger, wissenschaftsgetriebener Mensch wie Jeremy Rifkin das tut, ist das allerdings mit Sicherheit ein erster Schritt in eine richtige Richtung. « Andrian Kreye, Süddeutsche Zeitung, 14. 10. 2022
»Es ist wohl nicht übertrieben, Jeremy Rifkins neuestes Werk als sein Opus Magnum zu bezeichnen. « Johannes Kaiser, Deutschlanfunk Kultur, 09. 11. 2022
»Eine große Erzählung konsequent zu Ende gedacht. Und eine Chance auf einen neuen Anfang. « Winfried Kretschmer, ChangeX, 21. 11. 2022
»Ein faszinierendes Buch, eine Abrechnung mit einem kurzfristigen Effizienzdenken und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rettung des Lebens auf unserem Planeten. « Conrad Lay, SWR2 Lesenswert, 09. 12. 2022
»Unter der Überschrift Resilienz bietet [Jeremy Rifkin] der modernen, auf Effizienz getrimmten Gesellschaft eine Verhaltenstherapie an, die Ressourcen nicht nur schont, sondern sie auch besser (lokaler) verteilt und nutzt, um sie zu erhalten. Das ist nicht einfache Kapitalismusschelte, sondern kluge, mit klaren Beispielen unterlegte Argumentation und dazu spannend zu lesen. « Joachim Treusch, Sachbücher des Monats März 2023, Buchmarkt, 27. 02. 2023
»Es ist wohl nicht übertrieben, Jeremy Rifkins neuestes Werk als sein Opus Magnum zu bezeichnen. « Johannes Kaiser, Deutschlanfunk Kultur, 09. 11. 2022
»Eine große Erzählung konsequent zu Ende gedacht. Und eine Chance auf einen neuen Anfang. « Winfried Kretschmer, ChangeX, 21. 11. 2022
»Ein faszinierendes Buch, eine Abrechnung mit einem kurzfristigen Effizienzdenken und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Rettung des Lebens auf unserem Planeten. « Conrad Lay, SWR2 Lesenswert, 09. 12. 2022
»Unter der Überschrift Resilienz bietet [Jeremy Rifkin] der modernen, auf Effizienz getrimmten Gesellschaft eine Verhaltenstherapie an, die Ressourcen nicht nur schont, sondern sie auch besser (lokaler) verteilt und nutzt, um sie zu erhalten. Das ist nicht einfache Kapitalismusschelte, sondern kluge, mit klaren Beispielen unterlegte Argumentation und dazu spannend zu lesen. « Joachim Treusch, Sachbücher des Monats März 2023, Buchmarkt, 27. 02. 2023
 Besprechung vom 16.12.2022
Besprechung vom 16.12.2022
Lernen vom Netz des Lebens
Abschied vom Prinzip der Effizienz: Jeremy Rifkins neuestes Buch zur Lage der Welt
Finanzkrise, Corona-Krise, Klimakrise, Lieferkettenkrise, Demokratiekrise - es ist nicht ganz leicht, inmitten so vieler Entwicklungen und Ereignisse, die mit dem Wort Krise belegt werden, den Überblick zu behalten. Diskussionen, was diese Krisen möglicherweise miteinander verbindet, greifen oft auf alte Muster zurück. Dann ist etwa "der Kapitalismus" die Wurzel allen Übels oder "die Globalisierung"; und auf der rechten Seite des politischen Spektrums blühen Verschwörungsmythen wie die vom "tiefen Staat" oder von kleinen Gruppen, die angeblich alles Unheil steuern.
Auf die konstatierten Krisen wird mit Versuchen reagiert, möglichst zu einer vagen früheren "Normalität" zurückzufinden - die aber doch der Ausgangspunkt für ebendiese Krisen gewesen sein muss. Selbst die als so provokant empfundene Klimabewegung hat letztlich ein eigentlich konservatives Ziel: Die Lebensbedingungen sollen in etwa so bleiben, wie sie sind. Neue Entwürfe kommen so kaum in Sicht.
Nun hat sich Jeremy Rifkin darangemacht, den gemeinsamen Nenner der Krisen unserer Zeit zu orten, und dieser Autor ist für großformatige Entwürfe und Deutungen der Weltsituation bekannt. Beginnend mit "Entropie - ein neues Weltbild" (1982) und "Genesis zwei" (1986) hat er jeweils im Abstand einiger Jahre Bücher vorgelegt, in denen er groß zugeschnittene Ideen präsentierte. Wunsch und Entwurf lagen dabei häufig nahe beieinander, etwa in "Das Verschwinden des Eigentums" (2000) und "Die empathische Zivilisation" (2010).
Nun also das "Zeitalter der Resilienz". Der Begriff beschreibt die Fähigkeit, Schock- und Stressereignissen zu widerstehen und sich in veränderlichen Zeiten durch eigene Veränderung zu behaupten. Von der Systemtheorie ist der Begriff längst in Wellness- und Beraterjargons eingewandert, was ihn freilich nicht gleich entwerten muss.
Als gemeinsamen Nenner der gegenwärtig konstatierten Krisen identifiziert Rifkin das Prinzip Effizienz. Er zeichnet dazu nach, wie im Lauf der Industrialisierung eine kleine Anzahl von Kennwerten, etwa Produktivität und Warenumsatz, zum Maß aller Dinge geworden seien, während darüber vergessen wurde, etwa die ökologischen Lebensgrundlagen zu beachten oder ausreichend auf unerwartete Geschehnisse vorbereitet zu sein - sei es durch die Einlagerung von Gesichtsmasken im Fall einer Pandemie oder von ausreichend eingekauften Mikrochips für den Fall einer Lieferunterbrechung. Als Beispiel für risikobehaftete Effizienz führt Rifkin auch landwirtschaftliche Monokulturen an, die ihre eigenen Produktionsbedingungen zerstören.
Als Gegenmittel dazu präsentiert Rifkin die titelgebende Resilienz, die er vor allem in Ökosystemen verwirklicht sieht. Diese implodieren nicht einfach, wie es mit dem Bankensystem nach der Lehman-Pleite ohne das Gegensteuern der Staaten passiert wäre. Das Netz des Lebens ist mit vielen Reserven und Doppelungen ausgestattet, etwa bei Nährstoffen oder Arten mit ähnlichen Systemfunktionen. Es hat auch die Fähigkeit, sich anzupassen und zu verändern. Die Leistung von biologischen Systemen werde "nicht anhand der Produktivität gemessen, sondern anhand ihrer Erneuerbarkeit", schreibt Rifkin.
Das Ansprechende an dieser Art von Kritik ist, dass sie nicht von Prämissen und Doktrinen eingeengt wird, wie das etwa in der linken Kapitalismuskritik der Fall ist, sondern sich ohne vorgegebenes Ergebnis an Einsichten der Kybernetik und Ökologie orientiert. Bis hierhin ist Rifkin auf der richtigen Spur, was das Buch vielversprechend wirken lässt. Doch was dann folgt, ist eine große Enttäuschung. Rifkin wendet die von ihm gepriesene Kreislaufwirtschaft selbst an und rezykliert teils jahrzehntealte Inhalte aus früheren Büchern, etwa in seinen Ausführungen zur Entropie oder zum globalen "Green Deal".
Tiefe versucht das Buch durch ideengeschichtliche Referenzen zu bekommen. Doch Ausführungen darüber, welche Vordenker aus früheren Jahrhunderten schuld an den heutigen Problemen seien, bleiben unschlüssig. Eine Fülle an Daten und Fakten soll Evidenz erzeugen und schlägt sich in einem stattlichen Quellenverzeichnis nieder, aber das Werk wirkt wie mit Copy und Paste collagiert. Ein Kapitel zu einer von Teilhabe geprägten "Peerocracy" als Alternative zur repräsentativen Demokratie soll originell sein, verliert sich aber in wenig erhellenden Weitschweifigkeiten. Die Ausführungen, wie ein neues Umweltbewusstsein, eine neue Wissenschaftsmethodik oder konkrete Investitionen in Infrastruktur dabei helfen können, die Resilienz der Gesellschaft zu stärken, bleiben lose Enden. Am bittersten ist, dass Rifkin die Natur geradezu mythisch überhöht, dann aber ihren strategischen Schutz - wie etwa Feuchtgebiete Wasser- und Nahrungsversorgung resilienter machen können - weitgehend ignoriert.
Das Thema dieses Buchs haben die Biologen Lance H. Gunderson und Crawford Stanley Holling schon vor zwanzig Jahren in ihrem Resilienz-Klassiker "Panarchy" deutlich profunder ausgearbeitet. Wer Inspiration dafür sucht, die Muster der aktuellen Krisen zu deuten und ideologiefrei Alternativen zu suchen, wird dort eher fündig. CHRISTIAN SCHWÄGERL
Jeremy Rifkin: "Das Zeitalter der Resilienz". Leben neu denken auf einer wilden Erde.
Aus dem Englischen von Jürgen Neubauer. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2022. 360 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
am 13.02.2023
Lesepflicht
Einfach beeindruckend! Jeremy Rifkin zeigt uns in diesem Buch, wie ein Umdenken stattfinden muss, damit wir unseren Planeten am Laufen halten. Einzig die starke US-Sichtweise ist für uns in Europa nicht immer ganz so transparent und wichtig, aber ansonsten macht es schon Sinn, was er hier schreibt und aufzeigt. Es ist schon ausgesprochen interessant, einmal hinter die Kulissen zu blicken und Einblick in Dinge zu bekommen, die dem normalen Bürger oftmals gar nicht so bekannt sind.
Ein ausgesprochen interessantes, wichtiges Buch, das hoffentlich die richtigen Leute lesen und vielleicht doch das eine oder andere davon umsetzen.
LovelyBooks-Bewertung am 13.02.2023
Ein absolut wichtiges, aktuelles Buch.