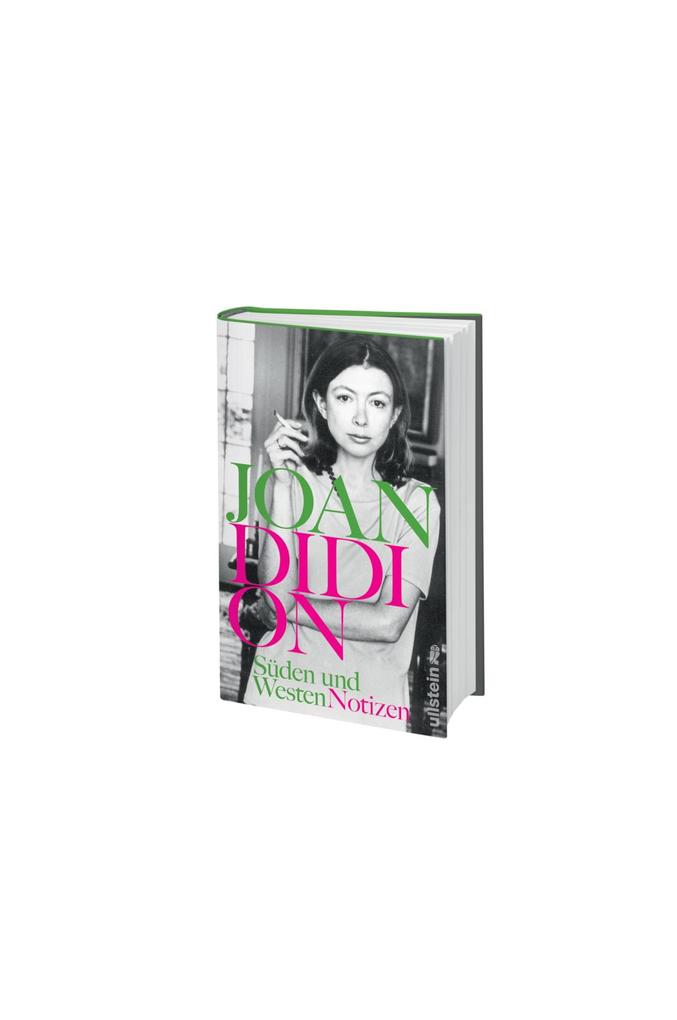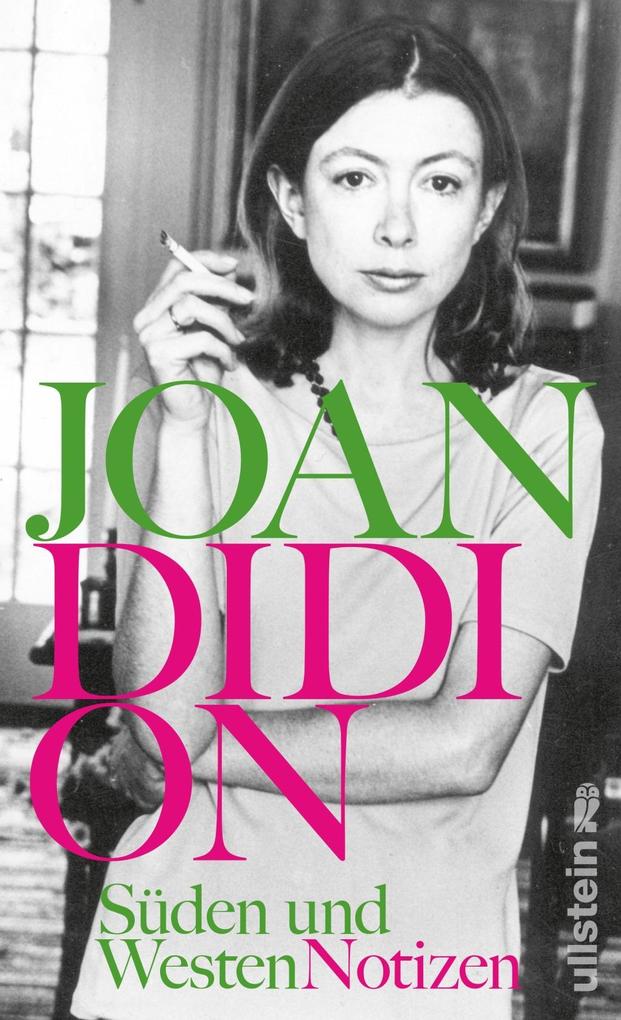
Zustellung: Sa, 21.12. - Di, 24.12.
Sofort lieferbar
Versandkostenfrei»Sie werden aus diesen vierzig Jahre alten Notizen mehr über Amerikas Zukunft erfahren als aus der Zeitung von morgen.« Esquire
Ein feinsinniges Porträt uramerikanischer Landschaften, in dem sich bereits die Bruchlinien andeuten, an denen entlang sich das heutige Amerika spaltet: Im Sommer 1970 unternahm Joan Didion gemeinsam mit ihrem Mann John Gregory Dunne eine Reise in die amerikanischen Südstaaten, mit der vagen Idee, darüber zu schreiben. Das Stück ist nie erschienen, aber ihre Notizen blieben erhalten und werden nun erstmals veröffentlicht. Wie in ihren hochgelobten Essays und Reportagen zeigt sich auch in diesem ursprünglichen Material die Beobachtungsgabe, der Scharfsinn und das Gespür für beiläufige und doch vielsagende Szenen sowie Didions präzise, unwiderstehlich rhythmisierte Sprache, die ihre Texte so einzigartig macht. Ergänzt werden Didions Reisenotizen um bisher ebenfalls unveröffentlichte Aufzeichnungen, die 1976 entstanden, als sie in San Francisco im Auftrag des Rolling Stone den Prozess beobachtete, der der Millionenerbin Patty Hearst wegen Bankraubs gemacht wurde.
»Ein Buch für ihre vielen hingebungsvollen Leser und für jeden, der sich für den geheimnisvollen Prozess des Schreibens interessiert.« Booklist
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. Februar 2018
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
160
Autor/Autorin
Joan Didion
Übersetzung
Antje Rávik Strubel
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
260 g
ISBN
9783550050220
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Es ist diese Art von reflektiertem Impressionismus, die Didion und ihr schreibendes Ich berühmt gemacht hat." Jürgen Kaube, FAZ
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 16.01.2022
Besondere Einblicke in das Denken des Südens