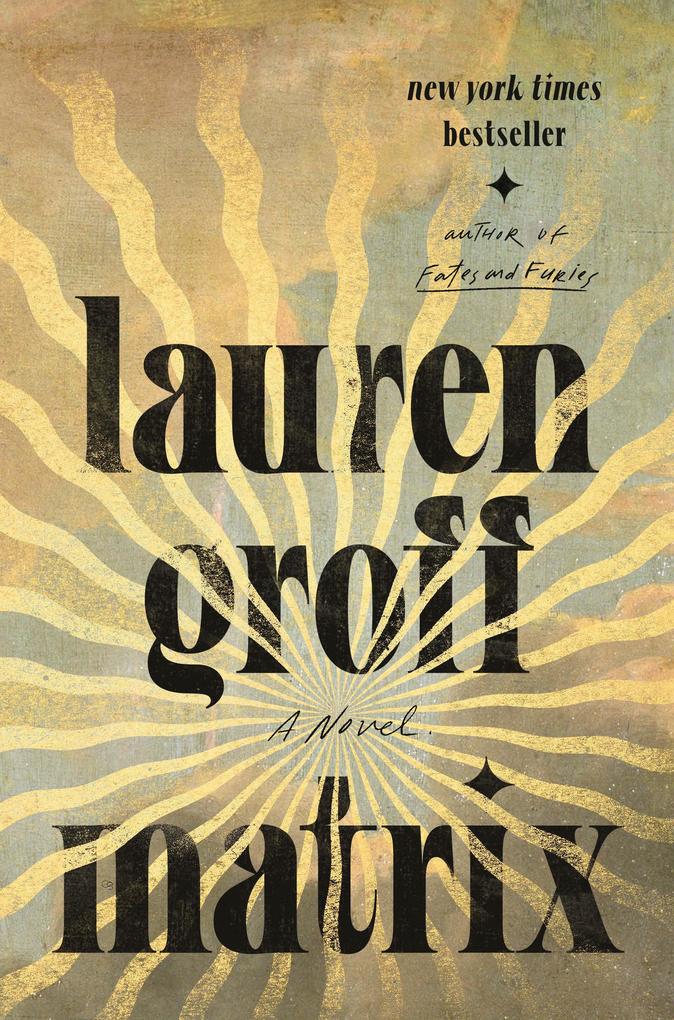
Zustellung: Sa, 18.01. - Do, 23.01.25
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
One of our best American writers, Lauren Groff returns with her exhilarating first new novel since the groundbreaking Fates and Furies.
Cast out of the royal court by Eleanor of Aquitaine, deemed too coarse and rough-hewn for marriage or courtly life, seventeen-year-old Marie de France is sent to England to be the new prioress of an impoverished abbey, its nuns on the brink of starvation and beset by disease.
At first taken aback by the severity of her new life, Marie finds focus and love in collective life with her singular and mercurial sisters. In this crucible, Marie steadily supplants her desire for family, for her homeland, for the passions of her youth with something new to her: devotion to her sisters, and a conviction in her own divine visions. Marie, born the last in a long line of women warriors and crusaders, is determined to chart a bold new course for the women she now leads and protects. But in a world that is shifting and corroding in frightening ways, one that can never reconcile itself with her existence, will the sheer force of Marie's vision be bulwark enough?
Equally alive to the sacred and the profane, Matrix gathers currents of violence, sensuality, and religious ecstasy in a mesmerizing portrait of consuming passion, aberrant faith, and a woman that history moves both through and around. Lauren Groff's new novel, her first since Fates and Furies, is a defiant and timely exploration of the raw power of female creativity in a corrupted world.
Story Locale: 12th Century England and France
Cast out of the royal court by Eleanor of Aquitaine, deemed too coarse and rough-hewn for marriage or courtly life, seventeen-year-old Marie de France is sent to England to be the new prioress of an impoverished abbey, its nuns on the brink of starvation and beset by disease.
At first taken aback by the severity of her new life, Marie finds focus and love in collective life with her singular and mercurial sisters. In this crucible, Marie steadily supplants her desire for family, for her homeland, for the passions of her youth with something new to her: devotion to her sisters, and a conviction in her own divine visions. Marie, born the last in a long line of women warriors and crusaders, is determined to chart a bold new course for the women she now leads and protects. But in a world that is shifting and corroding in frightening ways, one that can never reconcile itself with her existence, will the sheer force of Marie's vision be bulwark enough?
Equally alive to the sacred and the profane, Matrix gathers currents of violence, sensuality, and religious ecstasy in a mesmerizing portrait of consuming passion, aberrant faith, and a woman that history moves both through and around. Lauren Groff's new novel, her first since Fates and Furies, is a defiant and timely exploration of the raw power of female creativity in a corrupted world.
Story Locale: 12th Century England and France
Produktdetails
Erscheinungsdatum
07. September 2021
Sprache
englisch
Seitenanzahl
272
Autor/Autorin
Lauren Groff
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
458 g
Größe (L/B/H)
232/158/26 mm
ISBN
9781594634499
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
am 08.09.2022
Große Visionen
Auf den ersten Blick ist Matrix einfach nur ein zutiefst feministisches Werk, das veranschaulicht, wie Frauen ohne Männer eigentlich mindestens genauso gut dran sein können. Im tiefsten Mittelalter, geprägt von Dogmen und der Unterwerfung der Frau, erleben wir Marie, eine in vielerlei Hinsicht sehr ungewöhnliche Romanfigur, die mir auf Anhieb sympathisch war.
Als uneheliche Tochter aus dem Hause Plantagenet kommt Marie zunächst nach dem Tod ihrer Mutter an den englischen Königshof, wird aber mit gerade mal siebzehn Jahren von Königin Eleonore hinaus in ein abgelegenes Kloster geschickt. Ausgerechnet Marie, die mit den kirchlichen Dogmen und Traditionen wenig anfangen kann, soll diesem armen Kloster, dessen Nonnen unter Hunger, Kälte und Krankheit leiden, als Priorin vorstehen.
Doch tatsächlich gelingt es Marie im Laufe der Zeit, nachdem der Schmerz über die Zurückweisung von ihrer geliebten Königin langsam abgeklungen ist, dem Kloster nicht nur Wohlstand und Schutz vor der Außenwelt zu verschaffen. Tatsächlich entwickelt sich das Kloster unter Maries Führung über die Jahre hinweg zu einer Insel von gottesfürchtigen Frauen, die nicht nur sehr gut ohne Männer auskommen, sondern diese sogar als etwas Bedrohliches zu empfinden beginnen.
Matrix erzählt aber auch ganz allgemein, was der Mensch allen Widrigkeiten zum Trotz (er)schaffen kann, wenn man bzw. frau nur den Mut hat, sich über starre Regeln und Meinungen hinwegzusetzen.
Die Erzählung zeigt aber auch, dass man Großes eigentlich nur mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber Kollateralschäden erreichen kann, denn überall wo man etwas Neues aufbaut, reißt man gleichzeitig auch etwas Altes ein. Den ganzen Roman über war ich so zwiegespalten, weil Marie natürlich unbestreitbar Großes vollbringt, das Ganze aber auch immer mit einer gewissen Zerstörung einhergeht und mit der Frage, wann ein großes Werk noch legitim ist und wann es nur der Befriedigung der eigenen Geltungssucht dient oder gar in Größenwahn umschlägt.
Nicht nur das Geschehen selbst, auch die Art und Weise, wie erzählt wird, ist außergewöhnlich. Die Erzählung wirkt seltsam unbeteiligt, da sie die Emotionen zwar intensiv beschreibt, aber nicht darauf verweilt. Die vielen Jahre im Kloster werden wie im Zeitraffer erzählt, keine unnötigen Phrasen begleiten das Vergehen der Zeit. Diese Erzählweise, so ungewohnt sie sein mag, passt aber sehr gut zu diesem Werk, das Einzelschicksale nur kurz in den Fokus nimmt, um sie dann in den großen Zusammenhang der Geschichte und von Gottes Werk zu setzen.
Auch wenn der ein oder andere die Schreibweise als gewöhnungsbedürftig empfinden mag, der Roman lohnt sich auf jeden Fall und rückt das menschliche Leben in eine neue Perspektive. Eine klare Empfehlung.









