 Besprechung vom 16.10.2021
Besprechung vom 16.10.2021
Wenn Helden sterben, dann meist aus Versehen
Margaret Atwood wurde mit "Handmaid's Tale" weltberühmt. Doch schon 1972 sorgte sie mit "Survival" für großes Aufsehen.
Von Sandra Kegel
Margaret Atwood gilt als eine der wichtigsten Autorinnen Kanadas, die erfolgreichste ist sie auf jeden Fall. 1939 als Tochter eines Insektenforschers geboren, verbrachte sie ihre Kindheit in Holzhütten in der Wildnis. Damit begründete sie selbst einmal ihre obsessive Beschäftigung mit dem Thema Überleben: dass sie von klein auf bestimmte Dinge wissen musste, um nicht in den Wäldern verloren zu gehen.
Seit sie 1961 ihren ersten Gedichtband "Double Persephone", damals noch im Selbstverlag, veröffentlichte, handeln viele ihrer mehr als siebzig Bücher von diesem Kampf. Schlagartig berühmt aber wurde die heute einundachtzigjährige Schriftstellerin nicht etwa mit ihrem kanonischen Longseller "Report der Magd" von 1985, sondern bereits dreizehn Jahre zuvor, mit einem theoretischen Buch, das Überleben schon im Namen trägt: "Survival". Angesichts des arglosen Untertitels "A Thematic Guide to Canadian Literature" hätte damals aber wohl niemand auf einen Bestseller gewettet.
Margaret Atwood trieb 1972 der Gedanke um, ob es das überhaupt gebe, eine kanadische Literatur. Nicht für Akademiker legte sie diesen essayistischen Text in zwölf Kapiteln an, sondern für den "Durchschnittsleser", subjektiv, polemisch, unterhaltsam, ohne Fußnoten und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Als "Survival" erschien, lag der zwölfhundert Seiten starke "Oxford Companion to Canadian Literature" (1997) noch in weiter Ferne. Und was heute selbstverständlich ist, war vor fünfzig Jahren längst nicht ausgemacht. Selbst Kanadier griffen damals bevorzugt noch zu amerikanischer, englischer oder französischer Literatur, wollten sie anspruchsvolle Bücher lesen, ihre eigene Literatur betrachteten sie als provinziell. Und auch die Literaturwissenschaftlerin Atwood, die auf die viktorianische Ära spezialisiert war, hatte sich akademisch mit der Literatur ihres Heimatlandes nie zuvor befasst. Nun hatte sie gleich mehrere Beweisführungen im Sinn, wollte nicht nur zeigen, dass es eine "Canlit" gab, die mehr war als bloß eine "dürftige Spielart" englischsprachiger und französischer Werke. Sie arbeitete außerdem heraus, dass sich kanadische Autorinnen und Autoren mit Themen befassten, die aus der Geschichte und der Geopolitik ihrer Heimat hervorgingen.
"Wenn man ein felsiges, wasserreiches Land im Norden ist, mit kühlem Klima, großer geografischer Ausdehnung, einer kleinen, aber bunten Bevölkerung und einem riesigen, aggressiven Nachbarn im Süden, wie sollte man dann die gleichen Sorgen haben wir dieser riesige, aggressive Nachbar im Süden", resümierte sie gewohnt scharfzüngig in einer 2003 nachgereichten Einleitung. 1972 traf sie mit diesem Ansatz ins Schwarze. Innerhalb eines Jahres waren dreißigtausend Exemplare verkauft, und die sofort einsetzende Diskussion um die Thesen von "Survival" ist bis heute im kanadischen Diskurs nicht verstummt. Man mag daher kaum glauben, dass die geistreiche und provokante Schrift jetzt zum ersten Mal auf Deutsch zu lesen ist.
Tatsächlich erklärt Atwood in "Survival - Ein Streifzug durch die kanadische Literatur" kühn ihr ureigenes Thema zum alles bestimmenden Gedanken im Gegenstand ihrer Betrachtung. "Survival, la Survivance" ist ihr dabei eine ebenso facettenreiche wie wandlungsfähige Idee. Ging es bei den frühen Entdeckern und Siedlern noch ums nackte Überleben, stand der Gedanke bei den Frankokanadiern nach der Machtübernahme der Engländer vor allem für kulturelles Überleben, also den Fortbestand der eigenen Religion und Sprache unter fremder Herrschaft. Aber auch im englischsprachigen Teil Kanadas diagnostiziert Atwood schon damals eine ähnliche kulturelle Angst vor dem wachsenden Einfluss des Nachbarn Amerika. "Die Kanadier messen fortwährend ihren kulturellen Puls", so Atwood, doch dabei gehe es nicht etwa darum, ob der Patient wieder ein gutes Leben führen könne, "sondern ob er überhaupt überlebt".
Das kanadische Überlebensmotiv setzt sie dabei in Beziehung und zugleich ab von der Bedeutung der Grenze für die amerikanische Literatur und der Insel für die britische. Die Grenze nimmt sie als Markierung zwischen alter und neuer Ordnung und also für die Hoffnung auf eine ideale Gesellschaft, die sich freilich niemals erfüllt, wovon Atwood zufolge ein Großteil der amerikanischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts handelt. In der Insel als symbolischer Entsprechung erkennt sie hingegen den autarken, gleichwohl im Innern stark hierarchisch organisierten Körper, der für die englische Literatur maßgeblich wird.
Die kanadische Leitidee erzeugt indes weder Spannung wie die Grenze noch das Sicherheitsempfinden einer Insel, auf der alles seinen Platz hat, sondern ist und bleibt "eine fast schon unerträgliche Furcht". Handlungsverläufe, die Atwood in der ihr eigenen Komik beschreibt, lesen sich als Miniaturen der Vergeblichkeit: "Schiff rammt Eisberg. Die meisten Passagiere ertrinken" (E. J. Pratt, "Die Titanic"); "Alte Frau krallt sich verbissen ans Leben und stirbt" (Margaret Laurence, "Der steinerne Engel"); "Mann, der keine Beziehungen mehr zu seinen Mitmenschen aufbauen kann, versucht kranken Hund zu retten, scheitert und wird am Ende angezündet" (Graeme Gibson, "Kommunion").
Dass Scheitern unumgänglich sei und Helden unverhältnismäßig oft sterben, aber keinen Heldentod, sondern meist aus Versehen, wird in vielen Beispielen bis hinein in die Tiergeschichten von Ernest Thompson Seton, Dorothy Roberts oder Michael Ondaatje untersucht, wobei nach Atwood ein kanadischer Moby Dick unbedingt aus der Perspektive des Wals erzählt worden wäre: "Warum jagt mir dieser komische weiße Mann mit der Harpune hinterher?" Sie zerlegt Siedler- und Erkundermythen, erklärt die Herangehensweise an Familie unter anderem in Texten von Alice Munro - Fazit auch hier: "Familie in der kanadischen Literatur ist eine Falle, in der man festsitzt." Auch in der frankokanadischen Literatur etwa von Marie-Claire Blais, die allerdings nur gestreift wird, ist der Befund: Todessehnsucht und Opferrolle, wohin man schaut.
Die teilweise harsche Kritik an "Survival" entzündete sich zumeist an der Lückenhaftigkeit des Textes und dem fehlenden Blick auf Multikulturalität oder indigene Autoren, wobei Atwood dies 1972 mit dem Hinweis begründete, dass die kanadischen Ureinwohner gerade erst begönnen, ihre Geschichten zu erzählen. Das Faszinosum an "Survival" jenseits literaturhistorischer Relevanz liegt darin, dass es nicht nur die englischsprachigen Literaturen auf äußerst originelle Weise gegen den Strich bürstet, sondern außerdem von dem Land Kanada erzählt, wie es die Autorin 1972 sieht. Damit freilich folgt Margaret Atwood ihrem eigenen Credo, wonach die Literatur geprägt wird durch die Menschen, die sie erschaffen, die wiederum von dem Ort geprägt werden, an dem sie leben.
Margaret Atwood: "Survival". Ein Streifzug durch die kanadische Literatur.
Aus dem kanadischen Englisch von Yvonne Eglinger. Berlin Verlag, Berlin 2021. 336 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.












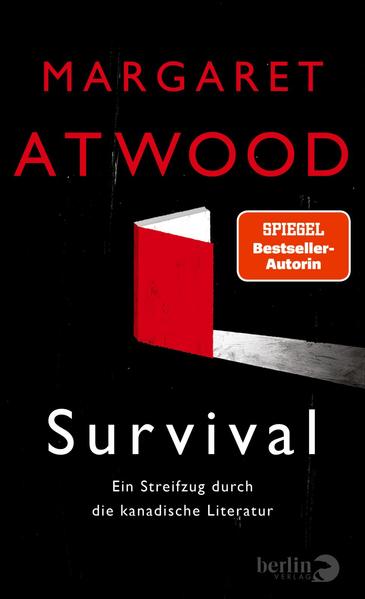
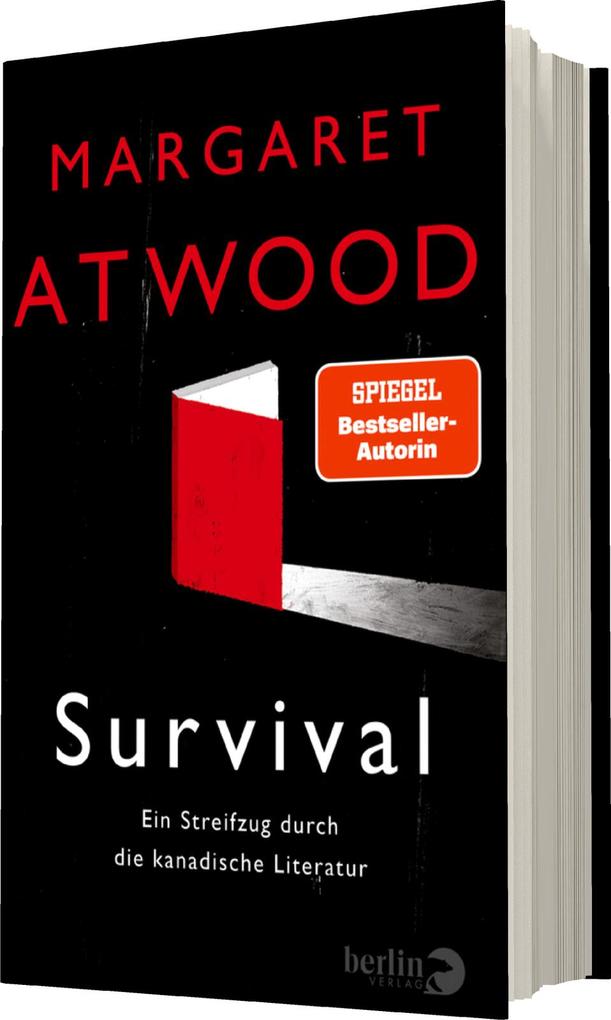
 Besprechung vom 16.10.2021
Besprechung vom 16.10.2021