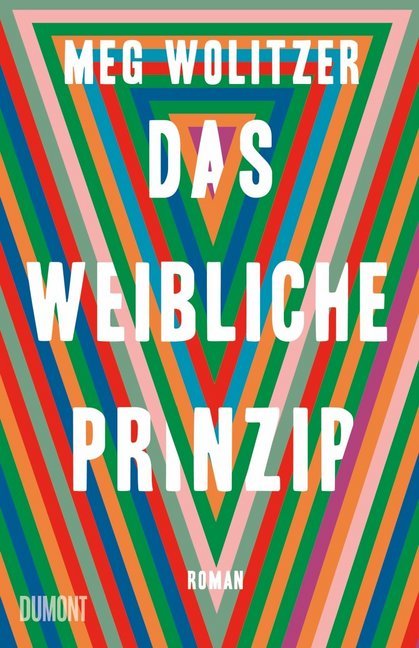
Zustellung: Di, 11.02. - Di, 18.02.25
Versand in 6 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die schüchterne Greer Kadetsky ist noch nicht lange auf dem College, als sie der Frau begegnet, die ihr Leben für immer verändern soll: Faith Frank. Die charismatische Dreiundsechzigjährige gilt seit Jahrzehnten als Schlüsselfigur der Frauenbewegung, und sie ist das, was Greer gerne wäre: unerschrocken, schlagfertig, kämpferisch. So sehr Greer ihren Freund Cory liebt und sich auf die gemeinsame Zukunft freut, wird sie doch von einer Sehnsucht umgetrieben, die sie selbst kaum benennen kann. Durch die Begegnung mit Faith Frank bricht etwas in der jungen Frau auf, und sie stellt sich die entscheidenden Fragen: Wer bin ich, und wer will ich sein? Jahre später, Greer hat den Abschluss hinter sich, geschieht, wovon sie nie zu träumen gewagt hätte: Faith lädt sie zu einem Vorstellungsgespräch nach New York ein - und führt Greer damit auf den abenteuerlichsten Weg ihres Lebens: einen verschlungenen, manchmal steinigen Weg, letztlich den Weg zu sich selbst. Mal mit funkelndem Witz, mal tief berührend und stets mit großer Empathie erzählt Meg Wolitzer von Macht in all ihren Facetten, von Feminismus, Liebe und Loyalität und beweist sich als hellwache Beobachterin unserer Zeit.»Wenn alles gesagt ist, bleibt Wolitzers unerschöpfliche Fähigkeit, Menschen zu erschaffen, die so real sind wie die Schrift auf dieser Seite, und ihre Liebe zu ihren Charakteren scheint heller als jede Agenda. «Lena Dunham in The New York Times
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. Juli 2018
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
494
Autor/Autorin
Meg Wolitzer
Übersetzung
Henning Ahrens
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit farbigem Vorsatzpapier und Lesebändchen,
Gewicht
646 g
Größe (L/B/H)
214/143/42 mm
Sonstiges
mit farbigem Vorsatzpapier und Lesebändchen
ISBN
9783832198985
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Schriftstellerin Meg Wolitzer schrieb den Roman zur #MeToo-Ära. «
Maren Keller, DER SPIEGEL
»Jeder Mann, beziehungsweise jedermann, sollte es lesen. «
Christian Bos, FRANKFURTER RUNDSCHAU
»Sie [hat] es wieder getan: einen hinreißenden Roman über den Kram geschrieben, von dem es heißt, er würde Männer nicht interessieren. [ ]«
Peter Praschl, LITERARISCHE WELT
»Es ist ein sanfter Roman. Er fließt angenehm dahin, sympathisch und hochprofessionell erzählt [ ]ein klug erzählter Rückblick auf einen langen Weg, dessen Ende nicht abzusehen ist. «
Gabriele von Arnim, DLF KULTUR
» Das weibliche Prinzip ist ein Schmöker der Spitzenklasse, eine typische Great American Novel, die einen von der ersten Seite an packt und, die nie ins Dogmatische abdriftet. «
Luzia Stettler, SRF 52 Beste Bücher
»Meg Wolitzer schreibt wunderbar, humorvoll und klug als Frau, aber vor allem als Mensch. «
Katja Lückert, NDR Kultur
[Wolitzer] schreibt klug über Macht und Solidarität, über Beziehungen und Selbstfindung. «
Judith Liere, STERN
»Meg Wolitzer hat die Fähigkeit, glaubwürdige Figuren zu schaffen, die nicht schlauer, aber auch nicht dümmer sind als das Leben. Man könnte sagen, Das weibliche Prinzip sei der Roman der Stunde, es ist allerdings keine Modeerscheinung, dass Frauen Opfer männlicher Gewalt werden. «
Maik Brüggemeyer, ROLLING STONE
»Ein Buch des Jahres: Wolitzers Roman erzählt von einem halben Jahrhundert Feminismus, von Verrat und Verletzungen, von Macht, Idealen und Enttäuschungen. «
KIELER NACHRICHTEN
»Es geht um die großen Dinge des Lebens Liebe, Loyalität, Feminismus und es ist eindeutig ein Turnpager, denn die Autorin schreibt mit Witz und Empathie. «
Sabine Oelmann, N-TV. DE
»Meg Wolitzer hat das Buch der Stunde geschrieben. «
Anne-Sophie Scholl, SCHWEIZ AM WOCHENENDE
» Das weibliche Prinzip ist Bildungsroman, Feminismuskritik und zugleich Plädoyer für einen neuen Feminismus. «
Petra Kohse, BERLINER ZEITUNG
»In diesem Roman geht es nicht darum, Feminismus zu erklären. Es geht darum, dass die Personen, denen du begegnest, dich verändern können. «
Elena Berchermeier, FRANKFURTER RUNDSCHAU
»Man möchte [den Roman] einer fast erwachsenen Tochter zum Lesen geben. «
Mia Eidlhuber, DER STANDARD
»Der Roman [besitzt] neben seinem subtilen Humor eine raffiniert vorbereitete Pointe. «
Thomas Linden, KÖLNISCHE RUNDSCHAU
»Ein zutiefst komischer, aber noch mehr bewegender Roman über Kämpfe und Hoffnungen, über Freundschaft und Verrat. «
Mithu Sanyal, WDR 5
»Wolitzer schreibt fesselnd und mit viel Empathie für ihre Figuren. Entstanden ist ein kluger Roman über den Feminismus und den immer noch wichtigen, häufig schwierigen Kampf für Frauenrechte und Gleichberechtigung. «
Elisabeth Langohr, RUHR NACHRICHTEN
»[Ein] mehr als geglückte[r] Roman. «
Christina Rauch, BUCH AKTUELL
»Was Meg Wolitzer richtig gut kann, ist amerikanische Milieus zeichnen. «
Anja Brockert, SWR 2 LESENSWERT
»Meg Wolitzer spürt genau die Details auf, die die feinen Unterschiede ausmachen. «
Katharina Borchardt, SWR 2 LESENSWERT
»Wolitzer gelingt es, das doppelte Tabuthema von weiblichem wie auch feministischem Machtstreben anhand glaubhafter Charaktere zu vermitteln. «
Sonja Eismann, MISSY MAGAZIN
»Die Beziehungen, [ ] sind wunderbar beschrieben und so schafft Meg Wolitzer Charaktere, die wir lieb gewinnen. «
Ariane Wick, HR 2 KULTUR
»Was Wolitzer immer wieder fantastisch gelingt, ist Figuren und Welten zu erschaffen, die real und überzeugend sind. «
Jörg Petzold, FLUX FM
»Mit ihrem eigenen Schreiben zeigt [Meg Wolitzter], dass die Great American Novel keine Männersache ist. «
Jana Volkmann, BUCHKULTUR
»Ihre Bücher sind ruhige, intelligente Langzeitbetrachtungen von Menschen und ihrer Art, sich in der Welt zu bewegen. «
Nina Berendonk, DONNA
»Ein kluger, komplexer Roman darüber, was Feminismus heute sein kann. «
Saskia Stöcker, FREUNDIN
»ein sommerlich leichter Zugang zum Thema Feminismus und was er für Frauen bedeuten kann. «
Christina Traar, KLEINE ZEITUNG
»ein wohltuender Roman, eine Bestätigung für Frauen, die etwas bewegen wollen, dass das der richtige Weg ist. «
Britta Bode, BERLINER MORGENPOST
»[Wolitzer] steuert einen sympathischen, warmherzigen und selbstkritischen Beitrag zur Geschlechterdebatte bei. Lesenswert auch für Männer, die der Titel vielleicht ein wenig abschrecken mag. «
Franziska Trost, KRONEN ZEITUNG
»Die Stärke der amerikanischen Autorin ist es, Zeiten und Welten heraufzubeschwören.
Wolitzer beschreibt Charaktere so, dass man meint, sie wären Freunde. «
Sara Schausberger, FALTER
»Sie hat die große Fähigkeit, auch wenn er nur am Rande auftritt, jeden Menschen als ganzen darzustellen. «
David Eisermann, WDR 3 Mosaik
»Auch wenn es der Titel auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, stellt Das weibliche Prinzip einmal mehr den Beweis an, dass in einem Stück Literatur oft mehr Wahrheit steckt als in der Wirklichkeit. «
Bettina Baltschev, MDR KULTUR
»Wir alten weißen Männer müssen lernen zu verstehen, was da passiert. Und uns darüber freuen, dass die Frauen übernehmen. Nun auch mit diesem Buch«
Ulf Poschardt, LITERARISCHE WELT
»Zum einen ist Das weibliche Prinzip einfach ein sehr guter Roman, zum anderen schreibt Meg Wolitzer hier eben gerade nicht über vorgeblich kleine Themen, sondern stellt die Machtfrage. Feminismus bedeutet, dass Frauen ein faires und gutes Leben wollen. Das wird einem nicht einfach geschenkt. «
Christian Bos, KÖLNER STADT-ANZEIGER
»[das Buch] ist klug durchdacht und komponiert, es wandert in der Zeit, ohne jedoch seine Leserschaft zu verwirren. Es ist eindringlich, ohne aufdringlich zu wirken. «
Heidi Ossenberg, BADISCHE ZEITUNG
»Meg Wolitzer ist in Das weibliche Prinzip wieder witzig, empathisch und frauensolidarisch, dass es einfach nur Spaß macht. «
Barbara Meixner, BUCHMARKT
»Wenn Meg Wolitzer eine Emanzipationsgeschichte erzählt, dann ist das in erster Linie auch glänzende Unterhaltung. «
Meike Schnitzler, BRIGITTE
»Lesen, weil . . . das literarische Frauenpower ist. «
COSMOPOLITAN
»Dieses Buch ist keine simple Erklärung unserer Zeit, es geht um Macht und Emanzipation, um Liebe und Freundschaft und ums Erwachsenwerden. «
Miriam Böndel, EMOTION
»Wolitzer zeichnet ihre Heldinnen mit feinstem feministisch-literarischem Pinselstrich. «
Martina Koch, Glamour
»Ein großartiger Roman über die Schwierigkeiten moderner Frauen, feministische Ideale mit dem Leben und der Liebe in Einklang zu bringen. «
Lisa Goldmann, MADAME
»Ein kluger, komplexer Roman darüber, was Feminismus heute sein kann. «
Günther Keil, PLAYBOY
»Wolitzer hat zwei wesentliche Fähigkeiten: Sie schafft Figuren, denen man gerne folgt, und stellt diese in Konstellationen, aus denen sich viel über den Zustand der Gesellschaft zumindest ihres gebildeten, bürgerlichen Teils ablesen lässt. Das ist deutlich mehr, als die meisten Romane schaffen. «
Harald Ries, WESTFALEN POST
»Der Roman ist unterhaltsam, humorvoll, klug konstruiert und hintergründig, aber vor allem wahrhaftig ohne überheblich zu sein. «
Tanja Ochs, HEILBRONNER STIMME
Maren Keller, DER SPIEGEL
»Jeder Mann, beziehungsweise jedermann, sollte es lesen. «
Christian Bos, FRANKFURTER RUNDSCHAU
»Sie [hat] es wieder getan: einen hinreißenden Roman über den Kram geschrieben, von dem es heißt, er würde Männer nicht interessieren. [ ]«
Peter Praschl, LITERARISCHE WELT
»Es ist ein sanfter Roman. Er fließt angenehm dahin, sympathisch und hochprofessionell erzählt [ ]ein klug erzählter Rückblick auf einen langen Weg, dessen Ende nicht abzusehen ist. «
Gabriele von Arnim, DLF KULTUR
» Das weibliche Prinzip ist ein Schmöker der Spitzenklasse, eine typische Great American Novel, die einen von der ersten Seite an packt und, die nie ins Dogmatische abdriftet. «
Luzia Stettler, SRF 52 Beste Bücher
»Meg Wolitzer schreibt wunderbar, humorvoll und klug als Frau, aber vor allem als Mensch. «
Katja Lückert, NDR Kultur
[Wolitzer] schreibt klug über Macht und Solidarität, über Beziehungen und Selbstfindung. «
Judith Liere, STERN
»Meg Wolitzer hat die Fähigkeit, glaubwürdige Figuren zu schaffen, die nicht schlauer, aber auch nicht dümmer sind als das Leben. Man könnte sagen, Das weibliche Prinzip sei der Roman der Stunde, es ist allerdings keine Modeerscheinung, dass Frauen Opfer männlicher Gewalt werden. «
Maik Brüggemeyer, ROLLING STONE
»Ein Buch des Jahres: Wolitzers Roman erzählt von einem halben Jahrhundert Feminismus, von Verrat und Verletzungen, von Macht, Idealen und Enttäuschungen. «
KIELER NACHRICHTEN
»Es geht um die großen Dinge des Lebens Liebe, Loyalität, Feminismus und es ist eindeutig ein Turnpager, denn die Autorin schreibt mit Witz und Empathie. «
Sabine Oelmann, N-TV. DE
»Meg Wolitzer hat das Buch der Stunde geschrieben. «
Anne-Sophie Scholl, SCHWEIZ AM WOCHENENDE
» Das weibliche Prinzip ist Bildungsroman, Feminismuskritik und zugleich Plädoyer für einen neuen Feminismus. «
Petra Kohse, BERLINER ZEITUNG
»In diesem Roman geht es nicht darum, Feminismus zu erklären. Es geht darum, dass die Personen, denen du begegnest, dich verändern können. «
Elena Berchermeier, FRANKFURTER RUNDSCHAU
»Man möchte [den Roman] einer fast erwachsenen Tochter zum Lesen geben. «
Mia Eidlhuber, DER STANDARD
»Der Roman [besitzt] neben seinem subtilen Humor eine raffiniert vorbereitete Pointe. «
Thomas Linden, KÖLNISCHE RUNDSCHAU
»Ein zutiefst komischer, aber noch mehr bewegender Roman über Kämpfe und Hoffnungen, über Freundschaft und Verrat. «
Mithu Sanyal, WDR 5
»Wolitzer schreibt fesselnd und mit viel Empathie für ihre Figuren. Entstanden ist ein kluger Roman über den Feminismus und den immer noch wichtigen, häufig schwierigen Kampf für Frauenrechte und Gleichberechtigung. «
Elisabeth Langohr, RUHR NACHRICHTEN
»[Ein] mehr als geglückte[r] Roman. «
Christina Rauch, BUCH AKTUELL
»Was Meg Wolitzer richtig gut kann, ist amerikanische Milieus zeichnen. «
Anja Brockert, SWR 2 LESENSWERT
»Meg Wolitzer spürt genau die Details auf, die die feinen Unterschiede ausmachen. «
Katharina Borchardt, SWR 2 LESENSWERT
»Wolitzer gelingt es, das doppelte Tabuthema von weiblichem wie auch feministischem Machtstreben anhand glaubhafter Charaktere zu vermitteln. «
Sonja Eismann, MISSY MAGAZIN
»Die Beziehungen, [ ] sind wunderbar beschrieben und so schafft Meg Wolitzer Charaktere, die wir lieb gewinnen. «
Ariane Wick, HR 2 KULTUR
»Was Wolitzer immer wieder fantastisch gelingt, ist Figuren und Welten zu erschaffen, die real und überzeugend sind. «
Jörg Petzold, FLUX FM
»Mit ihrem eigenen Schreiben zeigt [Meg Wolitzter], dass die Great American Novel keine Männersache ist. «
Jana Volkmann, BUCHKULTUR
»Ihre Bücher sind ruhige, intelligente Langzeitbetrachtungen von Menschen und ihrer Art, sich in der Welt zu bewegen. «
Nina Berendonk, DONNA
»Ein kluger, komplexer Roman darüber, was Feminismus heute sein kann. «
Saskia Stöcker, FREUNDIN
»ein sommerlich leichter Zugang zum Thema Feminismus und was er für Frauen bedeuten kann. «
Christina Traar, KLEINE ZEITUNG
»ein wohltuender Roman, eine Bestätigung für Frauen, die etwas bewegen wollen, dass das der richtige Weg ist. «
Britta Bode, BERLINER MORGENPOST
»[Wolitzer] steuert einen sympathischen, warmherzigen und selbstkritischen Beitrag zur Geschlechterdebatte bei. Lesenswert auch für Männer, die der Titel vielleicht ein wenig abschrecken mag. «
Franziska Trost, KRONEN ZEITUNG
»Die Stärke der amerikanischen Autorin ist es, Zeiten und Welten heraufzubeschwören.
Wolitzer beschreibt Charaktere so, dass man meint, sie wären Freunde. «
Sara Schausberger, FALTER
»Sie hat die große Fähigkeit, auch wenn er nur am Rande auftritt, jeden Menschen als ganzen darzustellen. «
David Eisermann, WDR 3 Mosaik
»Auch wenn es der Titel auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, stellt Das weibliche Prinzip einmal mehr den Beweis an, dass in einem Stück Literatur oft mehr Wahrheit steckt als in der Wirklichkeit. «
Bettina Baltschev, MDR KULTUR
»Wir alten weißen Männer müssen lernen zu verstehen, was da passiert. Und uns darüber freuen, dass die Frauen übernehmen. Nun auch mit diesem Buch«
Ulf Poschardt, LITERARISCHE WELT
»Zum einen ist Das weibliche Prinzip einfach ein sehr guter Roman, zum anderen schreibt Meg Wolitzer hier eben gerade nicht über vorgeblich kleine Themen, sondern stellt die Machtfrage. Feminismus bedeutet, dass Frauen ein faires und gutes Leben wollen. Das wird einem nicht einfach geschenkt. «
Christian Bos, KÖLNER STADT-ANZEIGER
»[das Buch] ist klug durchdacht und komponiert, es wandert in der Zeit, ohne jedoch seine Leserschaft zu verwirren. Es ist eindringlich, ohne aufdringlich zu wirken. «
Heidi Ossenberg, BADISCHE ZEITUNG
»Meg Wolitzer ist in Das weibliche Prinzip wieder witzig, empathisch und frauensolidarisch, dass es einfach nur Spaß macht. «
Barbara Meixner, BUCHMARKT
»Wenn Meg Wolitzer eine Emanzipationsgeschichte erzählt, dann ist das in erster Linie auch glänzende Unterhaltung. «
Meike Schnitzler, BRIGITTE
»Lesen, weil . . . das literarische Frauenpower ist. «
COSMOPOLITAN
»Dieses Buch ist keine simple Erklärung unserer Zeit, es geht um Macht und Emanzipation, um Liebe und Freundschaft und ums Erwachsenwerden. «
Miriam Böndel, EMOTION
»Wolitzer zeichnet ihre Heldinnen mit feinstem feministisch-literarischem Pinselstrich. «
Martina Koch, Glamour
»Ein großartiger Roman über die Schwierigkeiten moderner Frauen, feministische Ideale mit dem Leben und der Liebe in Einklang zu bringen. «
Lisa Goldmann, MADAME
»Ein kluger, komplexer Roman darüber, was Feminismus heute sein kann. «
Günther Keil, PLAYBOY
»Wolitzer hat zwei wesentliche Fähigkeiten: Sie schafft Figuren, denen man gerne folgt, und stellt diese in Konstellationen, aus denen sich viel über den Zustand der Gesellschaft zumindest ihres gebildeten, bürgerlichen Teils ablesen lässt. Das ist deutlich mehr, als die meisten Romane schaffen. «
Harald Ries, WESTFALEN POST
»Der Roman ist unterhaltsam, humorvoll, klug konstruiert und hintergründig, aber vor allem wahrhaftig ohne überheblich zu sein. «
Tanja Ochs, HEILBRONNER STIMME
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.09.2023
Interessante Figuren, die man in ihrer Entwicklung verfolgt und die klassische Rollenbilder aufrühren!
LovelyBooks-Bewertung am 21.12.2022
Anfangs ein wenig zäh, aber im Ganzen unterhaltsam










