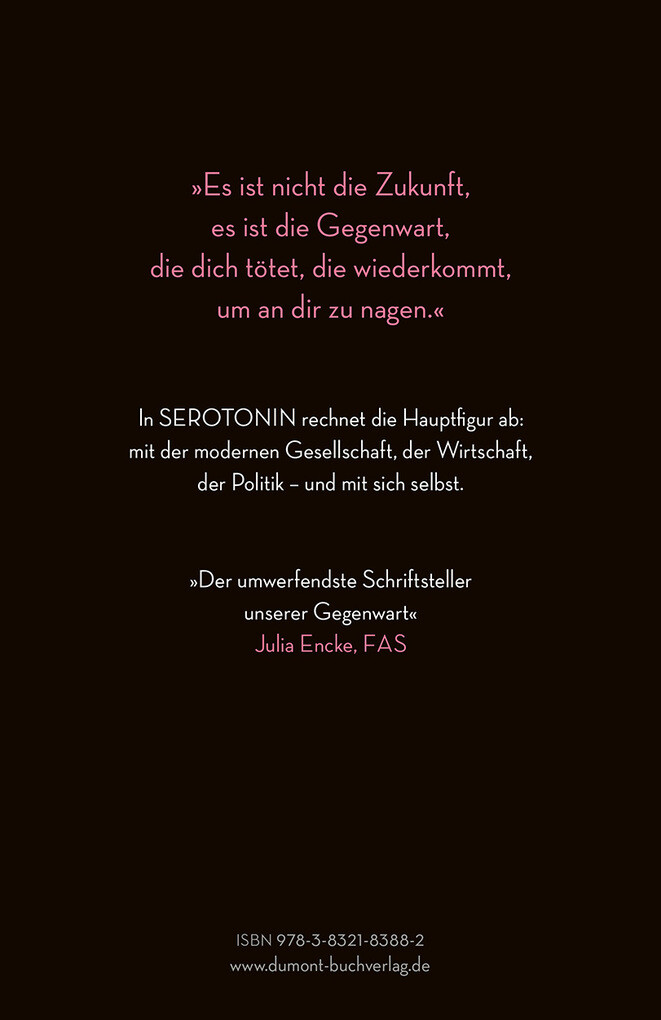Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Als der 46-jährige Protagonist von SEROTONIN, dem neuen Roman des Goncourt-Preisträgers Michel Houellebecq, Bilanz zieht, beschließt er, sich aus seinem Leben zu verabschieden - eine Entscheidung, an der auch das revolutionäre neue Antidepressivum Captorix nichts zu ändern vermag, das ihn in erster Linie seine Libido kostet. Alles löst er auf: Beziehung, Arbeitsverhältnis, Wohnung. Wann hat diese Gegenwart begonnen? In der Erinnerung an die Frauen seines Lebens und im Zusammentreffen mit einem alten Studienfreund, der als Landwirt in einem globalisierten Frankreich ums Überleben kämpft, erkennt er, wann und wo er sich selbst und andere verraten hat.
Noch nie hat Michel Houellebecq so ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben. Zugleich schildert er in SEROTONIN den Kampf und den drohenden Untergang eines klassischen Wirtschaftszweigs in unserer Zeit der Weltmärkte und der gesichtslosen EU-Bürokratie.
»Es ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart, die dich tötet, die wiederkommt, um an dir zu nagen.«
In SEROTONIN rechnet die Hauptfigur ab: mit der modernen Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik - und mit sich selbst.
»Der umwerfendste Schriftsteller unserer Gegenwart«
Julia Encke, F.A.S
Noch nie hat Michel Houellebecq so ernsthaft und voller Emotion über die Liebe geschrieben. Zugleich schildert er in SEROTONIN den Kampf und den drohenden Untergang eines klassischen Wirtschaftszweigs in unserer Zeit der Weltmärkte und der gesichtslosen EU-Bürokratie.
»Es ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart, die dich tötet, die wiederkommt, um an dir zu nagen.«
In SEROTONIN rechnet die Hauptfigur ab: mit der modernen Gesellschaft, der Wirtschaft, der Politik - und mit sich selbst.
»Der umwerfendste Schriftsteller unserer Gegenwart«
Julia Encke, F.A.S
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Januar 2019
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
336
Reihe
Michel Houellebecq
Autor/Autorin
Michel Houellebecq
Übersetzung
Stephan Kleiner
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit Lesebändchen
Gewicht
481 g
Größe (L/B/H)
213/147/30 mm
Sonstiges
Mit Lesebändchen
ISBN
9783832183882
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Tritt ein, lieber Leser, in die Düsternis des Abendlandes, und beginne die Reise ans Ende der Nacht. «
Romain Leick, DER SPIEGEL
»Ein tieftrauriges Buch über die Liebe. «
Mathias Wert, ARD Tagesthemen
»Die Sprache, das darf man nicht vergessen, ist das eigentlich Ereignis bei Michel Houellebecq. «
Julia Encke, FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG
»Wo zum Teufel findet man denn intelligentere Gegenwartsdiagnosen von schmerzhafterer Klarheit und zwingenderer Radikalität als bei Houellebecq? «
Denis Scheck, ARD DRUCKFRISCH
»Ich hab selten zuvor ein Buch gelesen, in dem so eine Dunkelheit herrschte, so eine Verzweiflung und Einsamkeit und ich trotzdem auf jeder Seite schallend lachen musste«
Volker Weidermann, DAS LITERARISCHE QUARTETT
»Warum begeistert mich dieser Autor? Ganz einfach: Weil ich keine intelligenteren Zeitdiagnosen unserer Gesellschaft finde in der Gegenwartsliteratur als bei Michel Houellebecq. «
Denis Scheck, SWR LESENSWERT QUARTETT
»Sprachlich bewegt sich [das Buch] auf einer sehr großen Klaviatur«
Nicola Steiner, SRF LITERATURCLUB
»Ein tieftrauriger Liebesroman«
Jan Wiele, FRANKFUTER ALLGEMEINE ZEITUNG
»Ein tiefes, schönes Buch über die menschliche Existenz. [ ] [Houellebecq] ist ein großer Künstler. «
Mara Delius, DIE LITERARISCHE WELT
»Wow, eine so kluge Gegenwartsanalyse habe ich lange nicht mehr gelesen, dieses Buch macht einen klüger«
Denis Scheck, WDR2 LESEN
»Große Erzählkunst, wenn die Beklemmung, die Scham, die Unfähigkeit zu spüren ist [ ]. Umwerfend erzählt. «
Doris Akrap, TAZ
»Ein Roman, der mehr als Symptom unserer Zeit zu lesen ist denn als Analyse unserer Gegenwart. «
ORF Bestenliste
» Serotonin ist ein zynischer Abgesang auf das Leben westlicher Prägung. Zugleich eine vertrackte Liebeserklärung an eben dieses. «
Katja Gasser, ORF ZIB1
»Literarisch sehr geschickt gemacht [ ]. Die Sprache fängt an zu sprühen [ ]. Und da Entsteht eine Spannung, die sehr verstörend ist. «
Christine Lötscher, 3SAT KULTURZEIT
»Houellebecq ist ein grosser Theoretiker der Liebe er versteht sich meisterhaft darauf, Männer zu beschreiben, die ihrer vollkommen unfähig sind. «
Tobias Sedlmaier, NZZ am Sonntag
»Horror-Satire über das Ende der Welt«
Iris Radisch, DIE ZEIT
»[Man] kann Serotonin auch als Hymne an die romantische Liebe lesen. «
Sabine Glaubitz, DPA
»Am Ende bleibt von der vielbeschworenen Freiheit des Westens nicht mehr übrig als eine kleine, weiße, ovale, teilbare Tablette . «
Mathias Dusini, FALTER
»Houellebecq [zeigt], was er kann, Krimi, Groteske, Liebesroman, Sozialreportage, alles wird angespielt und zitiert. «
Alex Rühle, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
»Und vielleicht gehört es darum zum Besten seiner quecksilbrigen Literatur, dass für sie gilt: Was immer man über sie sagt, das Gegenteil trifft genauso zu. «
Roman Bucheli, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
»Es ist ein Buch, das einen neuen Houellebecq zeigt, einen, der an die Möglichkeit des Glücks zumindest glaubt. «
Stefan Gmünder, DER STANDARD
»Dieser außergewöhnliche Stil, der zwischen schreiender Komik und abgrundtiefer Melancholie wechselt, macht auch dieses Buch zu einem echten Houellebecq . «
Dirk Fuhrig, DLF Kultur
»Ein unglaublich guter Autor«
Jörg Magenau, RBB KULTUR
»Er ist in der Tat literarisch herausragend. «
Andreas Isenschmid, DLF KULTUR
»Sprachlich auf der Höhe seiner Kunst. «
Dirk Fuhrig, WDR 3 Mosaik
»Umwerfend ist Michel Houellebecq aber zweifellos immer dann, wenn ihn nicht der visionäre (und manchmal auch moralische) Furor packt und er sich auf thematischen Nebenschauplätzen bewegt. «
Jochen Kürten, DEUTSCHE WELLE
»Serotonin ist Houellebecqs womöglich bester Roman. [Er ist] alles andere als trübsinnig. Ja, zuweilen ist die Lektüre ein schwarzer, sarkastischer Spaß. «
Martin Oehlen, KÖLNER STADT-ANZEIGER
»Wir haben gelacht und uns entsetzt. Aber in dem Moment, in dem Michel Houellebecq uns mit unserem lustvollen Kummer allein lässt, wir dem schauerlich-schönen Klagegesang des Erzählers entkommen sind, fassen wir eigene Gedanken. «
Alexander Solloch, NDR Kultur
»Am Ende dieses urkomischen und zugleich tieftraurigen Romans hält Houellebecq ein regelrechtes Plädoyer für die Liebe, die in der heutigen Zeit durch die Illusion von individueller Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten zum Scheitern verurteilt ist. «
Welf Grombacher, MÄRKISCHE ODERZEITUNG
»[Houellebecq ist] ein glänzender Autor und ein gnadenloser Chronist unserer Zeit. Es gibt nicht viele von seiner analytischen Schärfe und seiner Rücksichtslosigkeit. «
Bettina Schulte, BADISCHE ZEITUNG
»Sich über Houellebecq und Serotonin wundern: ja. Sich ärgern: unbedingt! Aber lesen. «
Peter Pisa, KURIER
»Houellebecq hat sich neu erfunden. «
Felix Schneider, SRF2 Kultur
»Kann ich nicht einfach so lesen, muss man zelebrieren. «
Harald Schmidt
» Serotonin ist Houellebeqcs bisher persönlichstes Buch. Aus einem Guss. Ein Wurf. «
Peter Burri, BASLER ZEITUNG
»Wer keine Fragen ans Leben richten will, sollte besser die Finger von diesem Roman lassen. Alle andere greifen bitte zu. «
Lothar Schröder, RHEINISCHE POST
»Seine Traurigkeit ist unser aller Traurigkeit. «
Knut Cordsen, BR
»Der Provokateur Houellebecq [zeigt] sich von seiner einfühlsamen, zarten und verletzlichen Seite. Von einer Intensität, die tieftraurig macht und dieses Buch so besonders. «
Franziska Trost, KRONEN ZEITUNG
»Sein Roman ist ein Meisterwerk, der Schmutz in große Literatur wandelt. «
Susanne Zobl, NEWS
» Serotonin steht als Prosakraftakt ganz für sich selbst, vielleicht wie noch kein Houellebecq-Roman zuvor. «
Wolfgang Paterno, PROFIL
»Eine klare Leseempfehlung«
Thomas Andre, HAMBURGER ABENDBLATT
»Es geht um die größte Gefahr unserer Gesellschaft: Einsamkeit und die einzige Rettung: Liebe. «
Marie Kaiser, RBB radioeins
»Ein dreiviertel Jahrhundert nach Albert Camus erschafft Michel Houellebecq in Serotonin einen neuen Fremden. «
Tilla Fuchs, SR 2 KulturRadio
»eine großartige stilistische Neuerfindung«
Katharina Hirschmann, Manuel Chemineau, WIENER ZEITUNG
»Der ideale Schriftsteller des postideologischen Zeitalters«
Anton Thuswaldner, DIE FURCHE
Romain Leick, DER SPIEGEL
»Ein tieftrauriges Buch über die Liebe. «
Mathias Wert, ARD Tagesthemen
»Die Sprache, das darf man nicht vergessen, ist das eigentlich Ereignis bei Michel Houellebecq. «
Julia Encke, FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG
»Wo zum Teufel findet man denn intelligentere Gegenwartsdiagnosen von schmerzhafterer Klarheit und zwingenderer Radikalität als bei Houellebecq? «
Denis Scheck, ARD DRUCKFRISCH
»Ich hab selten zuvor ein Buch gelesen, in dem so eine Dunkelheit herrschte, so eine Verzweiflung und Einsamkeit und ich trotzdem auf jeder Seite schallend lachen musste«
Volker Weidermann, DAS LITERARISCHE QUARTETT
»Warum begeistert mich dieser Autor? Ganz einfach: Weil ich keine intelligenteren Zeitdiagnosen unserer Gesellschaft finde in der Gegenwartsliteratur als bei Michel Houellebecq. «
Denis Scheck, SWR LESENSWERT QUARTETT
»Sprachlich bewegt sich [das Buch] auf einer sehr großen Klaviatur«
Nicola Steiner, SRF LITERATURCLUB
»Ein tieftrauriger Liebesroman«
Jan Wiele, FRANKFUTER ALLGEMEINE ZEITUNG
»Ein tiefes, schönes Buch über die menschliche Existenz. [ ] [Houellebecq] ist ein großer Künstler. «
Mara Delius, DIE LITERARISCHE WELT
»Wow, eine so kluge Gegenwartsanalyse habe ich lange nicht mehr gelesen, dieses Buch macht einen klüger«
Denis Scheck, WDR2 LESEN
»Große Erzählkunst, wenn die Beklemmung, die Scham, die Unfähigkeit zu spüren ist [ ]. Umwerfend erzählt. «
Doris Akrap, TAZ
»Ein Roman, der mehr als Symptom unserer Zeit zu lesen ist denn als Analyse unserer Gegenwart. «
ORF Bestenliste
» Serotonin ist ein zynischer Abgesang auf das Leben westlicher Prägung. Zugleich eine vertrackte Liebeserklärung an eben dieses. «
Katja Gasser, ORF ZIB1
»Literarisch sehr geschickt gemacht [ ]. Die Sprache fängt an zu sprühen [ ]. Und da Entsteht eine Spannung, die sehr verstörend ist. «
Christine Lötscher, 3SAT KULTURZEIT
»Houellebecq ist ein grosser Theoretiker der Liebe er versteht sich meisterhaft darauf, Männer zu beschreiben, die ihrer vollkommen unfähig sind. «
Tobias Sedlmaier, NZZ am Sonntag
»Horror-Satire über das Ende der Welt«
Iris Radisch, DIE ZEIT
»[Man] kann Serotonin auch als Hymne an die romantische Liebe lesen. «
Sabine Glaubitz, DPA
»Am Ende bleibt von der vielbeschworenen Freiheit des Westens nicht mehr übrig als eine kleine, weiße, ovale, teilbare Tablette . «
Mathias Dusini, FALTER
»Houellebecq [zeigt], was er kann, Krimi, Groteske, Liebesroman, Sozialreportage, alles wird angespielt und zitiert. «
Alex Rühle, SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
»Und vielleicht gehört es darum zum Besten seiner quecksilbrigen Literatur, dass für sie gilt: Was immer man über sie sagt, das Gegenteil trifft genauso zu. «
Roman Bucheli, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
»Es ist ein Buch, das einen neuen Houellebecq zeigt, einen, der an die Möglichkeit des Glücks zumindest glaubt. «
Stefan Gmünder, DER STANDARD
»Dieser außergewöhnliche Stil, der zwischen schreiender Komik und abgrundtiefer Melancholie wechselt, macht auch dieses Buch zu einem echten Houellebecq . «
Dirk Fuhrig, DLF Kultur
»Ein unglaublich guter Autor«
Jörg Magenau, RBB KULTUR
»Er ist in der Tat literarisch herausragend. «
Andreas Isenschmid, DLF KULTUR
»Sprachlich auf der Höhe seiner Kunst. «
Dirk Fuhrig, WDR 3 Mosaik
»Umwerfend ist Michel Houellebecq aber zweifellos immer dann, wenn ihn nicht der visionäre (und manchmal auch moralische) Furor packt und er sich auf thematischen Nebenschauplätzen bewegt. «
Jochen Kürten, DEUTSCHE WELLE
»Serotonin ist Houellebecqs womöglich bester Roman. [Er ist] alles andere als trübsinnig. Ja, zuweilen ist die Lektüre ein schwarzer, sarkastischer Spaß. «
Martin Oehlen, KÖLNER STADT-ANZEIGER
»Wir haben gelacht und uns entsetzt. Aber in dem Moment, in dem Michel Houellebecq uns mit unserem lustvollen Kummer allein lässt, wir dem schauerlich-schönen Klagegesang des Erzählers entkommen sind, fassen wir eigene Gedanken. «
Alexander Solloch, NDR Kultur
»Am Ende dieses urkomischen und zugleich tieftraurigen Romans hält Houellebecq ein regelrechtes Plädoyer für die Liebe, die in der heutigen Zeit durch die Illusion von individueller Freiheit und unbegrenzten Möglichkeiten zum Scheitern verurteilt ist. «
Welf Grombacher, MÄRKISCHE ODERZEITUNG
»[Houellebecq ist] ein glänzender Autor und ein gnadenloser Chronist unserer Zeit. Es gibt nicht viele von seiner analytischen Schärfe und seiner Rücksichtslosigkeit. «
Bettina Schulte, BADISCHE ZEITUNG
»Sich über Houellebecq und Serotonin wundern: ja. Sich ärgern: unbedingt! Aber lesen. «
Peter Pisa, KURIER
»Houellebecq hat sich neu erfunden. «
Felix Schneider, SRF2 Kultur
»Kann ich nicht einfach so lesen, muss man zelebrieren. «
Harald Schmidt
» Serotonin ist Houellebeqcs bisher persönlichstes Buch. Aus einem Guss. Ein Wurf. «
Peter Burri, BASLER ZEITUNG
»Wer keine Fragen ans Leben richten will, sollte besser die Finger von diesem Roman lassen. Alle andere greifen bitte zu. «
Lothar Schröder, RHEINISCHE POST
»Seine Traurigkeit ist unser aller Traurigkeit. «
Knut Cordsen, BR
»Der Provokateur Houellebecq [zeigt] sich von seiner einfühlsamen, zarten und verletzlichen Seite. Von einer Intensität, die tieftraurig macht und dieses Buch so besonders. «
Franziska Trost, KRONEN ZEITUNG
»Sein Roman ist ein Meisterwerk, der Schmutz in große Literatur wandelt. «
Susanne Zobl, NEWS
» Serotonin steht als Prosakraftakt ganz für sich selbst, vielleicht wie noch kein Houellebecq-Roman zuvor. «
Wolfgang Paterno, PROFIL
»Eine klare Leseempfehlung«
Thomas Andre, HAMBURGER ABENDBLATT
»Es geht um die größte Gefahr unserer Gesellschaft: Einsamkeit und die einzige Rettung: Liebe. «
Marie Kaiser, RBB radioeins
»Ein dreiviertel Jahrhundert nach Albert Camus erschafft Michel Houellebecq in Serotonin einen neuen Fremden. «
Tilla Fuchs, SR 2 KulturRadio
»eine großartige stilistische Neuerfindung«
Katharina Hirschmann, Manuel Chemineau, WIENER ZEITUNG
»Der ideale Schriftsteller des postideologischen Zeitalters«
Anton Thuswaldner, DIE FURCHE
 Besprechung vom 05.01.2019
Besprechung vom 05.01.2019
Ganz Paris träumt von der Liebe, und einer fällt
Da helfen keine Pillen: Michel Houellebecqs Roman "Serotonin" richtet den depressiven Dandy endgültig zugrunde - mit starker Moral.
Was ist diesem Buch nicht alles an Gerüchten vorausgeeilt: Der prophetische Roman über die "Gelbwesten" wäre es. Allerdings kommen sie gar nicht darin vor. Eine "Phänomenologie der Fellatio" sah darin ein französischer Kritiker. Im Vergleich zu früheren Werken Houellebecqs ist es eine eher kurze Phänomenologie; irreführend ist die Aussage aber vor allem, weil man auf der vierten Seite von "Serotonin" schon erfährt, dass der Protagonist impotent und nicht mehr im Geringsten an Sex interessiert ist. Ebendarum geht es in diesem Roman, an diesem für eine Houellebecq-Figur durchaus überraschenden Haken hängt seine starke moralische Pointe. Und schließlich erfuhr man aus der "Zeit", Michel Houellebecq verkläre in seinem neuen Roman die französische Provinz und verdamme die Europäische Union. Das tut, wenn überhaupt, der Protagonist des Buchs, und dieser ist, vielleicht nicht ganz unwichtig zu erwähnen, ein Psychopath.
Wenn "Serotonin" nun am Montag in den deutschen Buchhandel kommt, wird sich die Leserschaft davon überzeugen können, dass es sich dabei kaum um eine politische Satire handelt, sosehr das viele vom Nachfolgebuch von "Unterwerfung" vielleicht erwartet und erhofft haben, sondern um einen tieftraurigen Liebesroman. Wobei er satirische Züge durchaus aufweist. Die Hauptfigur ist auf Seite 291 kurz davor, ein vierjähriges Kind mit einem Präzisionsgewehr zu erschießen, um dessen Mutter ganz für sich zu haben. Da darf man durchaus auf die Idee kommen, Übertreibung zu wittern. "Übertreibung" wäre vielleicht sogar ein Alternativtitel für diesen Roman, dessen Schlüsselsätze lauten: "Muss man wirklich so deutlich werden? Offenbar ja."
Zur Übertreibung gebracht, überdeutlich ausgestellt wird darin der endgültige Verfall des Houellebecqschen Dandys, des dekadenten westlichen Mannes in der Moderne. Ob aus dem "Dangling Man" im Sinne Saul Bellows ein "Falling Man" im Sinne Don Drapers oder Don DeLillos wird, bleibt am Ende offen, aber Florent-Claude Labrouste, so heißt hier der Übeltäter, berechnet zumindest schon die Dauer des Sturzes aus dem Fenster seines Pariser Wohnturms. Keine schöne Vorstellung, bemerkt auch er, aber "mit ein paar Gläsern Calvados im Kopf" vielleicht kaum noch spürbar und trotz des furchtbaren Aufpralls verlockend durch die "Gnade einer seligen Ohnmacht". Wie kommt es dazu?
Dazu braucht es eine "Verkettung von Umständen", wie der Ich-Erzähler lapidar sagt, man könnte es auch Lebensgeschichte nennen. Denn nichts weniger als die Lebensgeschichte von diesem Florent-Claude liefert uns Houellebecq, wenngleich nicht ganz von vorn erzählt.
Wir begegnen dem Mann zuerst an einer spanischen Landstraße, unterwegs in den Urlaub. An einer Tankstelle trifft er zwei hübsche Frauen Mitte zwanzig, deren Reifen Luft fehlt, und es blitzt die aus Houellebecq-Romanen gewohnte schnelle Erfüllung wilder Phantasien auf, die einmal als romantische Komödie, einmal als Pornofilm ausgemalt wird - doch dann heißt es: "Wir befanden uns in der Realität, und darum fuhr ich nach Hause."
In dieser Realität lebt Florent, ein Endvierziger, mit einer zwanzig Jahre jüngeren Japanerin zusammen, die er als bloße Konkubine bezeichnet und deren Gegenwart er kaum erträgt, auch wenn er anderes an ihr schätzt ("Man hatte ständig die freie Wahl zwischen ihren drei Löchern, welche Frau kann das schon von sich sagen?"). Als er pornographische Videos von Yuzu entdeckt, darunter eines mit Hunden, überlegt er kurz, die Frau zu töten, entscheidet sich dann aber anders, weil er noch ein bisschen die Freiheit genießen möchte, im Supermarkt zwischen vierzehn Sorten Hummus zu wählen.
Eines Nachts stößt Florent beim Fernsehen auf die Information, dass in Frankreich jährlich zwölftausend Menschen von einem Tag auf den anderen "vorsätzlich verschwinden", und beschließt, einer von ihnen zu werden. Die Kündigung von Wohnung (ohne Yuzu zu informieren) und Arbeitsstelle geht schneller als die Suche nach einem Hotel, in dem man noch rauchen darf. Er findet es aber doch in einem Pariser Arrondissement, das keine Begegnung mit Yuzu erwarten lässt, und beginnt ein Singledasein, das zumindest vorübergehende Zufriedenheit, wenn auch kein Glück mehr verheißt.
Wie nebenbei zelebriert Houellebecq bei dessen Beschreibung ein wenig alte Pariser Lebensart und Normalität, würdigt ausgiebig Straßen, Metrostationen und Gastronomie, vielleicht ein Trostpflaster für eine Stadt, die bei und nach Erscheinen seines letzten Romans vom Terrorismus erschüttert wurde und für viele noch ist.
Aber einfache Freuden reichen Florent nicht weit, und glücklich, das verrät er früh, wird er nie wieder werden. Das titelgebende Glückshormon Serotonin kann dieser Mann nur noch mit einem neuartigen Antidepressivum erzeugen, an seinem zutiefst sarkastischen Charakter scheint es aber nichts zu ändern. Houellebecq legt Florent an Rassismus, Sexismus und Misanthropie in den Mund, was er eben kann, und zwar oft so platt, dass man es kaum noch als belustigende Provokation nehmen mag ("Frauen sind Schlampen, wenn man so will, man kann es so betrachten, aber das Arbeitsleben ist eine noch viel gehörigere Schlampe, die einem dabei nicht einmal Lust bereitet"). Das ist für einen Houellebecq-Roman nicht überraschend - was hingegen sehr überrascht, sind die Einsicht des Protagonisten in die Verpfuschtheit seines Lebens und die Reue, die er im Verlauf der Erzählung an den Tag legt. Man kann diese Läuterung vielleicht auf den durch das Medikament erzeugten Verlust des Sexualtriebs zurückführen - jedenfalls beginnt Florent, Erinnerungsorte vergangener Beziehungen sowie früher für ihn bedeutende Menschen aufzusuchen. Er gelangt dabei langsam, aber sicher zu der Überzeugung, alles falsch gemacht und die Liebe seines Lebens, eine damals erst neunzehnjährige, vor Optimismus und Schwärmerei für ihn strahlende Camille, fahrlässig verspielt zu haben.
So kommt es, in einem Roman, der zunächst eher aus einer Reihung der besagten Derbheiten und Provokationen zu besehen scheint, schließlich zu für Houellebecq sehr untypischen Sätzen wie: "Die Außenwelt war hart, ohne Mitleid mit den Schwachen, und die Liebe blieb das Einzige, woran man vielleicht noch glauben konnte." Und dann, man glaubt es kaum, durchzucken sogar "seltsame kleine Stöße" Florents Körper, nur zum Weinen reicht es nicht, denn "offenbar hatte ich keine Tränen mehr".
Angesichts von Weihnachtstagen und Jahreswechsel, die viele Depressive in den Selbstmord treiben, rät Florents Arzt diesem, für diese Zeit entweder ins Kloster oder nach Thailand zu fahren, aber beide Vorstellungen üben auf den Erzähler keinerlei Reiz mehr aus. Die Stelle wirkt wie ein ironisches Anknüpfen an frühere Houellebecq-Romane wie "Plattform" und "Unterwerfung": Weder der Sextourismus noch die Wendung zur (Pseudo-)Religiosität birgt hier noch irgendeine Rettung.
Verstärkt wird die Liebesdepression noch durch das Gefühl beruflichen Scheiterns. Hier kommt ein bisschen das Politische ins Spiel. Florent ist Agrarökonom und war Berater der französischen Regierung, er hat früher auch für den Megakonzern Monsanto gearbeitet, mithin die Globalisierung vorangetrieben. In der normannischen Provinz bei einer seiner Erinnerungsfahrten sieht er am Beispiel eines Studienfreunds, der als Landwirt ums Überleben kämpft, deren brutale Auswirkungen, die er selbst mitverschuldet hat. Jener Aymeric, letzter männlicher Spross eines französischen Adelsgeschlechts, der mit seiner ehrlichen Arbeit weniger verdient als sein Vater mit Vermögensverwaltung, schießt sich bei einer Protest-Blockade der normannischen Milchbauern mit dem Gewehr in den Kopf und löst damit eine Katastrophe aus. In dieser Nebengeschichte weitet sich das persönliche Scheitern Florents zu einem der Gemeinschaft, der Nation aus, und, wie es bei Houellebecq, der im vergangenen Herbst den Spengler-Preis erhielt, auch gern hießt: zu einem des Abendlandes.
Es müsse nicht von dessen Untergang, sondern Suizid die Rede sein, sagte der Autor da, und "Serotonin" scheint dies extrem verdichtet zeigen zu wollen. Für den Leser ist die Erzählerfigur eine Herausforderung: weil sie changiert zwischen bodenständig-glaubhaften Zügen und einer totalen Karikatur, insbesondere einer Karikatur des französischen Gourmets, die pausenlos Grand Marnier oder Kuttelwurst zu sich nimmt, manchmal gleichzeitig. Die ständig Hass und Zynismus versprüht. Die dem Leser wie mit erhobenem Zeigefinger zuzurufen scheint: Werde nicht so wie ich! Die sich am Ende gar mit Christus vergleicht und dann fragt: "Muss man wirklich so deutlich werden?" Und mit dieser Karikatur sollen wir nun also Mitleid haben? So unwahrscheinlich das klingt: Wer die letzten hundert Seiten des Romans schafft, ohne dass sich dieses Gefühl einstellt, der muss eine kalte Houellebecq-Figur sein.
JAN WIELE
Michel Houellebecq:
"Serotonin". Roman.
Aus dem Französischen von Stephan Kleiner. DuMont Buchverlag, Köln 2019. 336 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 02.02.2024
weise, ordinär und angenehm politisch inkorrekt
LovelyBooks-Bewertung am 05.10.2023
Misogyner Schund, schwer zu lesen. Einfach nur schlecht. Schade.