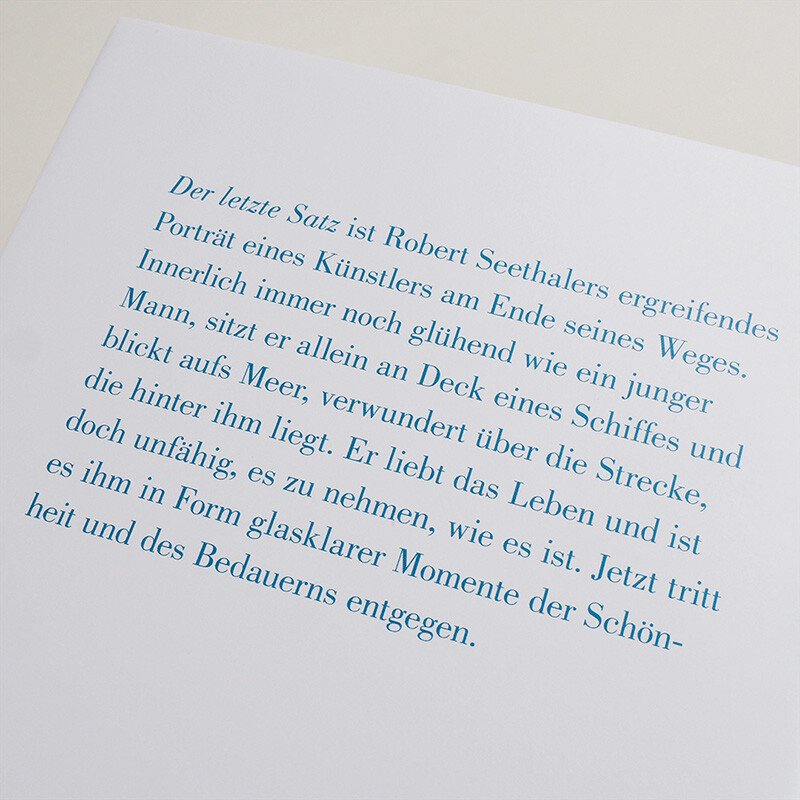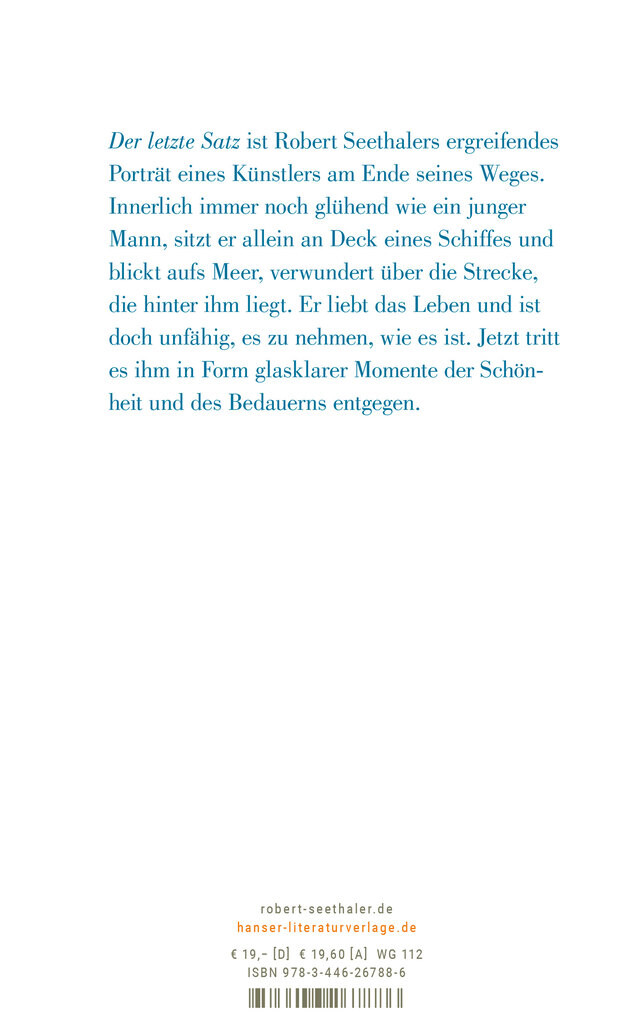Zustellung: Sa, 18.01. - Do, 23.01.25
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
"Es geht mal wieder um alles Wie habe ich gelebt? Was habe ich verpasst? Kein Buch über das Scheitern, sondern über das was bleibt!" Dörte Hansen, Literarisches Quartett
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.
"Der letzte Satz" ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter, dem die Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des Bedauerns entgegentritt.
An Deck eines Schiffes auf dem Weg von New York nach Europa sitzt Gustav Mahler. Er ist berühmt, der größte Musiker der Welt, doch sein Körper schmerzt, hat immer schon geschmerzt. Während ihn der Schiffsjunge sanft, aber resolut umsorgt, denkt er zurück an die letzten Jahre, die Sommer in den Bergen, den Tod seiner Tochter Maria, die er manchmal noch zu sehen meint. An Anna, die andere Tochter, die gerade unten beim Frühstück sitzt, und an Alma, die Liebe seines Lebens, die ihn verrückt macht und die er längst verloren hat. Es ist seine letzte Reise.
"Der letzte Satz" ist das ergreifende Porträt eines Künstlers als müde gewordener Arbeiter, dem die Vergangenheit in Form glasklarer Momente der Schönheit und des Bedauerns entgegentritt.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
03. August 2020
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
125
Autor/Autorin
Robert Seethaler
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
226 g
Größe (L/B/H)
208/131/20 mm
ISBN
9783446267886
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Man wird mit vielen tollen Sätzen belohnt. Ein sehr unterhaltsamer Roman. Jan Ehlert, NDR Kultur, 30. 10. 20
"Ein schönes, melancholisches, einfühlsames, kleines wunderschönes Herbstbuch." Elke Heidenreich, WDR4, 04. 10. 20
"Bis zum letzten Satz ein fantastisches Buch." Harald Welzer, Die Tageszeitung, 08. 09. 20
"Es hat mich tief bewegt." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 01. 09. 20
"Für mich ist das eine feine, kleine Poetikvorlesung von Robert Seethaler über die Art und Weise wie er schreibt. Schon die Schmalheit des Buches ist die Bescheidenheitsgeste Es ist ein Buch, das innerhalb des Werkes von Robert Seethaler ganz schlüssig ist, in der Art und Weise, wie er Figuren erzählt." Insa Wilke, SWR2 lesenswert Quartett, 22. 09. 20
"Es geht mal wieder um alles Wie habe ich gelebt? Was habe ich verpasst? Kein Buch über das Scheitern, sondern über das was bleibt!" Dörte Hansen, Literarisches Quartett, 28. 08. 20
"Eine berührende Biografie über den Menschen hinter dem Weltstar, der einem in der für Seethaler typischen, lakonisch, knappen Erzählweise auf seiner letzten Reise ganz nah kommt." Terry Albrecht, WDR5 Bücher, 14. 08. 20
"Es ist faszinierend, wie dicht, wie intensiv Robert Seethaler vom Leben Mahlers zu erzählen weiß. Als würde man neben ihm sitzen und ihn erzählen hören." Christine Westermann, WDR2, 23. 08. 20
"Sehr stimmungsvoll Eine kleine, gelungene Romanstudie über die Schönheit der Kunst und die Vergänglichkeit unseres Lebens." Mario Scalla, HR2 Kultur, 17. 08. 20
"Elegisch, poetisch und dabei ganz und gar unsentimental. Ein Geschenk von Lektüre." Barbara Weitzel, Welt am Sonntag, 16. 08. 20
"Ein meisterliches Stück über den Musiker Gustav Mahler. sprachlich und atmosphärisch hervorragend komponiert. ." Luzia Stettler, SRF, 04. 08. 20
"Es ist die große Kunst der Verdichtung, die Robert Seethaler wie kaum ein anderer Schriftsteller beherrscht und die diesen schmalen Roman zu einem wundervollen Meisterstück des Abschieds macht." Annemarie Stoltenberg, NDR, 04. 08. 20
"Seine Sprache ist besonders. Mit schnörkellosen Sätzen schält Seethaler alles Beiwerk ab, bis der Kern offenliegt. Das, was vom Leben eben so übrig bleibt, wenn man mit Abstand draufguckt." Elisa von Hof, Spiegel Online, 31. 07. 20
"Gustav Mahlers existentielle Situation erfasst der schmale Roman mit der für Seethaler eigentümlichen Prägnanz, Kürze und Kunst der Verdichtung." Alexander Kosenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01. 08. 20
"Robert Seethaler beschreibt das große Kunststück, das einem das Leben abverlangt: Man lebt nach vorn, die Gegenwart erscheint oft peinigend und die Zukunft düster. In der Rückschau aber begreift man überrascht, wieviele schöne Momente es doch auch hatte. Und man beginnt zu bedauern, sie nicht intensiver gelebt zu haben. Zu trauern über sich selbst. Christine Westermann und Andreas Wallentin, WDR5 Bücher, 11. 07. 20
"Der neue Roman erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, 'Ein ganzes Leben' und 'Das Feld', zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod . . . Ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 07. 20
"Ein schönes, melancholisches, einfühlsames, kleines wunderschönes Herbstbuch." Elke Heidenreich, WDR4, 04. 10. 20
"Bis zum letzten Satz ein fantastisches Buch." Harald Welzer, Die Tageszeitung, 08. 09. 20
"Es hat mich tief bewegt." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 01. 09. 20
"Für mich ist das eine feine, kleine Poetikvorlesung von Robert Seethaler über die Art und Weise wie er schreibt. Schon die Schmalheit des Buches ist die Bescheidenheitsgeste Es ist ein Buch, das innerhalb des Werkes von Robert Seethaler ganz schlüssig ist, in der Art und Weise, wie er Figuren erzählt." Insa Wilke, SWR2 lesenswert Quartett, 22. 09. 20
"Es geht mal wieder um alles Wie habe ich gelebt? Was habe ich verpasst? Kein Buch über das Scheitern, sondern über das was bleibt!" Dörte Hansen, Literarisches Quartett, 28. 08. 20
"Eine berührende Biografie über den Menschen hinter dem Weltstar, der einem in der für Seethaler typischen, lakonisch, knappen Erzählweise auf seiner letzten Reise ganz nah kommt." Terry Albrecht, WDR5 Bücher, 14. 08. 20
"Es ist faszinierend, wie dicht, wie intensiv Robert Seethaler vom Leben Mahlers zu erzählen weiß. Als würde man neben ihm sitzen und ihn erzählen hören." Christine Westermann, WDR2, 23. 08. 20
"Sehr stimmungsvoll Eine kleine, gelungene Romanstudie über die Schönheit der Kunst und die Vergänglichkeit unseres Lebens." Mario Scalla, HR2 Kultur, 17. 08. 20
"Elegisch, poetisch und dabei ganz und gar unsentimental. Ein Geschenk von Lektüre." Barbara Weitzel, Welt am Sonntag, 16. 08. 20
"Ein meisterliches Stück über den Musiker Gustav Mahler. sprachlich und atmosphärisch hervorragend komponiert. ." Luzia Stettler, SRF, 04. 08. 20
"Es ist die große Kunst der Verdichtung, die Robert Seethaler wie kaum ein anderer Schriftsteller beherrscht und die diesen schmalen Roman zu einem wundervollen Meisterstück des Abschieds macht." Annemarie Stoltenberg, NDR, 04. 08. 20
"Seine Sprache ist besonders. Mit schnörkellosen Sätzen schält Seethaler alles Beiwerk ab, bis der Kern offenliegt. Das, was vom Leben eben so übrig bleibt, wenn man mit Abstand draufguckt." Elisa von Hof, Spiegel Online, 31. 07. 20
"Gustav Mahlers existentielle Situation erfasst der schmale Roman mit der für Seethaler eigentümlichen Prägnanz, Kürze und Kunst der Verdichtung." Alexander Kosenina, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 01. 08. 20
"Robert Seethaler beschreibt das große Kunststück, das einem das Leben abverlangt: Man lebt nach vorn, die Gegenwart erscheint oft peinigend und die Zukunft düster. In der Rückschau aber begreift man überrascht, wieviele schöne Momente es doch auch hatte. Und man beginnt zu bedauern, sie nicht intensiver gelebt zu haben. Zu trauern über sich selbst. Christine Westermann und Andreas Wallentin, WDR5 Bücher, 11. 07. 20
"Der neue Roman erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, 'Ein ganzes Leben' und 'Das Feld', zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod . . . Ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. 07. 20
 Besprechung vom 11.07.2020
Besprechung vom 11.07.2020
Von Lust und List beim Erzählen
Herbst-Auslese: Kurze Bücher verheißen diesmal die längste Freude.
Von Andreas Platthaus
Was wird bleiben vom kommenden Bücherherbst? Normalerweise wäre das einzige Kriterium zur Beantwortung dieser Frage ein Vorab-Blick in die interessantesten Bücher der Saison - um Vorfreude zu wecken auf deren Lektüre. Diesmal aber kann man schon ziemlich sicher sagen, dass wir uns eher an die Frankfurter Buchmesse erinnern werden als an einzelne Bücher. Und zwar egal, ob sie nun wirklich durchgeführt werden wird oder nicht. Entfällt sie doch noch - und immer mehr spricht dafür: die weltweite Entwicklung der Corona-Pandemie, die Verschiebung des eigentlichen Gastland-Auftritts von Kanada aufs kommende Jahr oder die wachsende Zahl von Verlagsverzichtserklärungen auf Messeteilnahme, selbst von in Frankfurt angesiedelten Häusern wie etwa Schöffling -, wird die Peinlichkeit des Versuchs der Durchführung in Erinnerung bleiben; findet sie aber statt, wird es die Peinlichkeit der tatsächlichen Durchführung sein, die nichts mit dem zu tun haben kann, wofür man die Buchmesse bislang geschätzt hat. Dafür mit Einlasszählungen, Abstandsmessungen, Temperaturkontrollen und Mundschutzjustierungen. Zeit, um das zu beachten, um was es gehen sollte, die Bücher, wird da kaum bleiben.
So gesehen darf man es günstig nennen, dass einige der vielversprechendsten Bücher aus den Herbstprogrammen der Verlage kurz geraten sind - so kurz, dass ihre Lektüre jeweils nicht mehr als ein paar Stunden erfordert. Natürlich ist keines von ihnen auf die aktuelle Situation hin geschrieben worden, aber man kann sich vorstellen, dass die Verlage diese Lust ihrer Autoren zur Kürze nachträglich gern gesehen haben. Entgegen anfänglichen Erwartungen sind ja nicht dicke Klassiker der Weltliteratur zu Corona-Gewinnlern geworden - außer Kinder- und Jugendbüchern, mit deren Erwerb die Eltern für Beschäftigung ihres ans Haus gebundenen Nachwuchses sorgen wollten, gab es dem Vernehmen nach überhaupt keine Gewinner auf dem Buchmarkt. Die Branche darbt, und da verspricht kurze Belletristik schon deshalb mehr Abhilfe als dicke Wälzer, weil man für eine Neuerscheinung von nur 128 Seiten Umfang problemlos einen Preis von neunzehn Euro verlangen kann, für ein sechsmal längeres, nämlich achthundert Seiten bietendes Buch wie Flauberts "Lehrjahre der Männlichkeit" (so wird dessen Roman "L'Éducation sentimentale" in der am 21. September bei Hanser erscheinenden Neuübersetzung von Elisabeth Edl heißen) aber nicht sechsmal so viel, sondern nur das Doppelte, nämlich 38 Euro. Und das ist gar nicht einmal schlecht, wenn man bedenkt, dass Ulrike Draesners "Schwitters" (Penguin, 24. August) mit seinen immerhin fast fünfhundert Seiten nur 25 Euro kosten soll. Dabei ist dieses Buch mit dem eben genannten 128-Seiten-Werk thematisch eng verwandt: Beides sind nämlich virtuos erzählte Romane über berühmte Künstler.
Dem dünnen liest man das im Gegensatz zu "Schwitters" nicht sogleich am Titel ab. Es heißt "Der letzte Satz", und das verrät noch nicht, dass es darin um Gustav Mahler geht. Hier ist aber ohnehin der Verfasser werbewirksamer als das Sujet. Es handelt sich um den neuen Roman von Robert Seethaler, also einen garantierten Bestseller. Er kommt Anfang August bei Hanser Berlin heraus und erweitert die letzten beiden Erfolgsbücher von Seethaler, "Ein ganzes Leben" und "Das Feld", zu einer Trilogie des Triumphs der Literatur über den Tod. Nur dass diesmal keine fiktionalen Figuren im Mittelpunkt stehen, sondern mit Mahler eine der schillerndsten Künstlerpersönlichkeiten überhaupt - im maßlosen Anspruch seines Komponierens und im haltlosen Debakel seiner Ehe. Seethaler lässt uns Mahlers innerem Zwiespalt auf dessen letzter Überfahrt von Amerika nach Europa lauschen, im Frühjahr 1911, kurz vor dem Herztod im Alter von nur fünfzig Jahren. Das Wissen um dieses Ende prägt die Lektüre von Beginn an. Und wir beobachten Mahler mit den Augen eines Schiffsjungen, dem dann der letzte Satz des Buchs gehören wird: "Denn es war Zeit zu gehen." Das bezieht sich auf ihn selbst als Lebenden ebenso sehr wie auf Mahler als dann bereits Verstorbenen.
Wie gesagt: ein sicherer Bestseller. Und einer von denen, derer man sich wahrlich literarisch nicht schämen muss. Seethalers Erzählton hat eine unverwechselbare Knappheit erreicht, die nun in seinem bei weitem kürzesten Buch kulminiert - den Schöpfer der gewaltigsten Symphonien der Musikgeschichte in einem derart konzentrierten Buch zu würdigen, ist eine bestechende Idee. Aber das literarische Können, das Seethaler 2014 damit bewiesen hat, "ein ganzes Leben" eines nur scheinbar kleinen Mannes in weniger als zweihundert Seiten vollumfänglich vorzustellen (wie im gleichnamigen Buch geschehen), war denn doch ein größeres als jetzt beim Versuch, das Schicksal eines zweifellos Großen auf "den letzten Satz" zu komprimieren. Denn wer nichts über Mahler weiß, der wird das Buch nicht recht genießen, und wer viel über Mahler weiß, der wird manches vermissen.
Nichts vermisst man dagegen in einem noch kürzeren Roman des gleichen Verlags über ein ganzes Leben, in "Rose Royal" des französischen Schriftstellers Nicolas Mathieu (vom 20. Juli an erhältlich). Auf weniger als hundert Seiten wird das Porträt einer fünfzigjährigen Frau namens Rose geboten, die sich noch einmal verliebt. Das endet tragisch, doch wie es beginnt - in einer Bar im lothringischen Nancy, dem "Royal" -, das ist von einer solchen szenischen und psychologischen Meisterschaft, dass man sich wünscht, Mathieu hätte schon nach dreißig Seiten innegehalten und es damit bei einer der schönsten Kurzgeschichten der Weltliteratur belassen. Nicht, dass die noch folgenden beiden Teile seines Buchs enttäuschten, aber sie können das Glück der Lektüre dieses Beginns nicht erhalten. Am Schluss, mit dem Tschechow wieder einmal literarisch recht gegeben wird, bleibt der Eindruck eines allzu perfekt konstruierten Romans. Aber auch die Erinnerung an einen Zauber, der weiß Gott nicht jedem Anfang eines Buches innewohnt (das berühmte Hesse-Zitat findet sich in der deutschen Übersetzung von "Rose Royal"). Über der wiederholten Lektüre dieses Auftakts dürfte noch manche halbe Stunde zum süßen Zeitvertreib werden.
Zeitvertreib"? Ein zentrales Motiv in einem weiteren schmalen Roman: "Mehr fiel ihm zum Menschenleben nicht ein", heißt es von einem der beiden Protagonisten in dem Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" von Christine Wunnicke (Berenberg, 25. August). Diese Autorin hat noch nie ausschweifend erzählt, die 166 Seiten ihres neuen, vierten Buchs sind sogar bisheriger Höchstwert. Wieder einmal geht es gen Orient, diesmal aber nach Indien statt nach Japan wie in "Nagasaki, ca. 1642" oder "Der Fuchs und Dr. Shimamura", und noch etwas weiter in die Vergangenheit als in "Katie", Wunnickes Roman übers viktorianische England, nämlich in die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts. Als Anregung dienten ihr die Reisebeschreibungen des deutschen Mathematikers Carsten Niebuhr.
Wir begegnen ihm als einzigem Überlebenden einer vom dänischen König finanzierten Forschungsexpedition auf der nahe Bombay gelegenen Insel Elephanta, und aufgespürt wird er dort von dem zufällig anwesenden persischen Kaufmann Musa al-Lahuri, der den Deutschen mindestens so seltsam findet wie der ihn. Gegenseitige Irritation der sich im Zuge des Zeitalters der Entdeckungen begegnenden Kulturen hat spätestens seit Daniel Kehlmanns "Vermessung der Welt" Tradition in der deutschsprachigen Literatur, und erst vor vier Jahren hat Christoph Ransmayr mit "Cox" einen dem Buch Wunnickes sehr verwandten Roman geschrieben. Aber was "Die Dame mit der bemalten Hand" (der Titel grenzt an verlegerischen Etikettenschwindel, denn diese Titelfigur taucht erst am Schluss auf) auszeichnet, ist der immense Witz, mit dem Wunnicke die Sprachverwirrung zwischen Abend- und Morgenländer lesbar macht: Obwohl sowohl Niebuhr als auch Musa polyglott sind, befremden sie sich aufs Schönste beim Versuch, einander zu verstehen. Dieses Buch ist deshalb vor allem ein Vorlesekunstwerk, und man darf es einen Jammer nennen, dass die introvertierte Schriftstellerin Christine Wunnicke öffentliche Auftritte scheut. Wie gerne hörte man sie diesen Roman lesen.
Ganz anders, nämlich extrovertiert, ja geradezu explosiv, ist Philipp Winklers 125 Seiten kurzer "Carnival" erzählt, scheinbar eine Gelegenheitsarbeit, abgeliefert für ein Quartett kleiner Bücher von prominenten Hausautoren, die sich der Aufbau-Verlag zu seinem diesjährigen Jubiläum selbst geschenkt hat (alle erscheinen am 18. August, zwei Tage nach dem siebzigsten Geburtstag des Hauses). Winkler hat seinen Beitrag eigens geschrieben, und diese erste größere Arbeit nach seinem sensationellen Debütroman "Hool" von 2016 setzt dessen Intensität fort, mit der die brutale Welt der Fan-Gewalt rund um den Fußball dargestellt wurde. Nur dass die Exzesse nun in "Carnival" nicht toxischer Männlichkeit gelten, sondern Resultat sind des letzten Aufbäumens einer absterbenden Kultur: des Schaustellerwesens.
Winkler konnte nicht ahnen, dass seine meisterhaft dem Geräuschgebrodel einer Kirmes abgelauschte Prosastimme heute, nach den Monaten des erzwungenen Stillstands auf Jahrmärkten und in Vergnügungsparks, wie ein Requiem auf diese ganze Branche klingen muss, auch wenn sein Wir-Erzähler keinen Zweifel daran lässt, dass er und seine Freunde vom fahrenden Volk sich bereits als Todgeweihte sehen. Doch in der Rückschau auf einen Alltag, der von den Beteiligten verlangt, ihn für die Besucher ihres Jahrmarkts als ein dauerndes Fest zu inszenieren, wird eine überschäumende Lust und List beim Erzählen deutlich, wie sie in der deutschen Literatur lange nicht mehr präsent waren. Als hätte Winkler drei große Vorbilder gehabt: Goethes Erlebnisbericht "Römisches Carneval" wegen dessen phänomenologischen Interesses, Arno Schmidts Erzählung "Sommermeteor" aufgrund ihrer atmosphärischen Beschreibungskunst und Michail Bachtins Studien zum Zusammenhang von Literatur und Karneval, deren Analysen von Winkler hier wieder in eine Prosa-Synthese überführt werden.
Den umgekehrten Weg, nämlich einen analytischen im Erzählen, geht dagegen die unbekannteste und überraschendste Erzählerin unter den Verfassern der großen kleinen Bücher dieses Herbstes: die russische Schriftstellerin Polina Barskova. Deren Prosaband "Lebende Bilder" (Suhrkamp, 21. Oktober) stellt mit 180 Seiten zwar das umfangreichste Werk in dieser Herbst-Auslese dar, bietet aber doch die knappsten Texte, da er insgesamt elf Prosastücke enthält. Alle haben als Fokus St. Petersburg, unter dem zeitweiligen Namen Leningrad sowohl Heimatstadt der 1976 geborenen Autorin als auch Gegenstand ihrer literaturwissenschaftlichen Forschung, die sich mit den dort ansässigen Schriftstellern zur Zeit der Blockade der Stadt durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg befasst. Diese historische Ausnahmesituation ist auch der Ausgangspunkt für Barskovas fiktionales Schreiben: In der kurzen Titelgeschichte versichern sich zwei junge ineinander verliebte Museumsangestellte in der Eremitage ihres Überlebens trotz ständigen Beschusses und Hungerns durch die gegenseitige Heraufbeschwörung ihnen vertrauter Gedichte und Gemälde. In einer anderen Geschichte des Buchs, "Laubriss", dem bislang einzigen auf Deutsch publizierten Text von Barskova (2017 in fulminanter Übersetzung von Olga Radetzkaja, die jetzt auch für den ganzen Prosaband verantwortlich zeichnet, in der von Julia Kissina herausgegebenen Anthologie "Revolution Noir" erschienen), stehen zwei fiktive Schriftsteller aus dem Leningrad der frühen Belagerungsphase im Mittelpunkt, die so gegensätzliche Namen wie Bianchi und Schwarz tragen und jeweils für eine andere Form des literarischen Widerstands nicht nur gegen die deutschen Invasoren, sondern auch gegen den sowjetischen Totalitarismus stehen. Barskova gelingt ein Spagat zwischen Allegorie und Konkretion, der zum Herausforderndsten gehört, was man derzeit lesen kann. Und zum Anregendsten.
In der Erzählung "Lebende Bilder" erweisen sich die Dialoge der beiden Liebenden am Ende als Zitate realer Schriftsteller aus der Blockadezeit, die diese nicht überlebt haben - erst entriss Barskova sie als Literaturwissenschaftlerin dem Vergessen, nun selbst auch als Schriftstellerin. In "Laubriss" charakterisiert sie ihre beiden Protagonisten so: "Was Schwarz an der Blockade interessierte, waren die Menschen, vorzugsweise die Statisten (die Hauptdarsteller hatten sich mehrheitlich noch in der warmen Jahreszeit ostwärts verflüchtigt): Kinder, alte Frauen, Hausmeister, glücklose Verwalter und Spione, fast keiner von ihnen sollte den nächsten Frühling erleben. Bianchi aber, den das Wort ,Dichtkunst' von Kindheit an reizt, interessiert sich für Metaphern - sprich: hybride Monster -, in denen Vögel und Fische mit Flugzeugen zusammenwachsen und Glühwürmchen mit Phosphorabzeichen im Dunkeln: Als was maskieren sich die Bruchstücke des Blockadedaseins, welche Gestalt nehmen sie an?"
Diese imaginierten Chimären aus Natur und Krieg werden ein längeres Leben haben als die von Schwarz in seinen Texten festgehaltenen Menschen, und dass auch Bianchi Schwarz überleben wird, zeigt schon der Tempuswechsel mitten in der zitierten Passage. "Laubriss" ist keine zwanzig Seiten lang, enthält aber alles, was Literatur ausmacht. Das ist noch viel mehr als Zeitvertreib, und Wunnickes Niebuhr könnte hieraus lernen, dass es im Leben durchaus darüber hinausgehen kann. Wenn solche Bücher nicht länger als diesen Herbst lang Wirkung täten, wäre der Literaturbetrieb kränker, als ihn ein Virus jemals machen könnte.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 17.07.2024
Sprachlich fesselnd, tolle Charakterzeichnung
LovelyBooks-Bewertung am 02.03.2024
sehr schöner, ruhiger und poetischer roman¿