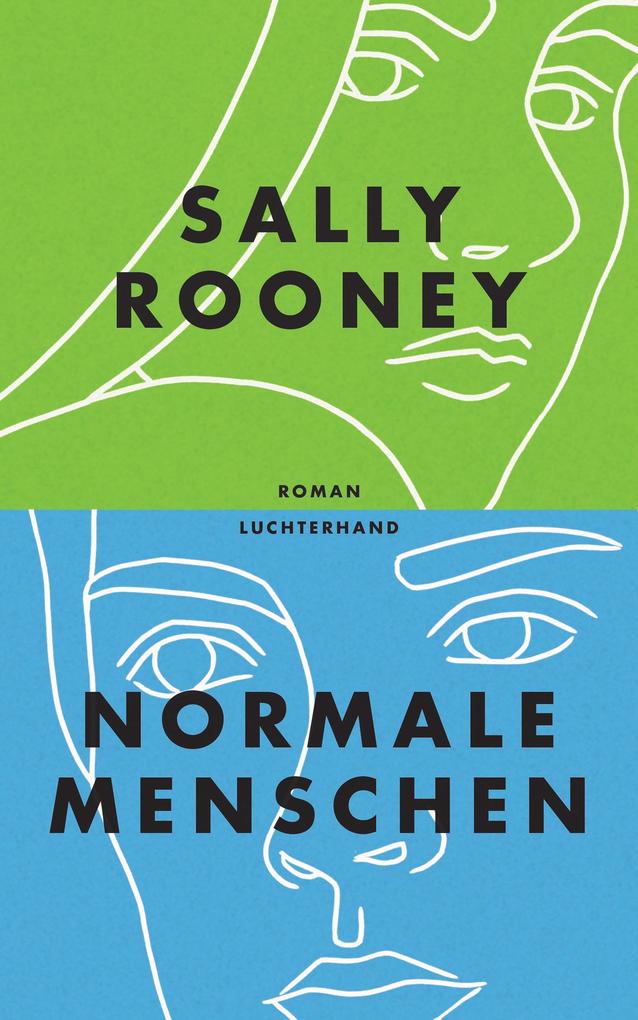
Zustellung: Do, 23.01. - Di, 28.01.25
Versand im Januar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Geschichte einer intensiven Liebe: Connell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf, aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Connell beliebt, der Star der Fußballmannschaft, Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später, an der Universität in Dublin, werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch, unwiderstehlich voneinander angezogen. Eine Geschichte über Faszination und Freundschaft, über Sex und Macht.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. August 2020
Sprache
deutsch
Auflage
Deutsche Erstausgabe
Seitenanzahl
320
Autor/Autorin
Sally Rooney
Übersetzung
Zoë Beck
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
534 g
Größe (L/B/H)
144/219/32 mm
ISBN
9783630875422
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Süffig, klug und absolut klischeefrei« Ijoma Mangold / DIE ZEIT
»Ein heißer Tipp für das jüngere Lesepublikum. « Thomas Andre / Hamburger Abendblatt
»Wie nebenbei ist auch ihre Sprache. Frei von Eitelkeiten und angeberischen Wortneuschöpfungen erzählt sie ihre Geschichte in einer glasklaren Prosa. « Xaver von Cranach / DER SPIEGEL
»Wer Normal People gelesen hat, der hatte das Gefühl, als seien ihm gerade über mehrere Stunden flüssige Butter eingeflößt worden. « Theresa Hein / Süddeutsche Zeitung
»Die 29-jährige Irin ist der Shooting-Star der europäischen Literatur, sie wurde als J. D. Salinger der Snapchat-Generation bezeichnet. « Philipp Holstein / Rheinische Post
»Rooneys Erzählhaltung macht diesen Roman so besonders. Sie schwebt zwischen den beiden Hauptfiguren, die sich selbst meist nicht verstehen. « Lisa Goldmann / Madame
»Ein heißer Tipp für das jüngere Lesepublikum. « Thomas Andre / Hamburger Abendblatt
»Wie nebenbei ist auch ihre Sprache. Frei von Eitelkeiten und angeberischen Wortneuschöpfungen erzählt sie ihre Geschichte in einer glasklaren Prosa. « Xaver von Cranach / DER SPIEGEL
»Wer Normal People gelesen hat, der hatte das Gefühl, als seien ihm gerade über mehrere Stunden flüssige Butter eingeflößt worden. « Theresa Hein / Süddeutsche Zeitung
»Die 29-jährige Irin ist der Shooting-Star der europäischen Literatur, sie wurde als J. D. Salinger der Snapchat-Generation bezeichnet. « Philipp Holstein / Rheinische Post
»Rooneys Erzählhaltung macht diesen Roman so besonders. Sie schwebt zwischen den beiden Hauptfiguren, die sich selbst meist nicht verstehen. « Lisa Goldmann / Madame
 Besprechung vom 18.08.2020
Besprechung vom 18.08.2020
Weich und weiß wie Mehlteig
Empfehlenswert für alle, die nicht lesen und noch nichts erlebt haben: Sally Rooneys Roman "Normale Menschen"
Wenn Sally Rooney "das literarische Phänomen des Jahrzehnts" ist, wie der "Guardian" behauptet, oder auch die "Stimme der Millennials", wie mittlerweile ermüdend oft zu hören war, dann muss es ein ziemlich armes Jahrzehnt sein, und die Millennials können einem leidtun. Ein geheimnisloses, alles sofort auf den Begriff bringendes Erzählen ist das der 1991 in Castlebar geborenen Irin - und eines, das nicht nur hinter die psychologische Darstellung der literarischen Moderne, sondern selbst hinter die des neunzehnten Jahrhunderts wieder zurückfällt.
Dazu passt, dass die Fabel ihres zweiten Romans, "Normale Menschen", der nun auf den Bestseller "Gespräche mit Freunden" (2019) folgt, trotz mancher aktueller Themen wie Mobbing, familiärer Gewalt und Depression im Grunde eine sehr alte Geschichte ist. Ein Mädchen trifft einen Jüngling, und obwohl er ein allseits beliebter Sportsmann ist und sie die "seltsame Außenseiterin", obwohl er der gutherzige Sohn einer Putzfrau und sie eine komplexbeladene Tochter der Oberschicht, finden die beiden zusammen, erst körperlich, dann seelisch.
Trotz aller Unterschiede, trotz Phasen der wütenden oder auf Missverständnissen beruhenden Trennung, tun Connell und Marianne, zwei Landeier unterschiedlicher Klassen aus Westirland, einander am Ende märchenhaft gut. Er gibt ihr Selbstwertgefühl, sie animiert ihn zum Literatur- und Filmstudium. Auf den Begriff gebracht: "Er machte ihr das Geschenk, ein guter Mensch zu sein, und das gehörte jetzt ihr." Wenn einem so viel Gutes widerfährt, was kann da noch schiefgehen, das die Lektüre zumindest etwas spannend macht?
Man könnte mit sehr viel Wohlwollen Reflexe von Charles Dickens' Entwicklungsroman "Große Erwartungen" oder J. D. Salingers Campus-Erzählung "Franny und Zooey" darin erkennen, wie hier Ungleiche sich verlieben und wie das leicht zum Nervenzusammenbruch führen kann, aber die Dialoge bei Dickens sind weitaus schärfer, und das akademische Leben bei Salinger ist interessanter geschildert. Selbst schwächere Highschool-Filme der achtziger Jahre haben die Frage, was es heißt, Außenseiter zu sein, mit mehr Tiefgang verhandelt, als Rooney es tut.
Um diesen Mangel zu kompensieren, streut sie ein bisschen "Fifty Shades of Grey" ein, also die unbeholfene Darstellung von sexueller Unterwerfung und Masochismus, die allerdings nicht ohne moralisierende Begleitstimme auskommt: "Ist die Welt so ein böser Ort, dass sich Liebe nicht von den niedersten und missbräuchlichsten Formen von Gewalt unterscheiden lässt?" Während Connell und Marianne sexuelle Erfüllung finden, bleibt deren Beschreibung weitgehend unbefriedigend: "Ihr Mund schmeckt so dunkel wie Wein", "Ihr Körper war ganz weich und weiß wie Mehlteig", heißt es etwa oder: "Oft wünschte er sich, er könnte in ihrem Körper einschlafen."
Zum Einschlafen ist die Metaphorik Sally Rooneys. Während der Erzählton zumeist um eine unmenschliche Kühle bemüht ist oder gar ansatzweise wissenschaftlich klingt, wenn auch missglückt ("Wenn sie bei Connell anders war, fand dieses Anderssein nicht in ihr, in ihrem Personsein statt, sondern in der Dynamik zwischen ihnen"), fallen die lebensweisheitlichen kitschigen Einschübe umso stärker auf: "Ich glaube, jeder ist auf seine Art ein Geheimnis", sagt Marianne einmal.
Ansatzweise interessant wird die Geschichte im letzten Drittel, das die schon etwas gereiften Protagonisten nach Dublin ans Trinity College begleitet. Connell hat dort ein Stipendium für literarisches Schreiben, sieht aber in der Literatur seiner Kommilitonen "kein Potential als Widerstandsform". Er, der sich als Arbeiterkind den Zugang zu Bildung erst erkämpfen musste und durch die Inspiration Mariannes einen Top-Schulabschluss erreicht hat, entlarvt nun die Mitstudenten als unpolitische Idioten, die bloß kultiviert erscheinen wollten. Es folgt eine kritische Reflexion der Buchbranche, die ihre Produkte "letztlich als Statussymbole vermarktet" - was mit Blick auf das vorliegende Buch allerdings unfreiwillig komisch wirkt. Der antikapitalistische Impuls, den manche Rezensenten ähnlich aufgeblasen haben wie die Bedeutung Sally Rooneys für die Gegenwartsliteratur, erschöpft sich im bloßen Anzitieren von Stichworten ("Anti-Austeritätsproteste") und der Behauptung, jemand habe das "Kommunistische Manifest" gelesen.
Der Roman "Normale Menschen", der die Fragwürdigkeit von Normalität denkbar plakativ verhandelt, ist nicht zuletzt für die irische Literatur eine Enttäuschung. Aus der snobistischen Haltung von Dublinern gegenüber Provinzlern etwa hätte die Autorin mehr machen können, aber sie hat einfach keine originellen Gedanken. Für Menschen, die noch nie einen Roman gelesen haben, mag das Buch phänomenal sein.
JAN WIELE
Sally Rooney: "Normale Menschen". Roman.
Aus dem Englischen von Zoë Beck.
Luchterhand Verlag,
München 2020. 320 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 02.12.2024
Etwas dröger Liebesroman in eigenwilligem monotonem Stil, der Klassen- und Statusunterschiede in den Vordergrund stellt
LovelyBooks-Bewertung am 28.11.2024
Ich betone immer, dass ich kein Fan von Liebes-Romanen bin. Dieser hier ist allerdings eher eine Charakterstudie zweier Menschen. Ohne Schnulz, ohne Zuckerguss.Connell und Marianne wachsen in einer kleinen Stadt in West-Irland auf. Sie ist reich, er arm. Er hat viele Freunde, sie keine. Ihre Familie ist dysfunktional, seine Mutter das Ideal. Was sie verbindet ist ihr Intellekt und eine körperliche Anziehung. Doch reicht das?Normale Menschen wurde so sehr gehyped, dass ich das Gefühl hatte nicht "drum herum" zu kommen. Am Anfang liest sich das Buch sehr einfach - fast schon zu einfach. Dann verdichtet und verdüstert sich der Plot, bleibt aber in meinen Augen stets nachvollziehbar. Die wunderbaren Charakterentwicklungen tragen den Roman.









