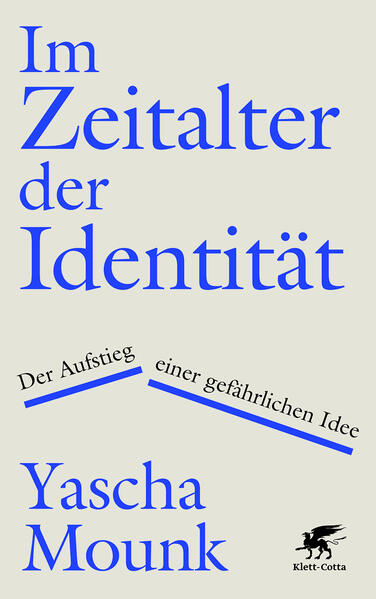Besprechung vom 18.02.2024
Besprechung vom 18.02.2024
Die Ideologie, deren Name nicht genannt werden darf
Ist überhaupt noch Verständigung möglich? Yascha Mounk will den Universalismus gegen einen drohenden Kampf der Identitätsgruppen verteidigen.
Von Mark Siemons
Es war nicht allein eine Demonstration des Antisemitismus, als vergangene Woche Aktivisten, die beanspruchten, für Palästina zu sprechen, eine auf mehrere Tage angelegte Hannah-Arendt-Lesung im Berliner Kunstmuseum "Hamburger Bahnhof" sprengten. Wer die Augenzeugenberichte des Vorfalls liest und sich das Video der Aktion anschaut, das die Gruppe selbst ins Netz gestellt hat, entdeckt dort inmitten all der herausgeschrienen Parolen von "from the river to the sea" bis "shame on you!" Sprechformeln, die noch von ganz woanders herkommen als vom Gazakrieg und all den damit verbundenen Konflikten. Als die Organisatorin der Lesung, die kubanische Künstlerin Tania Bruguera, den Demonstranten entgegenhielt, sie wüssten doch gar nicht, wer sie sei und dass sie sich immer für die Unterdrückten und auch die Palästinenser eingesetzt habe, bekam sie augenblicklich, auf Englisch, zur Antwort: "Du bist immer noch eine weiße Person. Du hast einen privilegierten Hintergrund!" Eine Frau aus dem Publikum wollte die Wut der Aktivisten mit der Versicherung beschwichtigen, sie stehe doch "inhaltlich" auf ihrer Seite, aber auch das wirkte nicht: "Wärst du inhaltlich auf unserer Seite, wärst du jetzt still", wurde ihr gesagt. Der aus Libanon stammende Ko-Direktor des Museums, Sam Bardaouil, redete die grundsätzlich in englischer Sprache Protestierenden auf Arabisch an und erzählte, sein Haus in Libanon sei fünfmal zerstört worden: "Wenn einer von Verlust sprechen kann, dann bin ich es." Laut Bruguera wurde er daraufhin als "Rassist" beschimpft, als "Araber mit heller Haut".
Bei allen drei Interaktionen wurde das Angebot einer allgemein menschlichen Verständigung, das biographische oder politische Gemeinsamkeiten geltend machen wollte, barsch zurückgewiesen, und zwar mit Verweis auf eine den Sprechern unterstellte Gruppenzugehörigkeit. Offensichtlich sprachen die Aktivisten da nicht nur für Palästina, sondern auch für ein spezielles Weltdeutungsschema, ohne dessen Existenz die Promptheit ihrer Reaktionen kaum erklärbar wäre. Egal, was man sagt oder tut, soll allein die politische Hautfarbe, die einen als "weiß" und privilegierten Täter oder als "of color" und nichtprivilegiertes Opfer ausweist, über die Position in Politik und Gesellschaft entscheiden. Personen, die nicht zu einer Opfergruppe gehören, sollen ihr aufgeklärtes Bewusstsein über ihre Standortabhängigkeit dadurch unter Beweis stellen, dass sie schweigen und sich den Positionen der Opfergruppen anschließen. Und selbst wenn man die Erfahrungen einer Opfergruppe teilt, soll man als deren Repräsentant nur dann infrage kommen, wenn man sich auch alle politischen Folgerungen zu eigen macht, die sich aus dieser Einteilung der Welt ergeben.
Versatzstücke wie diese geistern schon seit Längerem durch den öffentlichen Raum, doch für Außenstehende ist die Auseinandersetzung mit ihnen schwierig, solange sie bloß als isolierte Statements in Erscheinung treten und der theoretische Zusammenhang dahinter nicht sichtbar wird. Jetzt kommt ein Buch mit dem Titel "Im Zeitalter der Identität" heraus, das ebendiesen Zusammenhang zu rekonstruieren und zu kritisieren versucht: als das ausdrücklich antiuniversalistische Projekt, die Politik durch das Prisma von Identitätsgruppen wahrzunehmen, als Gefährdung der liberalen Demokratie. Autor ist der Politikwissenschaftler Yascha Mounk, der in München geboren ist und heute an der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität lehrt. Mounk ist auch einer der Herausgeber der Wochenzeitung "Die Zeit", lässt seine Herausgeberschaft aber derzeit ruhen, weil er vor zehn Tagen in den USA einer Vergewaltigung bezichtigt wurde. Mounk weist den Vorwurf als unwahr zurück, darüber hinaus ist zu dem Fall bis zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt. Mounks deutscher Verlag Klett- Cotta erklärte, nach jetzigem Sachstand erscheine es ihm nicht angezeigt, die Publikation des Buchs zurückzuziehen.
Dessen zentrales Anliegen ist die Verteidigung des liberalen Universalismus, der alle Menschen erst einmal gleich behandelt: Angesichts der Bedrohung durch rechte Demagogen sei er heute besonders notwendig. Die Versuche, die Politik von partikularen Kategorien wie Race, Gender oder sexueller Orientierung her aufzuziehen, wirkten sich daher fatal aus. Leider wird in der deutschen Übersetzung des im amerikanischen Original schon vor fünf Monaten erschienenen Buchs "race" durchgängig mit "Rasse" übertragen. Auch in Anführungszeichen ist der deutsche Ausdruck eine rassistische Fiktion, während diskriminierte Gruppen in Amerika den Begriff "race" als Selbstbeschreibung benutzen.
Mounk gibt dem Ideologieverdacht gegen einen naiven Universalismus, durchaus recht. Rassismus und andere Formen der Diskriminierung gehen eben nicht nur auf individuelles Fehlverhalten zurück, sondern können ihren Grund auch in tief in die Gesellschaft eingegrabenen ungerechten Strukturen haben. Wer einfach nur auf Farbenblindheit und Nichtansehen der Person besteht, wie es dem klassischen liberalen Denken entspricht, könnte die bestehenden Ungleichheiten zugunsten der Privilegierten noch verfestigen. Die Frage ist nur, was aus dieser Einsicht folgt.
Mounk weist in einem Anhang ausdrücklich darauf hin, dass die "neue Ideologie", um die es ihm in seinem Buch geht, keineswegs eine Form des kulturellen Marxismus sei, wie manche ihrer konservativen Kritiker behaupten. Dennoch gibt es eine aufschlussreiche Parallele hinsichtlich der Konsequenzen, die sich aus beider Universalismus-Kritik ergeben. Auch der Marxismus ging ja davon aus, dass es kein Vakuum ist, in dem die Menschen als Individuen und Träger gleicher Rechte leben; er identifizierte die Macht- und Eigentumsverhältnisse als Kräfte, die diesen Raum durchwirken. Doch so wie aus dieser zutreffenden Erkenntnis nicht die Aufforderung zum Klassenkampf folgen muss, so zweifelt Mounk an, dass die Kritik des strukturellen Rassismus in einen permanenten Identitätsgruppenkampf münden muss.
Die angebliche Notwendigkeit einer solchen Folgerung ergibt sich laut Mounk nur aus der Binnenlogik und Geschlossenheit eines Systems, das er in seinem Buch zu rekonstruieren versucht. Es setze sich im wesentlichen aus drei Elementen zusammen: dem "Postmodernismus", dessen Hauptvertreter Foucault die Existenz objektiver Wahrheiten und universeller Normen anzweifelte; dem "Postkolonialismus", dessen Vertreter wie Edward Said die philosophische Diskurskritik auf eine Kritik des westlichen Diskurses hin politisierten; und der "Critical Race Theory", die, so Mounk, aus dem strukturellen Rassismus die Folgerung zog, es komme vor allem darauf an, sich auf die Seite der richtigen Gruppe zu stellen. Ergänzt werde Letztere noch durch die Intersektionalitätstheorie, der gemäß alle Unterdrückungen zusammenhängen.
Das Problem einer solchen Rekonstruktion besteht nun allerdings darin, dass das System selbst sich gar nicht als solches versteht. Mounk erwähnt den Umstand, dass alle Begriffe, mit denen es bisher belegt wurde, ob "Identitätspolitik" oder "woke", als Kampfbegriffe von Gegnern zurückgewiesen wurden; das damit Bezeichnete, werde gesagt, gebe es in Wirklichkeit gar nicht. Tatsächlich dürften nicht alle, die etwa von strukturellem Rassismus oder Intersektionalität sprechen, sämtliche übrige der von Mounk aufgeführten Theorieelemente übernehmen. Dennoch erscheint es legitim, ihren durch zahlreiche Zitate aus einschlägigen Büchern - wie von Ibram X. Kendi, Robin DiAngelo, Sandra Harding - belegten Zusammenhang von außen zu rekonstruieren. Erst so wird deutlich, wie sich ein ursprünglich universalistischer, um die gleichen Rechte aller Menschen besorgter Antrieb zu jenem umfassenden Gegenentwurf zum Universalismus entwickeln konnte, den etwa die Aktivisten im Hamburger Bahnhof dem verdutzten Publikum um die Ohren hauten. Der "strategische Essentialismus", den die indisch-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Spivak vorschlug, um die unter dem universalistischen Deckmantel fortlebenden Unterdrückungsverhältnisse zu bekämpfen, entwickelte eine Eigendynamik und ist in der Praxis oft kaum noch von einem Essentialismus zu unterscheiden, der die gegenseitige Abgrenzung von Stämmen zur Grundlage der Politik macht.
Das Verbot, den durchaus vorhandenen Zusammenhang überhaupt zu benennen, erscheint daher als Abwehrversuch, der eine Außenperspektive auf das Theoriegebilde verhindern will. In Anlehnung an Voldemort, den Bösen in den Harry-Potter-Romanen, könnte man das auf diese Weise unsichtbar Gemachte als die Ideologie bezeichnen, deren Name nicht genannt werden darf. Mounk zieht daraus nur den Schluss, seinerseits ein Etikett vorzuschlagen - "Identitätssynthese" - , das zudem ziemlich blass ist. Doch womöglich bringt das Benennungsverbot auch eine Leerstelle in der Theorie selbst zur Sprache, ihre Beziehung zur Macht. Indem die Theorie unterschiedliche Identitätsgruppen als entscheidende Kategorien der Politik auffasst, scheint sie kein eigenes Konzept für den allen gemeinsamen Boden einer Gesellschaft zu haben; der wird einfach als gegeben vorausgesetzt. So steht sie zu der politischen und ökonomischen Macht, die sich in Institutionen manifestiert, in einem bloß parasitären Verhältnis, das nicht weiter definiert werden kann. Im Schatten dieser Ortlosigkeit stellen sich allerdings ungeklärte Machtfragen: Wer entscheidet über die Selektion und Abgrenzung der Identitätsgruppen und deren Repräsentation? Keineswegs sind ja alle Diskriminierten durch sie erfasst, sondern nur eine bestimmte Auswahl.
Das Buch zeigt erhellend auf, welche fatalen Konsequenzen sich aus ursprünglich wichtigen Einsichten durch deren Systematisierung ergeben haben. Aus der Kritik an "kultureller Aneignung" wurde ein grundsätzlicher Zweifel, ob Angehörige verschiedener Identitätsgruppen einander überhaupt verstehen können. Aus der "Standortepistemologie", die die Erfahrung verschiedener Diskriminierungen als politische Kategorie stark machte, wurde die Forderung, dass alle, die diese Erfahrung nicht teilen, sich den Positionen der entsprechenden Opfergruppe anschließen und ansonsten schweigen. Aus der Wahrnehmung von "strukturellem Rassismus" wurde die Behauptung, Angehörige diskriminierter Gruppen könnten selber nicht rassistisch sein.
Das Buch ist eine Fundgrube vieler plausibler kritischer Überlegungen, doch mit seiner Methode, Anekdoten von nicht immer zwingender Überzeugungskraft aneinanderzureihen, ist es weniger grundsätzlich, als es behauptet. Seinem Anspruch, aufzuzeigen, wie genau der liberale Universalismus die neuen Einsichten aufnehmen kann, ohne in die "Identitätsfalle" zu tappen, wird es dadurch nicht gerecht. Es bleibt bei der Behauptung stehen, dass er es kann. Mounk nimmt die Korrekturen an der bisherigen Naivität nicht so ernst, dass er sie zum Anlass für eine Neukonzeption nähme. Wie ein künftiger Universalismus nach der Identitätspolitik aussehen kann, bleibt die entscheidende Frage.
Yascha Mounk: "Im Zeitalter der Identität". Aus dem Amerikanischen von Sabine Reinhardus und Helmut Dierlamm. Klett-Cotta, 505 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.