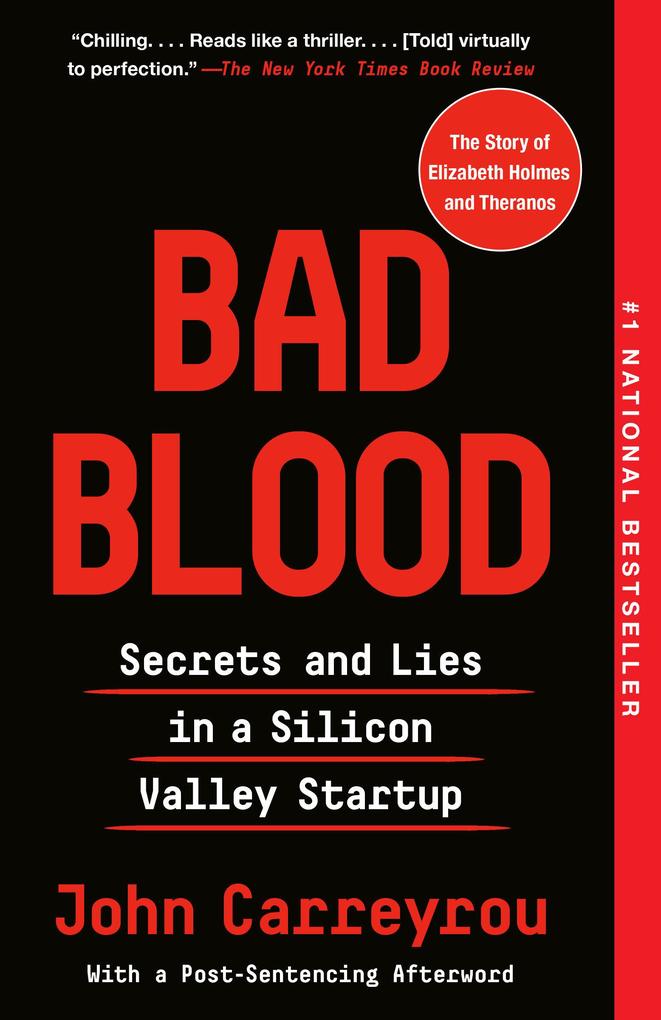
Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
The Financial Times & McKinsey Business Book of the Year
A New York Times Notable Book
A Washington Post Notable Book
One of the Best Books of the Year: NPR, San Francisco Chronicle, Time, Esquire, Fortune, Marie Claire, GQ, Mental Floss, Science Friday, Bloomberg, Popular Mechanics, BookRiot, The Seattle Times, The Oregonian, Publishers Weekly, Library Journal
In 2014, Theranos founder and CEO Elizabeth Holmes was widely seen as the next Steve Jobs: a brilliant Stanford dropout whose startup "unicorn" promised to revolutionize the medical industry with its breakthrough device, which performed the whole range of laboratory tests from a single drop of blood. Backed by investors such as Larry Ellison and Tim Draper, Theranos sold shares in a fundraising round that valued the company at more than $9 billion, putting Holmes's worth at an estimated $4.5 billion. There was just one problem: The technology didn't work. Erroneous results put patients in danger, leading to misdiagnoses and unnecessary treatments. All the while, Holmes and her partner, Sunny Balwani, worked to silence anyone who voiced misgivings-from journalists to their own employees.
Rigorously reported and fearlessly written, Bad Blood is a gripping story of the biggest corporate fraud since Enron-a tale of ambition and hubris set amid the bold promises of Silicon Valley.
A New York Times Notable Book
A Washington Post Notable Book
One of the Best Books of the Year: NPR, San Francisco Chronicle, Time, Esquire, Fortune, Marie Claire, GQ, Mental Floss, Science Friday, Bloomberg, Popular Mechanics, BookRiot, The Seattle Times, The Oregonian, Publishers Weekly, Library Journal
In 2014, Theranos founder and CEO Elizabeth Holmes was widely seen as the next Steve Jobs: a brilliant Stanford dropout whose startup "unicorn" promised to revolutionize the medical industry with its breakthrough device, which performed the whole range of laboratory tests from a single drop of blood. Backed by investors such as Larry Ellison and Tim Draper, Theranos sold shares in a fundraising round that valued the company at more than $9 billion, putting Holmes's worth at an estimated $4.5 billion. There was just one problem: The technology didn't work. Erroneous results put patients in danger, leading to misdiagnoses and unnecessary treatments. All the while, Holmes and her partner, Sunny Balwani, worked to silence anyone who voiced misgivings-from journalists to their own employees.
Rigorously reported and fearlessly written, Bad Blood is a gripping story of the biggest corporate fraud since Enron-a tale of ambition and hubris set amid the bold promises of Silicon Valley.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Februar 2020
Sprache
englisch
Seitenanzahl
400
Autor/Autorin
John Carreyrou
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
376 g
Größe (L/B/H)
197/128/22 mm
ISBN
9780525431992
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 07.04.2019
Besprechung vom 07.04.2019
Das böse Blut
Wenn ich einmal groß bin, will ich Milliardärin werden: Mehrere Dokumentationen über den Mythos von Elizabeth Holmes
Die Geschichte von Elizabeth Holmes scheint zu gut zu sein, als dass man sie nur einmal erzählen dürfte. 2003, mit gerade 19 Jahren, verlässt sie die Universität Stanford ohne Abschluss, um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Mit "Theranos", der Name eine Verknüpfung von "Therapie" und "Diagnose", verfolgt sie das Ziel, ein revolutionäres Bluttestverfahren auf den Markt zu bringen. Ohne die Notwendigkeit von langen Nadeln und Spritzen, nur durch einen Ministich in die Fingerspitze, soll es Patientinnen ermöglicht werden, innerhalb von Minuten und im eigenen Zuhause Hunderte von Bluttests durchführen zu können.
Dass die Technologie dafür zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise funktioniert, hindert das Unternehmen nicht daran, seine Dienste zu verkaufen und mehrere hundert Millionen Dollar Kapital einzuwerben. Man greift, zunächst vorübergehend, dann auf Dauer, auf umgebaute konventionelle Messgeräte zurück, improvisiert und fälscht Werte und täuscht all jene, die versuchen, Einblick in das Verfahren zu gewinnen. Der erste, der diesen Betrug schließlich 2015 publik macht, ist der Journalist John Carreyrou, dessen umfangreicher Bericht "Bad Blood" soeben auf Deutsch erschienen ist. Die Firma verliert in der Folge die Zulassung für ihre Labore sowie den größten Teil ihres Werts. 2018 wird das Unternehmen aufgelöst. Von der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SCE wird Holmes verboten, in den nächsten zehn Jahren ein Unternehmen zu führen. Ein Strafprozess wegen Betrugs läuft derzeit. Alex Gibney, unter anderem für seine "Wikileaks"-Dokumentation "We Steal Secrets" bekannt, hat zudem Elizabeth Holmes' Geschichte unter dem Titel "The Inventor" für den Fernsehsender HBO dokumentiert. Für die Verfilmung von "Bad Blood" hat sich der Regisseur Adam McKay ("The Big Short", "Vice") die Rechte gesichert; Jennifer Lawrence soll die Hauptrolle spielen. Und nicht zuletzt erzählt der Podcast "The Dropout" von Rebecca Jarvis für den US-Sender ABC die Geschichte in aller Ausführlichkeit.
Gemeinsam ist all diesen Erzählungen ihre Fokussierung auf die Gründerin. Elizabeth Holmes bildet das Zentrum der Geschichten, ihr Unternehmen und ihr Gesicht sind untrennbar miteinander verknüpft. So selbstverständlich diese Fokussierung zunächst erscheint, so sehr erstaunt sie einen, je mehr man über Holmes erfährt. Denn viel gibt es über sie allem Anschein nach gar nicht zu erzählen. Es gibt die üblichen Anekdoten aus der Kindheit, die ihre Entschlossenheit belegen sollen: Befragt nach ihrem Berufswunsch gibt die junge Elizabeth zu Protokoll, später Milliardärin werden zu wollen. Warum nicht Präsidentin? "Der Präsident wird mich heiraten, weil ich Milliardärin bin." Sie spielt selbstverständlich auch ehrgeizig Monopoly. Ihr Lebensweg erscheint ausgerichtet auf den wirtschaftlichen Erfolg, das College nutzt sie in erster Linie als Sprungbrett in die Technologieszene Kaliforniens. Wer immer sich über sie äußert, betont, wie überzeugt sie von ihrer Sache ist und wie bereit, für den Erfolg ihres Unternehmens auf fast alles (inklusive Schlaf) zu verzichten.
Elizabeth Holmes fungiert als Prototyp einer modernen Unternehmerin. Gerade darin, dass sie auf alles Individuelle verzichtet, liegt das Besondere ihrer Person. In ihrer Erscheinung zeigt sich gleichzeitig das Plumpe wie Virtuose dieses Verzichts: Als eine PR-Beraterin Holmes vorschlägt, sie solle sich doch wie ihr Vorbild Steve Jobs einen wiedererkennbaren Kleidungsstil zulegen, erscheint diese von da an ebenfalls im schwarzen Jobs-Rollkragen. Kein Beitrag über sie verzichtet auf die Erwähnung ihrer tiefblauen Augen, denen sie das Blinzeln beinahe ab-, und ihrer Stimme, der sie eine außergewöhnlich tiefe Lage antrainiert hat. Wer mit ihr spricht, so beschreiben es Theranos-Angestellte zum Beispiel in Carreyrous Buch, fühle sich motiviert, bestärkt im Glauben an sie und das Unternehmen.
In diesen Beschreibungen klingen die Fähigkeiten einer Illusionskünstlerin an, die nicht darauf angewiesen ist, Zweifelnde zu überzeugen, sondern die andere dazu bringt, ihr glauben zu wollen. Die Gründerin von Theranos macht sich zur Projektionsfläche für die Wünsche und Hoffnungen aller um sie herum. Ihre Geschichte ist im Kontext des Silicon Valley nicht besonders außergewöhnlich, sie wird es dadurch, dass ihr Umfeld ihr zur Wirklichkeit verhilft. Die Kapitalströme prominenter Investorinnen (darunter Betsy DeVos, Henry Kissinger und Tim Draper) machen Elizabeth Holmes eine Zeitlang zu der brillanten Unternehmensführerin, für die diese sie halten. Wie in jeder guten Hochstaplergeschichte wird der Betrug auch ermöglicht durch die Überzeugung der Betrogenen, sich nicht geirrt haben zu können, und ihrer Angst, sich die Täuschung und die damit verbundenen Kosten einzugestehen.
Angesichts der Erwartungen, die die Schilderung von Elizabeth Holmes' Charisma wecken, muss Alex Gibneys Film "The Inventor" enttäuschen. Auch weil die titelgebende "Erfinderin" aus naheliegenden Gründen ihre Sicht der Dinge nicht vor der Kamera darlegt, muss sich der Regisseur mit existierendem Material begnügen. Der Zuschauer sieht sie durch die Bilder, durch die sie selbst gesehen werden möchte. Doch angesichts der mittlerweile offensichtlichen Leere ihrer Versprechungen erscheinen diese Bilder schal und redundant. Wenn kurz vor dem Abspann der MC-Hammer-Song "U Can't Touch this" läuft, der zuvor auf einer Unternehmensfeier als wenig subtile Botschaft an die Belegschaft von Theranos gerichtet worden war, so klingt dies fast wie ein Eingeständnis dessen, dass sich, zumindest in Spielfilmlänge, dem Rätsel Elizabeth Holmes' nicht nahekommen lässt. Ein Problem ist dies vor allem deswegen, weil Gibneys Film unentschieden bleibt, ob er sich nicht doch von Holmes' Geschichte lösen soll, aber gleichzeitig nicht davon ablassen kann, sich an ihr und den Mutmaßungen über ihre Motive und Rechtfertigungen abzuarbeiten. Holmes bleibt so Projektionsfläche - nicht mehr für die Hoffnungen von Patienten und Investoren, aber für die Psychologisierungen des Regisseurs.
Dieser Fokus verstellt oft den Blick für den ökonomischen wie kulturellen Kontext, in dem Theranos überhaupt als ein erfolgversprechendes Unternehmen gelten konnte. Die Intransparenz von Start-up-Unternehmen wird oft als der Preis beschrieben, den Investoren für deren Versprechen bezahlen, ein Wachstum zu realisieren, das sonst unerreichbar scheint. Das Unternehmen Theranos, seine niemals marktreifen Geräte namens "Edison" und auch seine Gründerin: sie alle sind für Außenstehende Black Boxes, über dessen Inhalt nichts bekannt ist und nichts bekannt werden darf. Sie sind das Versprechen auf Gewinn, der wie aus dem Nichts zu kommen scheint.
Sich auf die Risiken einzulassen, die mit dieser Undurchsichtigkeit verbunden sind, wird attraktiv in einer Situation, in der enormes Investmentkapital in wenigen Händen konzentriert ist, aber wenige Gelegenheiten vorhanden sind, dieses mit hoher Rendite anzulegen. Elizabeth Holmes bewegt sich, besonders "Bad Blood" macht dies deutlich, auch dank ihrer Familie, die zur Elite von Washington, D. C., gehört, mit Selbstverständlichkeit in den Kreisen zwischen Politik und Wirtschaft, in denen über die Verteilung dieses Kapitals entschieden wird. Auch dieser Zugehörigkeit verdankt es sich, dass ihr nur das Beste zugetraut wird. Hinzu kommt, dass in einem Gesundheitssystem, in dem ein herkömmlicher Bluttest schnell mehrere hundert Dollar kostet, jedes Versprechen einer günstigeren Alternative mit sofortiger Aufmerksamkeit rechnen kann.
Letztlich tragen aber auch die Konventionen des Genres populärer Wirtschaftsbücher und -dokumentationen dazu bei, Geschichten wie die von Elizabeth Holmes überhaupt erst zu ermöglichen. Gibney wie Carreyrou verweisen beide darauf, dass es Holmes' Geschichte war, die fast ausschließlich für den Erfolg von Theranos bürgen musste. Dass die Geschichte einer 19-jährigen Studienabbrecherin, die zur größten Erfinderin des 21. Jahrhunderts wird, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten überhaupt geglaubt werden kann, liegt auch daran, dass wir an diese Art von Erzählungen gewöhnt sind. Während Heldengeschichten an vielen anderen Orten aus der Mode gekommen sind, erfreuen sie sich als mehr oder weniger literarisierte Unternehmerbiographien ungebrochener Beliebtheit. Sie normalisieren die Vorstellung, dass es einzelne Genies (wie Holmes' Vorbilder Thomas Alva Edison oder Steve Jobs) sind, die Innovation und wirtschaftlichen Erfolg aus dem Nichts erschaffen. Der Fähigkeit, diese finden und erkennen zu können, rühmen sich in Elizabeth Holmes' Fall alle, die in ihr Unternehmen investiert und die sie gefördert hatten. Daran rüttelt auch kaum, dass sich im Nachhinein alles nur als Bluff herausstellt: Wenn Elizabeth Holmes schon nicht die größte Erfinderin des 21. Jahrhunderts ist, erscheint sie durch alle Dokumentationen hindurch nur umso mehr als "exzellente Verkäuferin". Auch dort, wo sie sie als Gescheiterte oder Lächerliche vorführen, arbeiten diese Heldenerzählungen mit am Mythos ihrer Protagonistin.
TILMAN RICHTER
John Carreyrou: "Bad Blood". Aus dem Englischen von Karlheinz Dürr. DVA, 400 Seiten, 24 Euro. Die HBO-Dokumentation "The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley" ist in Deutschland bei Sky abrufbar.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Bad Blood" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









