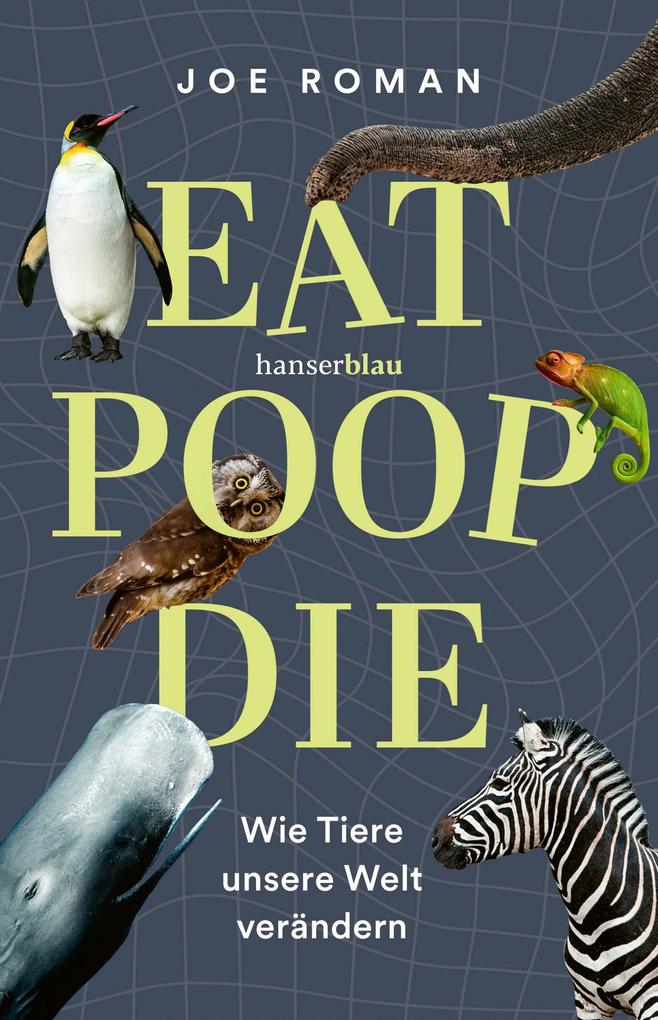
Sofort lieferbar (Download)
Ein Buch, das den Blick auf die Welt verändert: Warum wir Tiere, deren Ausscheidungen und Kadaver für das Fortbestehen unseres Planeten brauchen
Im Ozean vor Island bricht ein Vulkan aus. Eine Insel entsteht, auf der sich keine lebendige Zelle befindet. Bis ein Vogel darüber fliegt und auf die Insel kackt - und so Dünger und Pflanzensamen ihren Weg in die Lavawüste finden.
Der Biologe Joe Roman erzählt vergnüglich und hoffnungsfroh davon, wie unser Planet durch das Fressen, Kacken und Sterben von Tieren geformt wird. Nicht nur zur Lektüre auf dem Klo bestens geeignet.
Im Ozean vor Island bricht ein Vulkan aus. Eine Insel entsteht, auf der sich keine lebendige Zelle befindet. Bis ein Vogel darüber fliegt und auf die Insel kackt - und so Dünger und Pflanzensamen ihren Weg in die Lavawüste finden.
Der Biologe Joe Roman erzählt vergnüglich und hoffnungsfroh davon, wie unser Planet durch das Fressen, Kacken und Sterben von Tieren geformt wird. Nicht nur zur Lektüre auf dem Klo bestens geeignet.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. Oktober 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
304
Dateigröße
3,72 MB
Autor/Autorin
Joe Roman
Übersetzung
Nikolaus Palézieux
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783446281844
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 30.11.2024
Besprechung vom 30.11.2024
Das schlagende Herz des Planeten
Kadaver, Fäkalien und Landschaften der Angst: Joe Roman erklärt, wie Tiere durch ihre täglichen Verrichtungen ganze Ökosysteme aufbauen und verändern.
Von Kai Spanke
Von Kai Spanke
Alexander von Humboldt war kein besonders guter Ornithologe. Das jedenfalls behauptet der Umwelthistoriker Gregory Cushman in seinem vor elf Jahren erschienenen Buch "Guano and the Opening of the Pacific World". Als der deutsche Naturforscher zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts die Küste Perus erreichte, sah er sich eine von Seevögeln in Beschlag genommene Insel genauer an. Neben Eierschalen und Kadavern stach ihm ein feinkörniges Substrat ins Auge. Die Einheimischen sammelten es und behaupteten, es handle sich um die Hinterlassenschaften der Vögel. Humboldt, der wegen des hohen Ammoniakgehalts in der Luft einen Niesanfall nach dem anderen bekam, mochte das nicht glauben und vermutete einen weit zurückliegenden Ursprung, etwa eine antike Katastrophe.
Um auf Nummer sicher zu gehen, nahm er einige Proben mit nach Europa. Der Chemiker Louis-Nicolas Vauquelin, ein guter Freund Humboldts, untersuchte den Guano und fand darin eine beachtliche Konzentration stickstoffreicher Harnsäure. Versuche zeigten schließlich, dass die Substanz einen wesentlich besseren Dünger abgab als Kuh- oder Schweinedung. Äcker, die man damit impfte, ermöglichten eine ressourcenintensive Landwirtschaft und, als Folge, das Wachstum städtischer Bevölkerungen. Großbritannien importierte 1841 rund zwei Tonnen Guano aus Peru, zwei Jahre später waren es zweihundertzwanzigtausend Tonnen. Damals keine Schwierigkeit, denn es gab südamerikanische Inseln, auf denen sich die Exkremente mehr als sechzig Meter hoch türmten.
Der Naturschützer und Meeresökologe Joe Roman berichtet diese Episode in seinem Buch "Eat, Poop, Die", in dem er erläutert, wie "Tiere Ökosysteme gestalten, die von Pflanzen dominiert werden". Nutznießer ist oft genug der Mensch, der seine Eingriffe in die Natur gern als "moralische Mission" betrachtet. So waren Humboldts Zeitgenossen der Ansicht, gut gedüngte Böden kämen allen zugute, was natürlich stimmt, solange damit die "nördlichen Konsumenten von Fleisch und Zucker" gemeint sind. Gregory Cushman lässt das Anthropozän nicht umsonst 1830 beginnen, mit dem Jahr der ersten Lieferung von Nitratdünger.
Welchen Einfluss Vögel und ihre Ausscheidungen haben können, beobachten Forscher seit sechzig Jahren auf der Insel Surtsey. Sie liegt dreißig Kilometer vor der Südküste Islands und entstand vom 14. November 1963 an durch eine Serie submariner Vulkanausbrüche. In den ersten zehn Jahren war das Eiland nicht viel mehr als eine Einöde. Pflanzen, die dort hin und wieder Wurzeln schlugen, mussten mit einer phosphorreichen Umgebung und einem Mangel an Stickstoff zurechtkommen.
Das Nährstoffproblem sollte sich aber bald lösen, denn erste Interessenten wie Dreizehenmöwen und Eissturmvögel begannen, die Vorzüge der von Fressfeinden unangetasteten Insel zu entdecken. Insekten und Robben schauten ebenso vorbei. Mit ihrem Urin und Kot kam der Stickstoff - und mit dem Stickstoff die Vegetation. Dass das Element nicht aus der Atmosphäre nach Surtsey gelangt ist, belegten seine Isotope im Boden und in den Pflanzen: Zu neunzig Prozent stammte es von Seevögeln. In ihren Brutgebieten deponierten sie bis zu dreißig Pfund Stickstoff pro Hektar und Jahr. Zum Vergleich: Landwirte versorgen einen Hektar des Ackers mit rund neunzig Kilo Stickstoff.
Der Weg zur Pflanze beginnt oft in der Tiefsee. Dort vorhandene Nährstoffe können etwa von Pottwalen, die nach Riesenkalmaren tauchen, mitgenommen und an die Meeresoberfläche verfrachtet werden. Die Tiere scheiden enorme Schwaden an Fäkalien aus, die Stickstoff, Eisen und Phosphat enthalten. Daran bedienen sich Phyto- und Zooplankton. Der zur letzten Gruppe gehörende Krill wiederum wird von Fischen gefressen, die ihrerseits im Schnabel von Vögeln landen.
Ob Albatros oder Tölpel, Möwe oder Seeschwalbe, an Land füttern die Tiere den Nachwuchs mit einem Teil der eingesammelten Mahlzeit, und sie entledigen sich der stickstoffreichen Harnsäure. "Wir können diese Elemente", so Roman, "von der Tiefsee bis zu den Küsten, Flüssen, Wäldern, Savannen und Bergen der Welt verfolgen." Im Übrigen ist die Fischbiomasse auf Riffen mit Seevögeln erheblich höher als auf Riffen ohne Vögel. Denn die Vögel sind nicht nur Fressfeinde der Fische, sie bringen mit ihren Ausscheidungen auch Nährstoffe, die die Fische benötigen, um mehr Nachkommen zu zeugen.
Wenn Bäume die Lungen des Planeten sind, wird man Tiere dem Autor zufolge als sein schlagendes Herz betrachten dürfen. Vor nicht allzu langer Zeit lernte man im Biologieunterricht noch, Pflanzen und Mikroben seien die entscheidenden Akteure auf der Erde, sie gestalteten Ökosysteme und formten Landschaften. Roman illustriert, dass die Fauna hier bislang unterschätzt wurde, häufig sind ihre Mitglieder die "Quelle für Nährstoffe, die das Leben benötigt". Diese eingreifende Wirkung verdankt sich nicht bloß Fäkalien und den Kadavern verendeter Lebewesen, ebenso wichtig ist, dass Tiere Tiere fressen - und Pflanzen.
Der Biologe Oswald Schmitz hat das mit einem einfachen Experiment gezeigt. Auf verwilderten Feldern an der amerikanischen Ostküste brachte er rotbeinige Heuschrecken mit wandernden Spring- und ständig nach Opfern Ausschau haltenden Listspinnen zusammen. Die Springspinnen verspeisten die Pflanzenfresser, woraufhin die Pflanzen eine Erholungspause bekamen. Ein von Ökologen sogenanntes Top-down-Verfahren. Interessant wurde es, sobald die Heuschrecken die Listspinnen bemerkten. In deren Gegenwart verzehrten sie nämlich die Goldrute. Dabei dient ihnen genau diese Pflanze als Zufluchtsort. Die Erklärung: "Angst kurbelt den Stoffwechsel an", Listspinnen sind "ruhig und still, aber auch tödlich. Unter dem stetigen achtäugigen Blick der lauernden Räuber begannen die Heuschrecken, stressbedingt die kohlenstoffreiche Goldrute zu fressen, Kräuter, die ihre Eingeweide schneller füllten."
Schmitz hatte eine "Landschaft der Angst" erzeugt, in der allein die Gegenwart eines Feinds das Verhalten und die Physiologie der potentiellen Beute verändert. Mit der Goldrute als Kost - mehr Kohlenhydrate, weniger Stickstoff - bekamen der Kot der Tiere und ihre Überreste eine neue chemische Signatur. Dort, wo die gestressten Heuschrecken lebten und starben, hatte der Boden am Ende einen geringeren Stickstoffgehalt als bei entspannteren Nachbarn. Auf lange Sicht verlangsamt ein solcher Nährstoffmangel die Veränderungen in einer Gemeinschaft von Pflanzen.
Auch größere Tiere beeinflussen die Ökosysteme, in denen sie leben. In einem Gebiet, das Pumas zur Jagd auf Elche nutzen, schaffen die Katzen "nährstoffreiche Hotspots aus Stickstoff und Kohlenstoff", einerseits durch das von ihnen zurückgelassene Aas, andererseits durch ihren Kot und Urin. In solchen Arealen gedeihen stickstoffreiche Gewächse, die wiederum pflanzenfressende Tiere anziehen, deren Fäkalien und Leichen bald als Dünger zur Verfügung stehen.
Dieser als "trophische Kaskade" bezeichnete Ablauf ist durch den Yellowstone-Nationalpark bekannt geworden. Nachdem Wölfe dort wiederangesiedelt worden waren, verkleinerten sich die Elchherden. Die nun ängstlichen Tiere aus der Familie der Hirsche verweilten, sicher ist sicher, seltener an Bachläufen. Das kam den Weiden, Espen und Pappeln zugute, die weniger angeknabbert wurden und in Ruhe wachsen konnten. Daraufhin waren neben den Bibern auch die nach Nistmöglichkeiten suchenden Singvögel zur Stelle. Zudem profitierten Fische von den neuerdings schattigeren Gewässern.
So geht die oft kolportierte und weit über Spezialistenkreise hinaus bekannte Version der Geschichte. Der Biologe Matt Kauffman hegt da gewisse Zweifel. Als er an seiner Dissertation arbeitete, erhielt er ein Stipendium, um zu überprüfen, ob die Erzählung von den alles verändernden Wölfen im Nationalpark stimmt. Sein Fazit: "Es gab keinen Unterschied zwischen riskanten und sicheren Orten." Oswald Schmitz sagt dagegen, die Elche seien nach der Rückkehr der Wölfe "hypervigilant" gewesen, sie hätten laufend nach den neuen Räubern Ausschau gehalten, "was ihre Zeit zum Äsen verkürzte". Allerdings hätten sie bald gelernt, dass Wölfe vor allem in der Dämmerung aktiv sind - und sich fortan tagsüber den Bauch vollgeschlagen.
Joe Roman breitet nicht nur eine Fülle von erhellenden Zusammenhängen aus, er liefert die Quellen gleich mit und beschreibt obendrein, wie genau die vielen Wissenschaftler, die er getroffen hat, ihrer Arbeit nachgehen. Das gerät hier und da etwas langatmig, ist aber nur im Ausnahmefall anekdotischer Selbstzweck. Wenn Roman beispielsweise erklärt, warum eine Fichte, die an einem von Lachsen frequentierten Bach steht, dreimal schneller gedeiht als eine Artgenossin, der die Fische nie nahekommen sind, nimmt er sich ausreichend Zeit, um Aspekten der Biochemie und Populationsdynamik nachzugehen. Die eine oder andere abgestandene Pointe sieht der Leser ihm nach.
Ärgerlicher ist manche Schludrigkeit. Krähenscharben werden nicht, wie Roman schreibt, "auch Kormorane genannt"; vielmehr handelt es sich um eine eigene Art aus der Familie der Kormorane. Außerdem kommt der insgesamt versierte Übersetzer, Nikolaus Palézieux, mitunter ins Straucheln, wenn zoologische Genauigkeit gefragt ist. Die Gryllteiste heißt auf Englisch "Black guillemot", die Trottellumme "Guillemot". Im Kapitel über Surtsey heißt es: "Black guillemots returned from the sea". Deutsch: "Die Trottellummen kehrten aus dem Meer zurück." Das bringt die Argumentation nicht in Schieflage, ist jedoch auch keine Kleinigkeit.
Vor mehr als siebzig Jahren schrieb der amerikanische Biologe Eugene Odum in seiner Monographie "Fundamentals of Ecology", seine Kollegen sollten imstande sein zu demonstrieren, dass es ebenso viel Freude macht, die Biosphäre wieder ins Lot zu bringen, wie, ein Radio instandzusetzen. Einen ähnlichen Anspruch hat Joe Roman: "Die Wiederherstellung der Wildtierpopulationen könnte eines der besten naturbasierten Instrumente sein, die uns zur Bewältigung der Klimakrise zur Verfügung stehen." Nehmen wir etwa den Biber. Er verbessert nicht nur die Wasserqualität in seiner Umgebung: "Das Holz und die Sedimente, die sich in den feuchten Wiesen hinter Dämmen ansammeln, können über Hunderte von Jahren CO2 binden." Bleibt die Frage, wie realistisch die künftig blühenden Wildtiergemeinschaften sind, von denen Roman träumt. Denn jeder zehnte Vogel und jedes vierte Säugetier ist momentan vom Aussterben bedroht.
Joe Roman: "Eat, Poop, Die". Wie Tiere unsere Welt verändern.
Aus dem Englischen von Nikolaus Palézieux. Hanserblau Verlag, München 2024. 304 S., Abb., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








