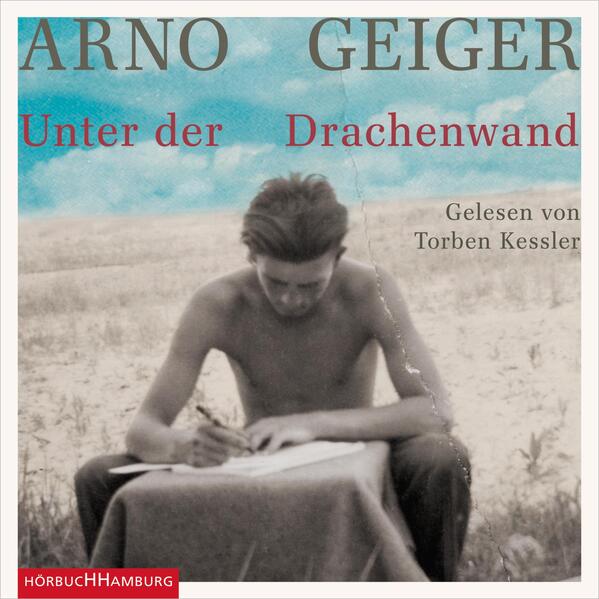
Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mondsee, 1944 - Leben und Lieben im Schatten der großen Geschichte
Veit Kolbe verbringt ein paar Monate am Mondsee, unter der Drachenwand, und trifft hier zwei junge Frauen. Doch Veit ist Soldat auf Urlaub, in Russland verwundet. Was Margot und Margarete mit ihm teilen, ist seine Hoffnung, dass irgendwann wieder das Leben beginnt. Es ist 1944, der Weltkrieg verloren, doch wie lang dauert er noch? Arno Geiger erzählt von Veits Alpträumen, vom »Brasilianer«, der von der Rückkehr nach Rio de Janeiro träumt, von der seltsamen Normalität in diesem Dorf in Österreich - und von der Liebe.
Ein herausragender Roman über den Einzelnen und die Macht der Geschichte, über die Toten und die Überlebenden, über das, was den Menschen und den Krieg ausmacht - gelesen von Torben Kessler.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Januar 2018
Sprache
deutsch
Auflage
4. Auflage, Ungekürzte Ausgabe
Ausgabe
Ungekürzt
Laufzeit
864 Minuten
Autor/Autorin
Arno Geiger
Sprecher/Sprecherin
Torben Kessler, Michael Quast, Cornelia Niemann, Torsten Flassig
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Produktart
CD
Audioinhalt
Hörbuch
Gewicht
245 g
Größe (L/B/H)
132/132/27 mm
GTIN
9783957131201
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 14.08.2023
Besser als erwartet. Spiel zur Kriegszeit, aber nicht an der Front.
LovelyBooks-Bewertung am 01.03.2023
Nach etwas zähme Einstieg ein wunderbarer Roman über die Schrecken des Krieges weitab vom Schlachtfeld. Berührend, bedächtig, eindrücklich.









