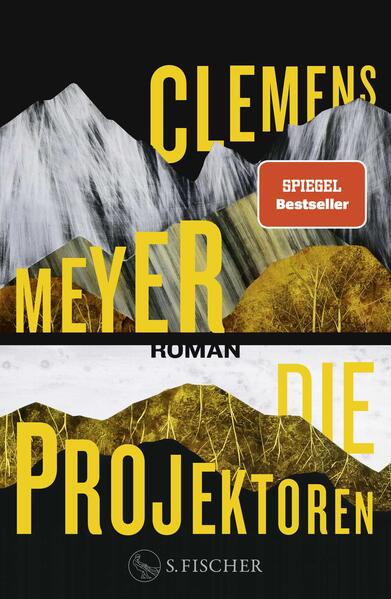
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der neue Roman von Clemens Meyer: Ein Epos über die Krisen Europas und die Kunst des Erzählens
Von Leipzig bis Belgrad, von der DDR bis zur Volksrepublik Jugoslawien, vom Leinwandspektakel bis zum Abenteuerroman. Schonungslos und rasant erzählt »Die Projektoren« von unserer an der Vergangenheit zerschellenden Gegenwart - und von unvergleichlichen Figuren: Im Velebit-Gebirge erlebt ein ehemaliger Partisan die abenteuerlichen Dreharbeiten der Winnetou-Filme. Jahrzehnte später finden an genau diesen Orten die brutalen Kämpfe der Jugoslawienkriege statt - mittendrin eine Gruppe junger Rechtsradikaler aus Dortmund, die die Sinnlosigkeit ihrer Ideologie erleben muss. Und in Leipzig werden bei einer Konferenz in einer psychiatrischen Klinik die Texte eines ehemaligen Patienten diskutiert: Wie gelang es ihm, spurlos zu verschwinden? Konnte er die Zukunft voraussagen? Und was verbindet ihn mit dem Weltreisenden Dr. May, der einst ebenfalls Patient der Klinik war?
Produktdetails
Erscheinungsdatum
28. August 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
1056
Autor/Autorin
Clemens Meyer
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1056 g
Größe (L/B/H)
226/147/53 mm
ISBN
9783100022462
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Wenn die Welt sich so weiterdreht, [ ], wird Die Projektoren zu den Romanen gehören, die lesende Menschen alle zehn Jahre erneut aus dem Regal nehmen, wie den Zauberberg . Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
Mit »Die Projektoren« hat der Märchenerzähler Clemens Meyer einen magischen, sprachgewaltigen Romankoloss hingestellt. Ein Oschi, der in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seinesgleichen sucht. Nils Kahlefendt, MDR Kultur
Clemens Meyer hat den rührendsten und grausamsten Roman der Saison geschrieben [. . .]. Christian Buß, Der Spiegel
[. . .] ein Roman, bei dem man nach der letzten Seite das Gefühl hat, ihn gleich noch einmal lesen zu müssen. Helmut Schneider, wien-live. de
Ein Buch aus der europäischen Champions League der Literatur [. . .]. Jobst-Ulrich Brand, Focus
Unser Roman des noch laufenden Jahres. Der Spiegel
[. . .] Meyer schafft es wirklich die ganz schwere Kost, aber auch mit der leichten Muse zu verbinden und man hat ne Menge Spaß mit diesem Buch. Katharina Teutsch, 3sat Kulturzeit
Keine Frage, Clemens Meyer hat ein echtes Meisterstück abgeliefert. Mario Scalla, WDR 3
Sprache und Erzählstil wechseln dabei wie ein wilder Fluss zwischen reißend und plätschernd, [. . .] machen spektakuläre Biegungen, fließen aber auch über lange Strecken gradlinig, [. . .] und überschaubar. Doris Akrap, taz
So gewaltig wie großartig. Focus
Ein Epos, ein Abenteuerroman. SWR Kultur
Das ist wirklich große Erzählkunst. Nadine Kreuzahler, rbb
[. . .] große Erzählkunst. Gerrit Bartels, Tagesspiegel
Eine Zeitenwende für die Literatur Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag
vermag es, das Chaos erzählend lustvoll zu bändigen. Niels Beintker, Südwestrundfunk/lesenswert
Clemens Meyers tausendseitiges wildes Epos ist eine Zumutung. Und das ist auch ziemlich gut so David Hugendick, Die Zeit
[. . .] Knaller der Saison [. . .]. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
Projektion ist indes das entscheidende Stichwort zum ambitioniertesten [. . .] deutschen Roman dieses Herbstes [. . .]. Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Mit »Die Projektoren« hat der Märchenerzähler Clemens Meyer einen magischen, sprachgewaltigen Romankoloss hingestellt. Ein Oschi, der in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seinesgleichen sucht. Nils Kahlefendt, MDR Kultur
Clemens Meyer hat den rührendsten und grausamsten Roman der Saison geschrieben [. . .]. Christian Buß, Der Spiegel
[. . .] ein Roman, bei dem man nach der letzten Seite das Gefühl hat, ihn gleich noch einmal lesen zu müssen. Helmut Schneider, wien-live. de
Ein Buch aus der europäischen Champions League der Literatur [. . .]. Jobst-Ulrich Brand, Focus
Unser Roman des noch laufenden Jahres. Der Spiegel
[. . .] Meyer schafft es wirklich die ganz schwere Kost, aber auch mit der leichten Muse zu verbinden und man hat ne Menge Spaß mit diesem Buch. Katharina Teutsch, 3sat Kulturzeit
Keine Frage, Clemens Meyer hat ein echtes Meisterstück abgeliefert. Mario Scalla, WDR 3
Sprache und Erzählstil wechseln dabei wie ein wilder Fluss zwischen reißend und plätschernd, [. . .] machen spektakuläre Biegungen, fließen aber auch über lange Strecken gradlinig, [. . .] und überschaubar. Doris Akrap, taz
So gewaltig wie großartig. Focus
Ein Epos, ein Abenteuerroman. SWR Kultur
Das ist wirklich große Erzählkunst. Nadine Kreuzahler, rbb
[. . .] große Erzählkunst. Gerrit Bartels, Tagesspiegel
Eine Zeitenwende für die Literatur Richard Kämmerlings, Welt am Sonntag
vermag es, das Chaos erzählend lustvoll zu bändigen. Niels Beintker, Südwestrundfunk/lesenswert
Clemens Meyers tausendseitiges wildes Epos ist eine Zumutung. Und das ist auch ziemlich gut so David Hugendick, Die Zeit
[. . .] Knaller der Saison [. . .]. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
Projektion ist indes das entscheidende Stichwort zum ambitioniertesten [. . .] deutschen Roman dieses Herbstes [. . .]. Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Besprechung vom 29.08.2024
Besprechung vom 29.08.2024
Opfer und Helden
Acht Jahre Arbeit stecken in diesem Roman, aber die Lektüre ist ein Vergnügen: Clemens Meyers "Die Projektoren" lässt Zeit- auf Literatur- und Filmgeschichte treffen und findet dazu in Karl May und den Verfilmungen seiner Abenteuergeschichten das richtige Ausgangsmaterial.
Wie sich einem Tausend-Seiten-Roman nähern? Zumal einem, der von Clemens Meyer stammt, der nicht bekannt ist für Erzählökonomie, sondern das Maßlose zu seinem Maßstab gemacht hat und sich deshalb in "Die Projektoren", dem neuen, nach achtjähriger Arbeit entstandenen Werk, inhaltlich am wohl maßlosesten aller deutschen Schriftsteller orientiert: Karl May. Der war bekanntlich ein gerichtsnotorischer Betrüger, bevor er in den Achtzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts zum Erfolgsautor wurde, und Meyer dichtet seinem sächsischen Landsmann und Namensnachbar zusätzlich auch noch einen späteren Aufenthalt in einer Leipziger Nervenklinik an, von der aus der Roman "Die Projektoren" seinen Anfang nimmt. Nicht dass May - "Dr. May", wie Meyer ihn konsequent nennt, obwohl auch dieser Titel angemaßt war - selbst aufträte, aber er ist die Bezugsgröße für das, was erzählt wird, und auch, wie es erzählt wird: prall, abenteuersatt, pathetisch. Und gläubig gegenüber der eigenen literarischen Berufung. Nur dass Meyer stets Künstler ist, wo May meist Handwerker war.
Aber diese Feststellungen sind noch keine Annäherungen, sondern eher Umwege zu dem, was "Die Projektoren" bietet. Deshalb gehen wir hinein, ziemlich ans Ende, knapp vor Seite 1000, und lesen dort über einen der Protagonisten des Romans, den zu diesem Zeitpunkt bereits siebenundachtzigjährigen Joven, den alle nur "Cowboy" nennen: "Er war Opfer und Held zugleich, hatte auf der Insel gesessen, war zuvor Meldegänger bei den Partisanen gewesen, hatte im Herbst 91 in und um V. gekämpft und eine Abteilung kommandiert, bevor er begriff, dass alles schieflief, alles den Bach runterging, nein, die Donau, die Sava und die Drina runter, er begriff, dass er weder für Jugoslawien noch für Serbien kämpfte, sondern dem Krieg und dem Wahnsinn den Weg bereitete." Dabei hatte Joven immer nur die besten Absichten. Aber die mussten im zwanzigsten Jahrhundert pervertiert werden, und genau das widerfährt allen Figuren dieses Buchs.
Man muss sie trotzdem lieben, so wie Meyer seinen Dr. May liebt. Der "Cowboy" im Roman ist eine Figur, wie sie auch die Abenteuerliteratur nur selten kennt, ein serbischer Lord Jim, der am Ende seines Lebens, das neue Jahrtausend ist da schon sechzehn Jahre alt, noch einmal aufbricht, um etwas aus dem alten Jahrtausend wiedergutzumachen. Ihn unterscheidet von den mayschen Helden, dass die nie etwas falsch gemacht haben oder auch nur falsch verstanden werden. Was Karl May schuf, das waren - mit seinem eigenen Wort - Edelmenschen. Doch ein Erdenrest der Kolportage, mit der May seine literarische Karriere begann, haftete ihnen beständig an. Aus diesem Erdenrest formt Meyer nun seine Hommage, und siehe da: Sie wird viel weniger Kolportage als die Vorbilder. Ohne an Lesevergnügen einzubüßen.
Letzteres deshalb, weil Meyer in der Tat Karl May gelesen hat und ihn seinem Roman verinnerlicht bis in einzelne Handlungsstränge, etwa eine ausgeheilte schwere Mundverletzung des Cowboys. Und Ersteres, weil Meyer sich mit May ja nicht gegen die literarische Moderne imprägniert hat, sondern vielmehr mit all deren Wassern gewaschen ist. Neben den von ihm oft als stilistische Ideale genannten Dos Passos, Hemingway oder Hilbig kommen hier ausgewiesenermaßen als weitere Inspiratoren hinzu Christa Wolf (der Meyer vor Anderthalbjahresfrist eine essayistische Liebeserklärung gewidmet hat), Céline, Malaparte, Ernst Jünger, Heiner Müller, Ivo Andric, Pasolini, Aleksandar Tisma - alles brillante, aber biographisch zwiespältige Autoren. Dazu das von ihm schon vor Erscheinen des neuen Romans als dessen Zielgebiet benannte literarische Terrain zwischen "Schwejk" und "Schiwago". Wie heißt es einmal in einem Vater-Sohn-Gespräch des Buchs: "Der Roman, wie ihn die Moderne versteht, ist ein Monolith, ein Chaos aus Stimmen . . ." Da hat Meyer den Figuren sein eigenes Schreibprogramm in den Mund gelegt.
Worum geht es aber nun in "Die Projektoren"? Unzulässig oberflächlich gesprochen: um die Geschichte Jugoslawiens. Da trifft es sich gut, dass die westdeutschen Karl-May-Verfilmungen der Sechzigerjahre alle in den jugoslawischen Karstlandschaften gedreht wurden, und Meyer schneidet immer wieder Kapitel ein, die davon erzählen, wie damals diese kapitalistischen Produktionen abliefen im blockfreien, aber sozialistischen Vielvölkerstaat, dessen Zusammenhalt nur durch die eiserne Hand von Marschall Tito garantiert wurde. Ein Empfang der Filmcrew beim Staatschef ist ein Fixpunkt des Romans, obwohl das viel weniger auserzählt wird als andere Episoden rund um die Dreharbeiten, an denen als Statist auch der Cowboy beteiligt ist. Und als Hauptdarsteller der amerikanische Schauspieler Lex Barker, der zum zweiten Protagonisten von "Die Projektoren" wird. Sein früh beendetes Leben - Barker starb gerade einmal vierundfünfzigjährig auf der Straße an einem Infarkt - bietet Meyer einen Imaginationsraum, in dem aus winzigen Details wie etwa den Werbeauftritten Barkers für die Karl-May-Filme, seinen letzten Stunden in New York oder dem Besuch in Belgrad große Szenen geformt werden, die sein Einzeldasein mit dem Zeitgeschehen engführen. Denn Meyer hat nicht weniger vor, als den Aberwitz der großen allgemeinen Geschichte in den beiden persönlichen Schicksalen von Barker und dem Cowboy zu spiegeln. Darum herum wird ein Panoptikum weiterer Akteure gruppiert, die Meyer teils aus den Filmbeteiligten rekrutiert, teils aus den Karl-May-Romanen und teils selbst erdichtet hat - um sie dann munter zu mischen, sodass etwa aus dem bei May "Schut" genannten Schurken, der fürs Kino von Rik Battaglia gespielt wurde, in den Wirren der jugoslawischen Teilungskriege, wie Meyer sie schildert, ein Bandenchef wird. Alle drei treten auf im Roman, aber sie sind nicht voneinander zu trennen.
Das klingt komplizierter, als es ist, auch wenn sich erst im Verlauf der tausend Seiten manches fügt, was man am Anfang hätte wissen mögen. Doch die Montage war schon immer Meyers literarisches Lieblingsinstrument, und wo wäre sie angebrachter als bei einem Roman, der wesentliche Teile seines Inhalts dem Filmgeschäft verdankt? Übrigens nur dem westeuropäischen; die ja auch nach anfänglichen ideologischen Bedenken entstandenen DDR-Karl-May-Verfilmungen spielen überraschenderweise so gut wie keine Rolle. Stattdessen hat "Die Projektoren" seinen Höhepunkt in einem Aufenthalt des Winnetou-Darstellers Pierre Brice in den USA, bei dem die Inkommensurabilität von persönlicher und politischer Geschichte, von Edelmenschenanspruch und Ekelmenschenrealität eine Burleske erzeugt, die einfach grandios ist. Aber weil Meyer noch mehr will als geistreiche Unterhaltung, bietet er diesen süffigsten Abschnitt des Romans in einzeln nummerierten Sätzen dar: unter der Kapitelüberschrift Zweihundertdreiundneunzig Sätze über Winnetous Reise nach Wounded Knee im März 1973, als die Gedenkstätte von Aktivisten des American Indian Movement besetzt gehalten wurde, um Amerika und die Welt an die Missstände in den Reservationen und die zweihundertdreiundneunzig indigenen Opfer des Massakers von 1890 zu erinnern". Aber ist es nicht vielmehr Meyer selbst, der durch die Zahl seiner Sätze diese Erinnerungsarbeit in Gang setzt? Noch im witzigsten Teil des Romans stecken großer Ernst und Anspruch.
Wie nähert man sich ihm also am besten? Mit Neugier und Spielfreude. Karl-May-Kenntnisse schaden nicht. Literaturliebe nutzt sogar massiv. Wie ja generell. ANDREAS PLATTHAUS
Clemens Meyer: "Die Projektoren". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2024.
1049 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.01.2025
Exzessiv, vielschichtig
Ein gewaltiges Werk von über eintausend beschriebenen Seiten präsentiert uns Clemens Meyer in seinem Roman 'Die Projektoren'. Es geht um den Krieg in Jugoslawien, um einen Partisanen, der sich später sein Geld als Komparse bei Indianerfilmen verdient. Wir begegnen einem Neonazi, der in den kroatischen Bürgerkrieg zieht. Auch Dr. May aus der Leipziger Heil- und Pflegeanstalt wird thematisch behandelt.Es ist ein Sammelsurium an Handlungsstränge, die sich zeitlich zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Heute bewegen, über Gewalt und Krieg berichtet und Historien mit Karl Mays Erfindungsreichtum paart.Dieser Roman verlangt nach Ausdauer.
LovelyBooks-Bewertung am 26.12.2024
Ein großer Roman. Und endlich mal wieder ein Buch, das nicht nur nach innen schaut.










