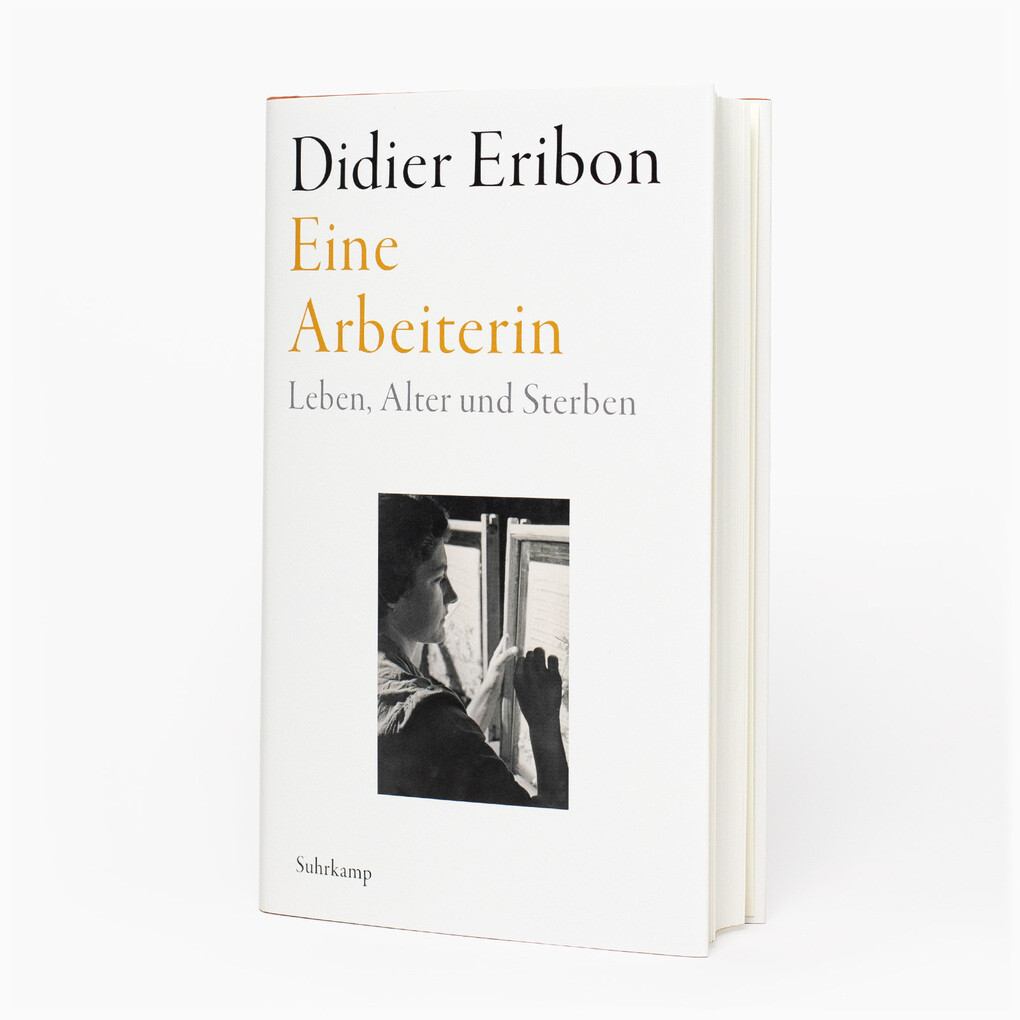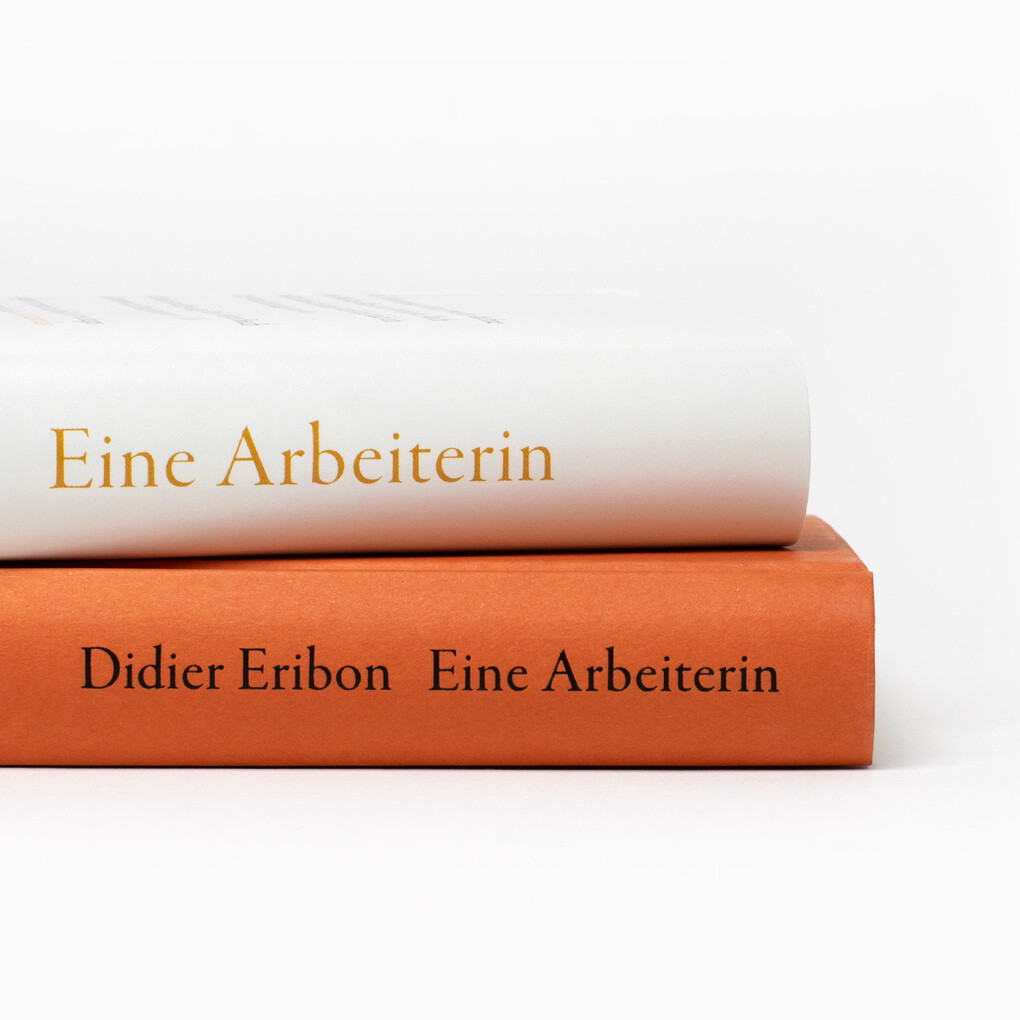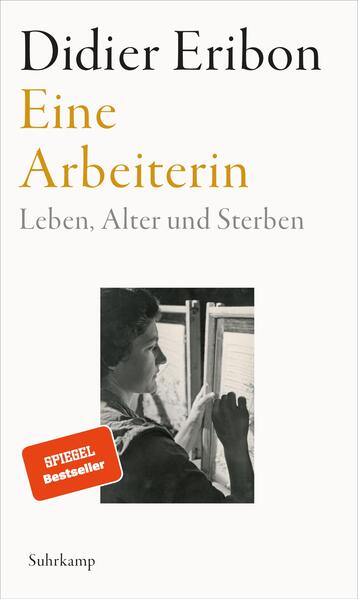
Zustellung: Mo, 02.12. - Mi, 04.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Das ist also das Leben meiner Mutter gewesen, dachte ich, das Leben und das Alter einer Arbeiterin. Noch wusste ich nicht, dass ich dieser Aufzählung bald ein drittes Wort würde hinzufügen müssen. «
Eigentlich hatte Didier Eribon sich vorgenommen, ab jetzt regelmäßig nach Fismes zu fahren. Doch seine Mutter stirbt wenige Wochen nach ihrem Umzug in ein Pflegeheim in dem kleinen Ort in der Champagne. Wie in Rückkehr nach Reims wird dieser Einschnitt zum Ausgangspunkt für eine Reise in die Vergangenheit. Eribon rekonstruiert die von Knappheit und Zwängen bestimmte Biografie einer Frau, die an einen brutalen Ehemann gekettet blieb und sich sogar in ihren Träumen bescheiden musste. »Meine Mutter«, hält er fest, »war ihr ganzes Leben lang unglücklich. «
Didier Eribons neues Buch ist hochpolitisch: Er legt schonungslos dar, wie sehr die Politik, aber auch die Philosophie, ja wir alle die skandalöse Situation vieler alter Menschen lange verdrängt haben. Zugleich erweist er sich erneut als großer Erzähler: Anhand suggestiver Episoden und berührender Erinnerungen zeigt er, wie wichtig Familie und Herkunft für unsere Identität sind. Er kauft ein Dialekt-Wörterbuch, um noch einmal die Stimme seiner Mutter im Ohr zu haben. So entfaltet der Soziologe das Porträt einer untergegangenen Welt: des Milieus der französischen Arbeiterklasse - mit ihren Sorgen, ihrer Solidarität, ihren Vorurteilen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
10. März 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
272
Autor/Autorin
Didier Eribon
Übersetzung
Sonja Finck
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Gewicht
384 g
Größe (L/B/H)
211/133/26 mm
ISBN
9783518431757
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Super Mix aus packendem Roman und Gesellschaftsanalyse. « Stefan Hochgesand, Berliner Zeitung
»Das Brillante an [Eribons] neuem Buch ist, dass er beiden Seiten Rechnung trägt. Die ersten Teile sind in einfacher Sprache geschrieben, und er bringt sogar eine Hommage an den Dialekt der Champagne unter, den seine Mutter sprach. . . . Auf der anderen Seite zieht er im letzten Teil des Buchs aber auch alle Register seines Status als einer der berühmtesten soziologischen Wissenschaftler seines Landes . . . « Max Florian Kühlem, Berliner Zeitung
»Nein, ein verklärendes Mutterbuch ist Eine Arbeiterin nicht geworden, überhaupt ist es ein Buch, das einfache Analysen vermeidet und gerade deshalb zum Nachdenken anregt. « Nina Apin, taz. die tageszeitung
»Wie wenig dieser zum Etikett gewordene Begriff [des autofiktionalen Schreibens] in der Lage ist, die Resultate von Eribons Schreibvorgang zu erfassen, lässt sich an Eine Arbeiterin zeigen. Und zwar deshalb, weil es einfach unangemessen scheint, der würdevollen Schönheit dieses Textes mit einem routinierten Lob auf den Leib rücken. « Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
». . . ein glänzend erzähltes und ergreifendes Buch. Es erschafft einen Raum für Nachdenklichkeit und Trauer und für die große Frage, wie man in Gesellschaften wie der unseren mit Alter und Sterben umgeht. « Meike Feßmann, Der Tagesspiegel
»Das Buch ist voller Stärken in der Analyse, der Genauigkeit der Beschreibungen, der Fülle der Bezüge und Zitate und doch eine Hymne an die Schwäche. . . . Es arbeitet weiter noch lange nach der letzten Seite. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung
»Klug, lehrreich, sprachgewaltig. Didier Eribons Buch ist eine Zeremonie des Abschiednehmens. « L Obs
»Soziologisch, sensibel und literarisch. Ein wichtiges Buch, wie man es nur selten liest. « Les Inrockuptibles
»In suggestiven Episoden und Szenen erzählt Eribon vom Leben einer Frau, die von früh an zu Putzfron und Fabrikarbeit gezwungen war und schon mit zwanzig Jahren an einen brutalen, gewalttätigen ungeliebten Mann, einen Hilfsarbeiter, gekettet war. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Die Passagen über ihre Arbeit in der Fabrik, ihre Politisierung, ihren obsessiven Rassismus, über die Rolle des Fernsehens oder ihren Dialekt gehören zum Intensivsten, was in den letzten Jahren über Elternschaft geschrieben wurde. « Deutschlandfunk Kultur
»Ein facettenreiches Mutterporträt, das durch die Doppelperspektive aus emotionaler autobiografischer Erzählung und kühler soziologischer Analyse überzeugt. « SWR2 lesenswert Magazin
»Wie schon in seinem Bestseller Rückkehr nach Reims (2009) gelingt es Eribon auch hier wieder, die individuelle Beziehung einzubetten in eine Analyse der sozialen Verhältnisse, die diese Beziehung rahmen. Didier Eribons besondere Gabe ist die Verschränkung von kühler Analyse mit großer Empathie. « Die Tageszeitung
»Seinem flammenden Plädoyer für eine Mündigkeit der Alten die gleichwohl jemandes bedürfen, der für sie spricht kommt umso mehr Bedeutung zu, als Millionen von Boomern jedweden Geschlechts demnächst in den Spätherbst ihres Lebens eintreten werden. « Der Standard
»Wie in Rückkehr nach Reims verbindet der Autor eigenes Erleben und Erinnern, Analyse und Philosophie zu einer um gedankliche Klarheit ringenden Darstellung der sozialen Realität eines Lebens, und zwar des Lebens seiner Mutter. « NZZ am Sonntag
»[Ein] großer Essay. « Frank Schäfer, junge Welt
»Das Brillante an [Eribons] neuem Buch ist, dass er beiden Seiten Rechnung trägt. Die ersten Teile sind in einfacher Sprache geschrieben, und er bringt sogar eine Hommage an den Dialekt der Champagne unter, den seine Mutter sprach. . . . Auf der anderen Seite zieht er im letzten Teil des Buchs aber auch alle Register seines Status als einer der berühmtesten soziologischen Wissenschaftler seines Landes . . . « Max Florian Kühlem, Berliner Zeitung
»Nein, ein verklärendes Mutterbuch ist Eine Arbeiterin nicht geworden, überhaupt ist es ein Buch, das einfache Analysen vermeidet und gerade deshalb zum Nachdenken anregt. « Nina Apin, taz. die tageszeitung
»Wie wenig dieser zum Etikett gewordene Begriff [des autofiktionalen Schreibens] in der Lage ist, die Resultate von Eribons Schreibvorgang zu erfassen, lässt sich an Eine Arbeiterin zeigen. Und zwar deshalb, weil es einfach unangemessen scheint, der würdevollen Schönheit dieses Textes mit einem routinierten Lob auf den Leib rücken. « Cord Riechelmann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
». . . ein glänzend erzähltes und ergreifendes Buch. Es erschafft einen Raum für Nachdenklichkeit und Trauer und für die große Frage, wie man in Gesellschaften wie der unseren mit Alter und Sterben umgeht. « Meike Feßmann, Der Tagesspiegel
»Das Buch ist voller Stärken in der Analyse, der Genauigkeit der Beschreibungen, der Fülle der Bezüge und Zitate und doch eine Hymne an die Schwäche. . . . Es arbeitet weiter noch lange nach der letzten Seite. « Nils Minkmar, Süddeutsche Zeitung
»Klug, lehrreich, sprachgewaltig. Didier Eribons Buch ist eine Zeremonie des Abschiednehmens. « L Obs
»Soziologisch, sensibel und literarisch. Ein wichtiges Buch, wie man es nur selten liest. « Les Inrockuptibles
»In suggestiven Episoden und Szenen erzählt Eribon vom Leben einer Frau, die von früh an zu Putzfron und Fabrikarbeit gezwungen war und schon mit zwanzig Jahren an einen brutalen, gewalttätigen ungeliebten Mann, einen Hilfsarbeiter, gekettet war. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Die Passagen über ihre Arbeit in der Fabrik, ihre Politisierung, ihren obsessiven Rassismus, über die Rolle des Fernsehens oder ihren Dialekt gehören zum Intensivsten, was in den letzten Jahren über Elternschaft geschrieben wurde. « Deutschlandfunk Kultur
»Ein facettenreiches Mutterporträt, das durch die Doppelperspektive aus emotionaler autobiografischer Erzählung und kühler soziologischer Analyse überzeugt. « SWR2 lesenswert Magazin
»Wie schon in seinem Bestseller Rückkehr nach Reims (2009) gelingt es Eribon auch hier wieder, die individuelle Beziehung einzubetten in eine Analyse der sozialen Verhältnisse, die diese Beziehung rahmen. Didier Eribons besondere Gabe ist die Verschränkung von kühler Analyse mit großer Empathie. « Die Tageszeitung
»Seinem flammenden Plädoyer für eine Mündigkeit der Alten die gleichwohl jemandes bedürfen, der für sie spricht kommt umso mehr Bedeutung zu, als Millionen von Boomern jedweden Geschlechts demnächst in den Spätherbst ihres Lebens eintreten werden. « Der Standard
»Wie in Rückkehr nach Reims verbindet der Autor eigenes Erleben und Erinnern, Analyse und Philosophie zu einer um gedankliche Klarheit ringenden Darstellung der sozialen Realität eines Lebens, und zwar des Lebens seiner Mutter. « NZZ am Sonntag
»[Ein] großer Essay. « Frank Schäfer, junge Welt
 Besprechung vom 07.03.2024
Besprechung vom 07.03.2024
Ich war ein Sohn, jetzt bin ich keiner mehr
Perspektivenwechsel bei Didier Eribon: Sein neues Buch prangert am Beispiel seiner Mutter die gezielte Vernachlässigung alter Menschen an.
Nachdem sein früherer "Ziehsohn" und heutiger Freund Édouard Louis vor zwei Jahren mit "Die Freiheit einer Frau" ein berührendes Buch über seine Mutter vorgelegt hat, folgt jetzt dessen Mentor und Vorbild diesem Beispiel und legt vierzehn Jahre nach "Rückkehr nach Reims", der gnadenlosen Abrechnung mit Vater und Herkunftsmilieu, ein ihr gegenüber versöhnliches Buch über seine Mutter vor, in dem es vor allem um deren Alter und Sterben geht. Und um die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen dies stattfindet.
Didier Eribon, der französische Philosoph und Soziologe, Schüler des Sozialphilosophen Pierre Bourdieu, hat mit dem großen Erfolg seines Erstlings das autofiktionale Schreiben auch hierzulande bekannt und populär gemacht und dadurch nicht zuletzt im deutschsprachigen Raum für die Rezeption des Werks der von ihm und Édouard Louis verehrten Annie Ernaux gesorgt, auf deren Vorbild sich beide berufen. Wie schon in "Rückkehr nach Reims" beschreibt Eribon die Welt und das Leben des ehemals linkskommunistischen und stark gewerkschaftlich organisierten Industrieproletariats von Nordfrankreich - eine Welt, die es längst nicht mehr gibt, ein Milieu, das heute von Arbeitslosigkeit, Armut und Chancenlosigkeit geprägt und seit Jahren Nährboden für rechtsradikale Positionen ist. Immer wieder bringt er Beispiele eines fröhlich-unbekümmerten Rassismus seiner Mutter, für die er sich schämt.
Eigentlicher Schreibanlass ist aber Eribons Trauer über den körperlichen Verfall und das qualvolle geistige Verdämmern seiner Mutter und die Wut über ihr unwürdiges Sterben in einer Pflegeeinrichtung. Wieder verknüpft er persönliche Erfahrungen mit der Analyse der gesellschaftlichen Zustände, sieht im Individuellen das Gesellschaftliche, im Privaten das Politische. Den eigenen Schmerz über den Verlust der "Archivarin und Historikerin einer Jugend" - seiner Jugend - verwandelt er in eine Zeitreise in die Vergangenheit. Mit dem Tod der Mutter geht ein Riss durch die eigene Identität: "Ich war ein Sohn, jetzt bin ich keiner mehr." Der Erfahrungsbericht wird zur sozialen Psychoanalyse. Nachdem es nach dem Tod des Vaters und vor allem in den letzten beiden Lebensjahren versöhnliche Gesten der Wiederannäherung gegeben hatte, ein Sich-Wiederfinden, Sich-neu-Finden, werden das erbärmliche mütterliche Dahinsiechen im Pflegeheim und ihr einsamer Tod zum Anlass, die Stationen dieses prekären Lebens aufzublättern.
In suggestiven Episoden und Szenen erzählt Eribon vom Leben einer Frau, die von früh an zu Putzfron und Fabrikarbeit gezwungen war und schon mit zwanzig Jahren an einen brutalen, gewalttätigen ungeliebten Mann, einen Hilfsarbeiter, gekettet war. An Trennung kann sie 55 Jahre lang zwar ständig denken, sie durchführen kann aber nicht - aus Angst, das wenige an sozialer Absicherung, das sie hat, auch noch zu verlieren, und aus Angst vor seiner Rache. Nach acht Stunden Fabrikarbeit ruhte sie sich fünfzehn Minuten im Sessel aus, danach begann ihr zweiter Arbeitstag: einkaufen, kochen, Geschirr spülen . . . Als Entlastung für die lebenslangen Demütigungen nur obsessiver Fernsehkonsum: "Es hob den Unterschied zwischen Realität und Fiktion auf, zwischen wahr und falsch, zwischen Vergangenheit und Gegenwart; es ignorierte die unerbittlichen Determinierungen durch Klasse, Geschlecht und Alter." Eribons Mutter liebt die Formel 1 und imaginiert sich eine Vergangenheit, da sie sich Zukunft nicht mehr vorstellen kann: "Reglos in ihrem Sessel, mit der Fernbedienung in der Hand, saß sie am Steuer eines Rennautos."
"Meine Mutter war ihr Leben lang unglücklich", lautet die bittere Bilanz des Sohnes, den sie nicht vor der Homophobie des Milieus hatte beschützen können und dessen sozialen Aufstieg in die Bildungselite der Hauptstadt sie nur ungläubig und misstrauisch verfolgen konnte. Als er ihr Shalimar, ein teures Parfum, schenkt, verschmäht sie es. Diese Habitus-Schranke war nicht zu überwinden. "Er hört neuerdings Klassik, man kommt sich vor wie in der Kirche", ist noch einer ihrer netteren Kommentare. Überhaupt kann der Sohn verbale Entgleisungen nur andeuten, vor der wörtlichen Wiedergabe sträubt sich seine Feder. Nach ihrem Tod allerdings kauft er sich ein Lexikon des Dialekts der Champagne, eine Art tragbares Archiv, um ihre Stimme zu hören, ihr sprachlich nahe zu sein, sie und sich nicht endgültig zu verlieren, nachgetragene Liebe.
Der Hauptakzent dieser autofiktionalen Recherche liegt aber auf der allerletzten Lebensphase, als sie "kraftlos, entschluss- und verantwortungslos" aus der Zeit fällt, in eine "Unzeit" stürzt. Auch die Dinge rücken von ihr weg, entfernen sich von ihr. Sie unternimmt Erkundungsreisen durch verschiedene Schichten dessen, was Christa Wolf als "innere Archäologie" bezeichnet. Der Sohn versucht, diesem Verfall zu begegnen; die Schilderungen seiner Bemühungen, eine adäquate Unterbringung und Betreuung seiner Mutter zu finden, sind eine einzige Anklage des Systems im Umgang mit Alter und Krankheit. Eribon sieht in der strukturellen Misshandlung und institutionellen Gewalt schwere Verletzungen der Grundrechte alter Menschen.
Schon Annie Ernaux hatte 1997 in ihrem Buch über die Demenzerkrankung ihrer Mutter, "Je ne suis pas sortie de ma nuit", das immer noch nicht auf Deutsch vorliegt, vom entwürdigenden Umgang mit alten und dementen Menschen berichtet: Gitterbetten, Fesselung auf dem Stuhl, verschlossene Schränke, Duschverbot aus Personalmangel, niemand, um sie aus dem Bett zu heben, nicht gewechselte Windeln, keine Neubeschaffung verlorener Brillen oder Zahnprothesen et cetera. Im Französischen spricht man von einem "syndrome du glissement", dem Verlust an Lebensenergie schon in den ersten Wochen einer endgültigen stationären Unterbringung, einem unbewussten Selbstmord. Verloren in Raum und Zeit, gefangen im Gitterbett, ruft die Mutter Nacht für Nacht ihren Sohn an: "Ich werde hier misshandelt." Schließlich verweigert sie zwei Wochen lang Essen und Trinken und "lässt sich sterben".
Eribon untermauert seine Anklage mit reichlich statistischem Material, das uns aufschrecken und endlich einen gesellschaftlichen Diskurs einleiten soll. Ein großes Verdienst ist auch sein Verweis auf den schon 1970 erschienenen ungeheuer materialreichen Essay "Das Alter" von Simone de Beauvoir, der leider nicht wie ihr Standardwerk "Das andere Geschlecht" zum Longseller wurde. Während dieses Buch der Frauenbewegung zu einem Wir und selbstbewusster Identität verhalf, will sich in einer leistungs- und profitorientierten Gesellschaft kaum jemand mit Alter und Sterben befassen, die Alten und Kranken können kein Wir mehr bilden, haben keine Lobby.
Auch ein weiteres wiederzuentdeckendes Werk zitiert Eribon häufig: Norbert Elias' "Über die Einsamkeit der Sterbenden", 1982 erschienen. Der jüdische Soziologe sieht die Einsamkeit der Sterbenden eingebettet in einen umfassenden Prozess der kollektiven Vereinsamung und der Anonymisierung des Lebens, von Sprachlosigkeit und Gefühlsverarmung gezeichnet.
Eribon sieht sich selbst als Sprecher seiner Mutter und der "Leute, die in der gleichen Situation sind, wie sie es war, kurz bevor sie starb". Wie Simone de Beauvoir schon wusste: "Und das ist der Grund, weshalb ich dieses Buch schreibe: um die Verschwörung des Schweigens zu brechen." BARBARA VON MACHUI
Didier Eribon:
"Eine Arbeiterin". Leben, Alter und Sterben.
Aus dem Französischen von Sonja Finck. Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 240 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.