Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr Ostergeschenk: 15% Rabatt auf viele Sortimente11 mit dem Code OSTERN15
Jetzt einlösen
mehr erfahren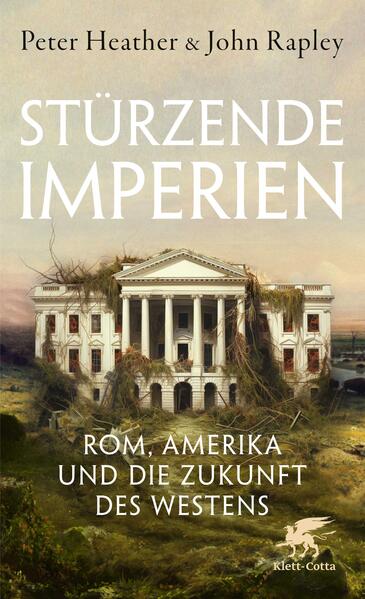
Zustellung: Fr, 04.04. - Mo, 07.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Was wir vom Untergang Roms für die Zukunft des Westens lernen können
Der Westen befindet sich in einer Krise: Unsere Demokratie ist angeschlagen, die Deindustrialisierung bedroht den Wohlstand und Flüchtende machen sich auf in westliche Länder und stehen vor den Toren. In diesem außergewöhnlichen historischen Vergleich erkunden die Autoren die unheimlichen Parallelen - und produktiven Unterschiede - zwischen dem Untergang Roms und dem Fall des Westens, um aus der antiken Geschichte neue Lehren zu ziehen. Die Ära der westlichen globalen Dominanz hat ihr Ende erreicht - doch was kommt als Nächstes?
In den letzten drei Jahrhunderten stieg der Westen auf, um den Planeten zu dominieren. Doch plötzlich, um die Jahrtausendwende, kehrte sich die Geschichte um. Angesichts wirtschaftlicher Stagnation und innerer politischer Spaltung befindet sich der Westen in einem rapiden Niedergang. Es ist nicht das erste Mal, dass die globale Ordnung einen solch dramatischen Aufstieg und Fall erlebt. Das Römische Reich folgte einer ähnlichen Entwicklung von überwältigender Macht bis zum Zerfall - eine Tatsache, die mehr ist als ein seltsamer historischer Zufall. In diesem fesselnden Buch nutzen der Historiker Peter Heather und der politische Ökonom John Rapley diese römische Vergangenheit, um über den zeitgenössischen Westen, seinen Zustand der Krise und mögliche Wege heraus neu nachzudenken.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. Juli 2024
Sprache
deutsch
Auflage
5. Druckaufl., 2025
Seitenanzahl
288
Autor/Autorin
Peter Heather, John Rapley
Übersetzung
Thomas Andresen
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
372 g
Größe (L/B/H)
205/134/30 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag, mit Karten
ISBN
9783608982367
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Historische Analyse, scharfe Gegenwartsdiagnose und (gemäßigter) Zukunftsoptimismus: selten sind sie so trefflich vereint wie in diesem Buch. «Uwe Walter, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 08. Oktober 2024 Uwe Walter, FAZ
»Peter Heather und John Rapley schreiben mitten ins Herz der Gegenwart, und es liest sich wie ein Leitartikel im Guardian. «Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung, 02. September 2024 Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
»Ihr Buch [ist] unbedingt lesenswert. Viele Parallelen, die sie entwerfen, sind unmittelbar einleuchtend. Interessant ist ihre Studie nicht zuletzt wegen der komprimierten, lebendigen Schilderung der Spätphase des Römischen Reichs. «Jens Balzer, Deutschlandfunk Kultur, 26. August 2024 Jens Balzer, Deutschlandfunk Kultur
»Peter Heather und John Rapley haben ein paar kluge neue Ideen, weshalb das Römische Imperium scheiterte. «Herfried Münkler, Die Zeit, 13. Oktober 2024 Herfried Münkler, Die Zeit
»Ein äußerst erkenntnisreiches Buch! «Pforzheimer Zeitung, 06. August 2024 Pforzheimer Zeitung
»Peter Heather und John Rapley schreiben mitten ins Herz der Gegenwart, und es liest sich wie ein Leitartikel im Guardian. «Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung, 02. September 2024 Gustav Seibt, Süddeutsche Zeitung
»Ihr Buch [ist] unbedingt lesenswert. Viele Parallelen, die sie entwerfen, sind unmittelbar einleuchtend. Interessant ist ihre Studie nicht zuletzt wegen der komprimierten, lebendigen Schilderung der Spätphase des Römischen Reichs. «Jens Balzer, Deutschlandfunk Kultur, 26. August 2024 Jens Balzer, Deutschlandfunk Kultur
»Peter Heather und John Rapley haben ein paar kluge neue Ideen, weshalb das Römische Imperium scheiterte. «Herfried Münkler, Die Zeit, 13. Oktober 2024 Herfried Münkler, Die Zeit
»Ein äußerst erkenntnisreiches Buch! «Pforzheimer Zeitung, 06. August 2024 Pforzheimer Zeitung
 Besprechung vom 08.10.2024
Besprechung vom 08.10.2024
Spätrömische Folie zum Verständnis der Gegenwart
Der Westen in Großaufnahme: Peter Heather und John Rapley untersuchen, was aus der Entwicklung von Imperien zu lernen sein könnte
Was hält Imperien am Laufen? Wie lassen sie sich durch allen Wandel hindurch stabilisieren? Warum scheitern sie dennoch? Was ist daraus für das eigene politische Handeln zu lernen? Wahrscheinlich sind solche Fragen dort virulenter, wo für lange Zeit eine solche Formation existierte oder in veränderter Gestalt noch besteht, also in England und den USA. Doch das Buch, das Peter Heather als Spätantikeforscher und Peter Rapley als politischer Ökonom mit Schwerpunkt auf Globalisierungen gemeinsam verfasst haben, verdient auch hierzulande Beachtung. Denn Edward Gibbons zur Zeit der Aufklärung vorgetragene Deutung, das Römische Reich sei an innerer Erschöpfung, Dekadenz und Überfremdung zugrunde gegangen, dient in plakativen Vergleichen noch immer als Menetekel für die Zukunft des "Westens".
Heather und Rapley wenden sich freilich nicht gegen die Vergleichbarkeit der beiden historischen Großformationen schlechthin, vielmehr entwerfen sie ein subtiles Verlaufs- und Transformationsmodell. Dadurch könne eine neu interpretierte spätrömische Geschichte zu einem alternativen, dekolonisierten Verständnis der gegenwärtigen Lage beitragen.
Auch wer die Analogien in den Strukturen und Prozessen für weniger tragfähig hält, als die Verfasser dies tun, gewinnt eine Fülle kluger Einsichten in die beiden verglichenen Formationen. So sind Zusammenhalt und Wohlstandsniveau des Römischen Reiches nicht an dessen kartographisch schon erheblicher Ausdehnung zu messen: Der eigentliche Maßstab für Entfernungen ist die Zeitspanne, die man benötigte, um von A nach B zu gelangen, nicht ein willkürliches Längenmaß. So gesehen lagen Orte im Römischen Reich um ein Vielfaches weiter voneinander entfernt, als sie uns heute erscheinen, und das Reich war entsprechend erheblich größer. Wenn gleichwohl ländliche Besiedlung und Wohlstand so gut wie überall im vierten nachchristlichen Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichten, in den Kalksteinhügeln Nordsyriens, im südlichen Britannien, in Gallien, Spanien, Nordafrika, Griechenland oder Anatolien, so ist das ein durchaus beeindruckender Befund.
Und wie Rapley die Mechanismen und Häutungen der "westlichen" Dominanz als Verfügung über Arbeitskräfte, Rohstoffe und leitende Ideen vom Spätmittelalter über die verschiedenen Imperienbildungen bis hin zur 1944 in Bretton Woods definierten Weltwirtschaftsordnung - in der die Ressourcenströme aus der alten imperialen Peripherie der globalen Ökonomie weiterhin in die westlichen Zentren flossen - und Bill Clintons triumphalistische Rede zur Lage der Nation 1999 nachzeichnet, mithilfe von Zahlen wie durch biographische Vignetten zu exemplarischen Akteuren, das ist ein Kabinettstück.
Doch auch der Vergleich hat gute Argumente auf seiner Seite. Begreife man das Römische Reich und den "Westen" als langlebige, sich entwickelnde imperiale Systeme, dann sei ihre politische Entwicklung gar nicht so unterschiedlich, wie es auf den ersten Blick erscheine. Das Imperium Romanum entstand durch Eroberung, entfaltete sich aber zu einem weithin dominierenden Gemeinwesen, dessen Basis gemeinsame Kultur-, Finanz- und Rechtsstrukturen waren. Sein modernes Pendant ging aus heftigen Konflikten zwischen den späteren Partnern hervor, konnte Ende des zwanzigsten Jahrhunderts jedoch in ähnlicher Weise als ein sich selbst identifizierendes Gebilde gesehen werden, das sich über geteilte Werte sowie eine Reihe von Rechts- und Finanzinstitutionen definierte, die globale Geltung beanspruchten.
Woher dann aber die jähe Peripetie? Am Anfang des imperialen Lebenszyklus stehen jeweils wirtschaftliche Entwicklungen: Reiche werden formiert, um Wohlstandsströme in den dominierenden Kern zu lenken. Dieser Prozess erzeugt indes auch einen - freilich sehr ungleich verteilten - sekundären Wohlstand und ungekannte Chancen in den eroberten Gebieten sowie in peripheren Regionen, die nicht unbedingt formell kolonisiert, aber durch Wirtschaftsbeziehungen mit dem Kern verbunden sind. Die ökonomischen Veränderungen bleiben nicht ohne politische Folgen, da jede Konzentration und jeder Fluss von Reichtum potentielle Bausteine für neue politische Macht schaffen, die sich entschlossene, lernfähige Akteure zunutze machen können.
Das imperiale Zentrum, das die Prozessdynamik einst in Gang setzte, und seine dominante Stellung werden in der Folge zwangsläufig herausgefordert; die Steuerungshoheit im Gesamtgefüge geht verloren, und es komme dann darauf an, wie flexibel und kreativ auf die neuen Mitspieler und Herausforderungen reagiert wird. Im römischen Fall wurde durch das Gefälle und den Austausch zwischen Zentrum, innerer und äußerer Peripherie das "Außen" neu strukturiert und boten neue, größere militarisierte Verbände ihren Anführern ungeahnte Chancen, zu Wohlstand und Macht zu kommen.
In der Moderne stiegen nach dem Scheitern antikolonialen Widerstands vielerorts neue Eliten auf, die sich besser an die Technologien und Praktiken des jeweiligen Imperiums anzupassen verstanden - eingeschlossen die Übernahme von Elementen aus der Kultur und Rhetorik des europäischen Kerngebiets, wie den Ruf nach nationaler Unabhängigkeit. Wo sie nicht durch wirtschaftliche Interessen an das Zentrum gebunden waren, konnten diese Akteure leichter Alternativen denken. Unter Stress gesetzt wurden beide Imperien durch äußere Herausforderungen: die Migration der Hunnen von jenseits der äußeren Peripherie des Römischen Reiches beziehungsweise die beiden Weltkriege im zwanzigsten Jahrhundert. Aus letzteren ging ein neues, von den USA dominiertes imperiales System hervor, das jedoch seinerseits seit etwa 2000 stark unter Druck steht.
Während freilich das Weströmische Reich endgültig erlosch und später Byzanz sich auf einen kümmerlichen Rumpf reduziert sah, nachdem die Ressourcen zwischen dem Zentrum und neuen regionalen Machthabern dauerhaft umverteilt worden waren, ist die Geschichte der Zukunft des Westens im globalen Rahmen noch nicht geschrieben. Kurzschlüssige Versuche wie der Brexit oder die MAGA-Idee in den USA, um den relativen Niedergang direkt umzukehren, finden bei den Autoren wenig überraschend keine Gnade. Doch wenn es gelinge, etwa durch einen "neuen fiskalischen Gesellschaftsvertrag" innerstaatlich wie global das Schuldenproblem zu lösen, hätte der westliche Nationalstaat im Verbund nicht nur eine existenzbedrohende Krise überwunden, er "hätte auch ein postkoloniales Erbe echter Größe hervorgebracht, auf das seine Bürger zu Recht stolz sein dürften". Historische Analyse, scharfe Gegenwartsdiagnose und (gemäßigter) Zukunftsoptimismus: Selten sind sie so trefflich vereint wie in diesem Buch. UWE WALTER
Peter Heather/John Rapley: "Stürzende Imperien". Rom, Amerika und die Zukunft des Westens.
A.d. Englischen von T. Andresen. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2024. 288 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 13.09.2024
Etwas anstrengend aber es lohnt sich, dabeizubleiben.









