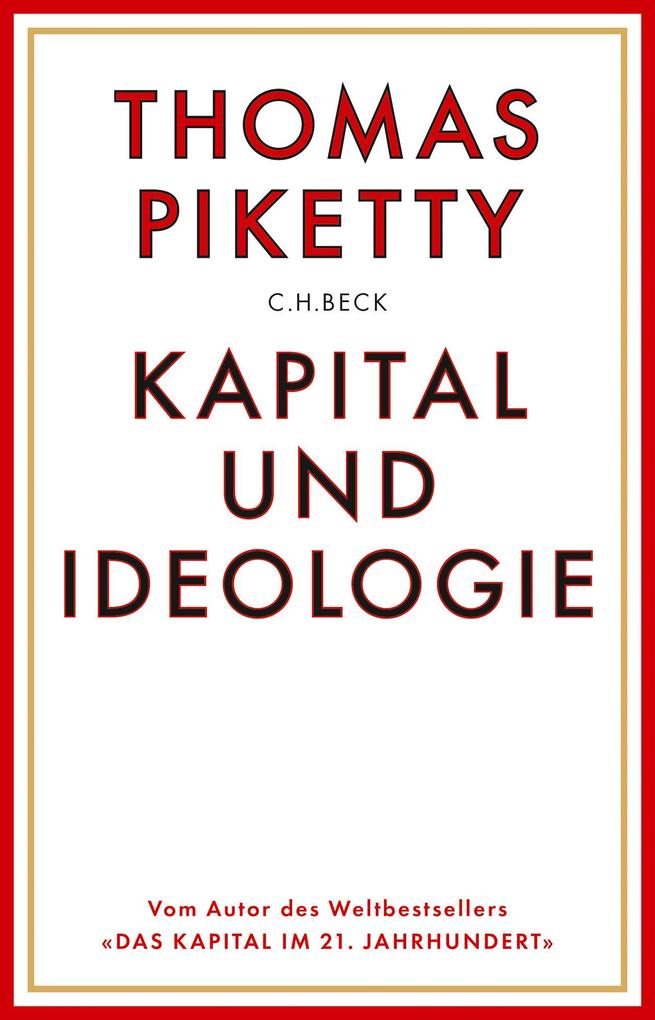
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
"WER ÜBER KAPITALISMUS REDEN WILL, KOMMT AN THOMAS PIKETTY NICHT VORBEI." HANDELSBLATT
Mit dem Weltbestseller "Das Kapital im 21. Jahrhundert" hat Thomas Piketty eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit geschrieben. Jetzt legt er mit einem gewaltigen Werk nach: Kapital und Ideologie ist eine so noch niemals geschriebene Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit und ihrer Ursachen, eine unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und gerechteren ökonomischen Systems.
Nichts steht geschrieben: Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Märkte, Profite und Kapital sind von Menschen gemacht. Wie sie funktionieren, hängt von unseren Entscheidungen ab. Das ist der zentrale Gedanke des neuen Buches von Thomas Piketty. Der berühmte Ökonom erforscht darin die Entwicklungen des letzten Jahrtausends, die zu Sklaverei, Leibeigenschaft, Kolonialismus, Kommunismus, Sozialdemokratie und Hyperkapitalismus geführt und das Leben von Milliarden Menschen geformt haben. Seine welthistorische Bestandsaufnahme führt uns weit über Europa und den Westen hinaus bis nach Asien und Afrika und betrachtet die globalen Ungleichheitsregime mit all ihren ganz unterschiedlichen Ursachen und Folgen. Doch diese eindrucksvolle Analyse ist für Thomas Piketty kein Selbstzweck. Er führt uns mit seinen weitreichenden Einsichten und Erkenntnissen hinein in die Krise der Gegenwart. Wenn wir die ökonomischen und politischen Ursachen der Ungleichheit verstanden haben, so Piketty, dann können wir die notwendigen Schritte für eine gerechtere und zukunftsfähige Welt konkret benennen und angehen. Kapital und Ideologie ist das geniale Werk eines der wichtigsten Denker unserer Zeit, eines der Bücher, die unsere Zeit braucht. Es hilft uns nicht nur, die Welt von heute zu verstehen, sondern sie zu verändern.
Mit dem Weltbestseller "Das Kapital im 21. Jahrhundert" hat Thomas Piketty eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit geschrieben. Jetzt legt er mit einem gewaltigen Werk nach: Kapital und Ideologie ist eine so noch niemals geschriebene Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit und ihrer Ursachen, eine unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und gerechteren ökonomischen Systems.
Nichts steht geschrieben: Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Märkte, Profite und Kapital sind von Menschen gemacht. Wie sie funktionieren, hängt von unseren Entscheidungen ab. Das ist der zentrale Gedanke des neuen Buches von Thomas Piketty. Der berühmte Ökonom erforscht darin die Entwicklungen des letzten Jahrtausends, die zu Sklaverei, Leibeigenschaft, Kolonialismus, Kommunismus, Sozialdemokratie und Hyperkapitalismus geführt und das Leben von Milliarden Menschen geformt haben. Seine welthistorische Bestandsaufnahme führt uns weit über Europa und den Westen hinaus bis nach Asien und Afrika und betrachtet die globalen Ungleichheitsregime mit all ihren ganz unterschiedlichen Ursachen und Folgen. Doch diese eindrucksvolle Analyse ist für Thomas Piketty kein Selbstzweck. Er führt uns mit seinen weitreichenden Einsichten und Erkenntnissen hinein in die Krise der Gegenwart. Wenn wir die ökonomischen und politischen Ursachen der Ungleichheit verstanden haben, so Piketty, dann können wir die notwendigen Schritte für eine gerechtere und zukunftsfähige Welt konkret benennen und angehen. Kapital und Ideologie ist das geniale Werk eines der wichtigsten Denker unserer Zeit, eines der Bücher, die unsere Zeit braucht. Es hilft uns nicht nur, die Welt von heute zu verstehen, sondern sie zu verändern.
- Soziale Ungleichheit ist kein Naturgesetz
- Ein unverzichtbares Buch für unsere Zeit
Inhaltsverzeichnis
INHALT
Vorwort und Dank
Einleitung
ERSTER TEIL
UNGLEICHHEITSREGIME IN DER GESCHICHTE
Kapitel 1. Dreigliedrige Gesellschaften: trifunktionale Ungleichheit
Kapitel 2. Die europäischen Ständegesellschaften: Macht und Eigentum
Kapitel 3. Die Erfindung der Eigentümergesellschaften
Kapitel 4. Die Eigentümergesellschaften: der Fall Frankreich
Kapitel 5. Die Eigentümergesellschaften: europäische Entwicklungswege
ZWEITER TEIL
DIE SKLAVENHALTER- UND KOLONIALGESELLSCHAFTEN
Kapitel 6. Die Sklavenhaltergesellschaften: extreme Ungleichheit
Kapitel 7. Die Kolonialgesellschaften: Vielfalt und Herrschaft
Kapitel 8. Dreigliedrige Gesellschaften und Kolonialismus: der Fall Indien
Kapitel 9. Dreigliedrige Gesellschaften und Kolonialismus: eurasische Entwicklungswege
DRITTER TEIL
DIE GROSSE TRANSFORMATION IM 20. JAHRHUNDERT
Kapitel 10. Die Krise der Eigentümergesellschaften
Kapitel 11. Die sozialdemokratischen Gesellschaften: die unvollendete Gleichheit
Kapitel 12. Kommunistische und postkommunistische Gesellschaften
Kapitel 13. Der Hyperkapitalismus: zwischen Moderne und Rückwärtsgewandtheit
VIERTER TEIL
NEUES NACHDENKEN ÜBER DIE DIMENSIONEN DES POLITISCHEN KONFLIKTS
Kapitel 14. Grenze und Eigentum: die Konstruktion der Gleichheit
Kapitel 15. Brahmanische Linke: die neuen euro-amerikanischen Bruchlinien
Kapitel 16. Sozialnativismus: die postkoloniale Identitätsfalle
Kapitel 17. Elemente eines partizipativen Sozialismus für das 21. Jahrhundert
Schlusswort
Inhaltsübersicht
Auflistung der Grafiken und Tabellen
Personenregister
Vorwort und Dank
Einleitung
ERSTER TEIL
UNGLEICHHEITSREGIME IN DER GESCHICHTE
Kapitel 1. Dreigliedrige Gesellschaften: trifunktionale Ungleichheit
Kapitel 2. Die europäischen Ständegesellschaften: Macht und Eigentum
Kapitel 3. Die Erfindung der Eigentümergesellschaften
Kapitel 4. Die Eigentümergesellschaften: der Fall Frankreich
Kapitel 5. Die Eigentümergesellschaften: europäische Entwicklungswege
ZWEITER TEIL
DIE SKLAVENHALTER- UND KOLONIALGESELLSCHAFTEN
Kapitel 6. Die Sklavenhaltergesellschaften: extreme Ungleichheit
Kapitel 7. Die Kolonialgesellschaften: Vielfalt und Herrschaft
Kapitel 8. Dreigliedrige Gesellschaften und Kolonialismus: der Fall Indien
Kapitel 9. Dreigliedrige Gesellschaften und Kolonialismus: eurasische Entwicklungswege
DRITTER TEIL
DIE GROSSE TRANSFORMATION IM 20. JAHRHUNDERT
Kapitel 10. Die Krise der Eigentümergesellschaften
Kapitel 11. Die sozialdemokratischen Gesellschaften: die unvollendete Gleichheit
Kapitel 12. Kommunistische und postkommunistische Gesellschaften
Kapitel 13. Der Hyperkapitalismus: zwischen Moderne und Rückwärtsgewandtheit
VIERTER TEIL
NEUES NACHDENKEN ÜBER DIE DIMENSIONEN DES POLITISCHEN KONFLIKTS
Kapitel 14. Grenze und Eigentum: die Konstruktion der Gleichheit
Kapitel 15. Brahmanische Linke: die neuen euro-amerikanischen Bruchlinien
Kapitel 16. Sozialnativismus: die postkoloniale Identitätsfalle
Kapitel 17. Elemente eines partizipativen Sozialismus für das 21. Jahrhundert
Schlusswort
Inhaltsübersicht
Auflistung der Grafiken und Tabellen
Personenregister
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. März 2020
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
1312
Autor/Autorin
Thomas Piketty
Übersetzung
André Hansen, Enrico Heinemann, Stefan Lorenzer, Ursel Schäfer, Nastasja S. Dresler
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 158 Grafiken und 11 Tabellen
Gewicht
1295 g
Größe (L/B/H)
221/145/55 mm
ISBN
9783406745713
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Die Welt müsste nicht so unfair sein, wie sie ist. Der Ökonom aus Paris zeigt, wie man den Weg aus der Ideologie der Ungleichheit findet.
SPIEGEL Bestsellerliste
"Piketty liefert neben einer beeindruckenden Analyse auch durchdachte Lösungsvorschläge."
Die Presse
"Fulminant (Thomas Piketty) wagt die Synthese von empirischer Forschung und philosophischer Argumentation, und er versucht sich an einer globalen Geschichte der Ungleichheit.
Deutschlandfunk, Volkmar Mühleis
"Thomas Piketty hält der Weltpolitik erneut einen Spiegel vor: Die sozialen Ungleichgewichte sind erdrückend und gefährden die Demokratie.
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Andreas Gebbink
"Auf der Ebene der politischen Theorie kommt ihm unverkennbar gerade deswegen eine so herausragende Position zu, weil er als radikaler Kritiker eben oft allein auf weiter Flur steht und die kritische Erforschung von Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus ausbleibt. Umso deutlicher wird jedoch Pikettys langfristiger Impact auf eine Generation neuer, kritischer und engagierter Politikwissenschaft sein, vergleichbar etwa mit den großen Namen der Globalisierungskritik, sodass die Lektüre dringend geboten scheint.
Portal für Politikwissenschaft, Florian Geisler
"Gerade weil Thomas Piketty das prekäre Eigentumsthema nicht in ein Gut/Böse-Schema presst, sondern als langfristige Zivilisationsaufgabe betrachtet, sollte sein Buch zur anregenden Lektüre für mündige Bürger werden.
Buchkultur, Hans-Dieter Grünefeld
"Pflichtlektüre! Von Globalisierung bis Gesundheit: Die aktuelle Krise zeigt, wie richtig die Thesen des Ökonomen Thomas Piketty sind.
Die Literarische WELT, Sahra Wagenknecht
"Die Zukunft ist bereits da, ob sie uns gefällt oder nicht. Und einiges dürfte nun vorgezogen werden, was man sonst gerne auf die lange Bank geschoben hätte. Insofern kommt das Buch von Thomas Piketty ( ) gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Kölner Stadt-Anzeiger, Michael Hesse
"Thomas Pikettys jüngstes Buch wird ebenso polarisieren wie es seine "Kapital -Studie vor einigen Jahren getan hat. Die einen werden den 49-jährigen Franzosen als "linkspopulistischen Vereinfacher abqualifizieren, die anderen werden ihn als profunden Empiriker preisen, als seriösen Meister-Ökonomen, der in seinem aktuellen Buch mit einigen erfrischend unkonventionellen Ideen punktet. Das wird man sehen können, wie man möchte. Nur eines wird man wohl nicht können: Pikettys jüngstem Werk die Beachtung verweigern.
Bayern2, Günter Kaindlstorfer
"Eine brillante Geschichte und Analyse gesellschaftlicher Ungerechtigkeit.
Nürnberger Nachrichten, Harald Loch
"Piketty lässt seinen Beobachtungen konkrete, recht radikale Vorschläge zur Umverteilung folgen. Und stellt einmal mehr infrage, was oft als einfach folgerichtig gilt.
STERN
"Thomas Piketty rollt in seinem neuen Bestseller die Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit auf. Er geht ihr auf den Grund und zeichnet den Entwurf eines neuen ökonomischen Systems.
Kurier
"Soziale Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Und das kann man ändern.
Perspective Daily, Benjamin Fuchs
"Revolutionäre Ideen für ein Umschwenken.
Augsburger Allgemeine, Harald Loch
"Ein fundamental wichtiger Anstoß dafür, die Gestaltbarkeit unserer gesellschaftlichen Ordnung ernst und uns wieder in die Pflicht zu nehmen, das Beste aus ihr zu machen.
Deutschlandfunk Kultur, Simone Miller
"Thomas Piketty ist dabei, der Karl Marx des 21. Jahrhunderts zu werden. Frankfurter Allgemeine Zeitung
"(Kapital und Ideologie) rekonstruiert Weltgeschichte als Geschichte von Rechtfertigungsideologien der Ungleichheit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Waltraud Schelkle
"Nur in der Nacht der Unwissenheit sind alle Katzen grau. Thomas Piketty drückt einen Schalter, und es wird hell. Die Raubtiere strahlen in allen Größen und Farben. Frankfurter Rundschau, Arno Widmann
"Das ist die Moral seines neuen, dicken Buches: Jede Gesellschaft versucht sich einzureden, ihre spezielle Ungerechtigkeit müsse aus guten Gründen so bestehen, aber in Wahrheit ist das gar nicht so, alles lässt sich ändern. Warum tun wir es nicht? Der Spiegel, Nils Minkmar
"Kapital und Ideologie durchleuchtet tiefenscharf die Anatomie der Ungleichheit und des Privateigentums hier zeigt sich, warum Piketty bei all seiner akademischen Bedeutung zugleich der bejubelte Rockstar der Ökonomie` werden konnte. Süddeutsche Zeitung, Andreas Zielcke
"In Thomas Pikettys neuem Buch ist die Analyse so datenbasiert und aufsehenerregend wie die politischen Forderungen radikal und optimistisch sind."
Falter, Markus Marterbauer
SPIEGEL Bestsellerliste
"Piketty liefert neben einer beeindruckenden Analyse auch durchdachte Lösungsvorschläge."
Die Presse
"Fulminant (Thomas Piketty) wagt die Synthese von empirischer Forschung und philosophischer Argumentation, und er versucht sich an einer globalen Geschichte der Ungleichheit.
Deutschlandfunk, Volkmar Mühleis
"Thomas Piketty hält der Weltpolitik erneut einen Spiegel vor: Die sozialen Ungleichgewichte sind erdrückend und gefährden die Demokratie.
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Andreas Gebbink
"Auf der Ebene der politischen Theorie kommt ihm unverkennbar gerade deswegen eine so herausragende Position zu, weil er als radikaler Kritiker eben oft allein auf weiter Flur steht und die kritische Erforschung von Legitimationsproblemen im Spätkapitalismus ausbleibt. Umso deutlicher wird jedoch Pikettys langfristiger Impact auf eine Generation neuer, kritischer und engagierter Politikwissenschaft sein, vergleichbar etwa mit den großen Namen der Globalisierungskritik, sodass die Lektüre dringend geboten scheint.
Portal für Politikwissenschaft, Florian Geisler
"Gerade weil Thomas Piketty das prekäre Eigentumsthema nicht in ein Gut/Böse-Schema presst, sondern als langfristige Zivilisationsaufgabe betrachtet, sollte sein Buch zur anregenden Lektüre für mündige Bürger werden.
Buchkultur, Hans-Dieter Grünefeld
"Pflichtlektüre! Von Globalisierung bis Gesundheit: Die aktuelle Krise zeigt, wie richtig die Thesen des Ökonomen Thomas Piketty sind.
Die Literarische WELT, Sahra Wagenknecht
"Die Zukunft ist bereits da, ob sie uns gefällt oder nicht. Und einiges dürfte nun vorgezogen werden, was man sonst gerne auf die lange Bank geschoben hätte. Insofern kommt das Buch von Thomas Piketty ( ) gerade zum richtigen Zeitpunkt.
Kölner Stadt-Anzeiger, Michael Hesse
"Thomas Pikettys jüngstes Buch wird ebenso polarisieren wie es seine "Kapital -Studie vor einigen Jahren getan hat. Die einen werden den 49-jährigen Franzosen als "linkspopulistischen Vereinfacher abqualifizieren, die anderen werden ihn als profunden Empiriker preisen, als seriösen Meister-Ökonomen, der in seinem aktuellen Buch mit einigen erfrischend unkonventionellen Ideen punktet. Das wird man sehen können, wie man möchte. Nur eines wird man wohl nicht können: Pikettys jüngstem Werk die Beachtung verweigern.
Bayern2, Günter Kaindlstorfer
"Eine brillante Geschichte und Analyse gesellschaftlicher Ungerechtigkeit.
Nürnberger Nachrichten, Harald Loch
"Piketty lässt seinen Beobachtungen konkrete, recht radikale Vorschläge zur Umverteilung folgen. Und stellt einmal mehr infrage, was oft als einfach folgerichtig gilt.
STERN
"Thomas Piketty rollt in seinem neuen Bestseller die Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit auf. Er geht ihr auf den Grund und zeichnet den Entwurf eines neuen ökonomischen Systems.
Kurier
"Soziale Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Und das kann man ändern.
Perspective Daily, Benjamin Fuchs
"Revolutionäre Ideen für ein Umschwenken.
Augsburger Allgemeine, Harald Loch
"Ein fundamental wichtiger Anstoß dafür, die Gestaltbarkeit unserer gesellschaftlichen Ordnung ernst und uns wieder in die Pflicht zu nehmen, das Beste aus ihr zu machen.
Deutschlandfunk Kultur, Simone Miller
"Thomas Piketty ist dabei, der Karl Marx des 21. Jahrhunderts zu werden. Frankfurter Allgemeine Zeitung
"(Kapital und Ideologie) rekonstruiert Weltgeschichte als Geschichte von Rechtfertigungsideologien der Ungleichheit.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Waltraud Schelkle
"Nur in der Nacht der Unwissenheit sind alle Katzen grau. Thomas Piketty drückt einen Schalter, und es wird hell. Die Raubtiere strahlen in allen Größen und Farben. Frankfurter Rundschau, Arno Widmann
"Das ist die Moral seines neuen, dicken Buches: Jede Gesellschaft versucht sich einzureden, ihre spezielle Ungerechtigkeit müsse aus guten Gründen so bestehen, aber in Wahrheit ist das gar nicht so, alles lässt sich ändern. Warum tun wir es nicht? Der Spiegel, Nils Minkmar
"Kapital und Ideologie durchleuchtet tiefenscharf die Anatomie der Ungleichheit und des Privateigentums hier zeigt sich, warum Piketty bei all seiner akademischen Bedeutung zugleich der bejubelte Rockstar der Ökonomie` werden konnte. Süddeutsche Zeitung, Andreas Zielcke
"In Thomas Pikettys neuem Buch ist die Analyse so datenbasiert und aufsehenerregend wie die politischen Forderungen radikal und optimistisch sind."
Falter, Markus Marterbauer
 Besprechung vom 08.03.2020
Besprechung vom 08.03.2020
Der Mythos vom Verdienst
Thomas Piketty über die Ungleichheit
Im Titel "Kapital und Ideologie" fasst der französische Ökonom Thomas Piketty nicht nur sein Thema zusammen: Er deutet damit auch an, auf eine Weise, die einen schwindelig machen kann, dass er mit seinem Buch nicht nur eine Analyse des Kapitals und des Kapitalismus, sondern auch ein Programm zu dessen Neu- oder Umgestaltung vorlegen will.
Piketty arbeitet mit einem positiven Begriff von Ideologie. Ideologien sind für ihn "mehr oder weniger schlüssige Versuche, Antworten auf eine Reihe extrem weit gefasster Fragen zu geben, die um die erstrebenswerte oder ideale Organisation der Gesellschaft kreisen", schreibt er. Da es sich nicht von selbst versteht, muss man aber hinzufügen, dass natürlich, angesichts der Komplexität der Fragen nach dem Eigentum, nach Steuern oder dem Zugang zu Bildung und Gesundheit, keine Ideologie je eine angemessene und erschöpfende Antwort bieten wird. Dass Konflikte und Meinungsverschiedenheiten also aus dem Inneren der Ideologien selbst stammen.
Dennoch müsse, meint Piketty, jede Gesellschaft um diese Antworten ringen. Und grundsätzlich fühle sich auch jeder Einzelne aufgerufen, sich eine Meinung zu den fundamentalen und existenziellen Fragen der Gesellschaft zu bilden, wie unbestimmt und unzulänglich die auch sei. Und weil in einer hochgradig arbeitsteilig organisierten Gesellschaft wirklich nicht mehr jede und jeder alles wissen kann, ist die Orientierung in allen Gebieten, in denen man kein Spezialist ist, für Piketty immer ideologisch - und erst mal kein Problem. Damit wendet sich Piketty natürlich auch gegen die nach dem Zusammenbruch des Sowjetsystems in den 1990er Jahren virulent gewordene Parole vom "Ende der Ideologien".
Piketty weiß aber auch, dass der anklagende Gebrauch des Ideologiebegriffs gerechtfertigt sein kann, wenn man damit eine dogmatische Sichtweise benennt, die den Tatsachen nicht ausreichend Rechnung trägt. Auch deshalb ist sein Buch ausgesprochen faktenbezogen und bedient sich neben der französischen Sprache, in der Piketty das Orginal geschrieben hat, auch der Sprachen der Mathematik und der Statistik. Und bei der Betrachtung zum Beispiel der Anteile der oberen und der unteren zehn Prozent am Gesamteinkommen in der amerikanischen Gesellschaft stellt Piketty eine "Wiederkehr der Ungleichheiten" fest, die er zu den beunruhigendsten strukturellen Umwälzungen zählt, mit denen die Welt aktuell konfrontiert ist.
Beunruhigend findet Piketty nicht nur die sogenannte Einkommensschere, die sich in allen entwickelten Ländern seit den 1980er - und in den ehemals kommunistischen Ländern seit den 1990er - Jahren beobachten lässt, sondern auch, dass sie von einer "neuen ultra-inegalitären Erzählung" begleitet wird. Einer Erzählung, die die Ungleichheit einerseits naturalisisert und andererseits in eine Leistungsfeier münden lässt, wonach exorbitante Managergehälte eben nur Leistungswillen und -fähigkeit belohnen. Für Piketty, mal abgesehen davon, dass er die Rede von Belohnung der Leistung im Spitzenlohn für Heuchelei hält, folgen aus der Behauptung, die bestehende Ungleichheit sei unabwendbar, die meisten Übel der Gegenwart. Denn wenn man die Menschen glauben mache, dass es keine Alternative zum Bestehenden gäbe, dann sei es kein Wunder, "dass alle Hoffnung auf Veränderung sich auf die Feier der Grenze und der Identität verlagert".
Dabei ist Piketty vollkommen klar, dass die Ungleichheitserzählung erfolgreich und zu Recht vom Desaster der kommunistischen Regime zehren kann. Wahrscheinlich auch deshalb grenzt er sich methodisch bewusst von "marxistischen" Lehrmeinungen ab, wonach der ideologische Überbau nachgerade mechanisch vom Stand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse abhängt.
Dagegen beharrt Piketty auf einer genuinen Autonomie der Ideen, also der ideologisch politischen Sphäre. Woraus auch folgt, dass die gegenwärtigen ökonomischen Verhältnisse durchaus anders politisch und ideologisch organisiert sein könnten. Im Grunde dient der gesamte historische Teil, in dem Piketty die geschichtlichen Stationen von der Dreiständegesellschaft über die Eigentumsgesellschaften nach der französischen Revolution bis zum modernen Kapitalismus untersucht, der Untermauerung seiner These, dass gleiche oder nur vergleichbare ökonomische Verhältnisse immer schon unterschiedliche politische und ideologische Regime hervorgebracht haben oder zumindest hervorbringen könnten.
Den aktuellen Kapitalismus sieht er in einer neo-proprietaristischen Phase, einer Phase, in der die ständige Ausweitung des Privateigentums und die Akkumulation von Vermögenswerten über traditionelle Besitzformen und alte Staatsgrenzen hinaus wächst. Proprietarismus ist eine zwar holprige, aber sinnvolle Begriffsschöpfung Pikettys. Entwickelt hat sich der Proprietarismus als Ideologie in ländlichen Gegenden, also deutlich früher als die Großindustrie und das internationale Finanzwesen. Der Proprietarismus entsteht in noch größtenteils vorindustriellen Gesellschaften als Überwindung der Ständegesellschaft durch die Fähigkeit des neu organisierten Zentralstaats, die hoheitlichen Funktionen und den allgemeinen Schutz des Eigentumsrechts zu übernehmen. Eigentum wird vom Staat garantiert und geregelt. Das Zusammenspiel von zentralisiertem Staat und Eigentum ist der Knackpunkt von Pikettys Untersuchung.
Jedes Ungleichheitsregime, jede Ungleichheitsideologie beruht, vereinfacht gesprochen, auf einer Theorie der Grenze und einer Theorie des Eigentums. Jedes Regime muss die Ungleichheit rechtfertigen, muss eine Erklärung vorlegen, warum die Ungleichheit gut fürs Ganze ist. Piketty sieht in diesen, oft sehr spezifischen Erklärungen nicht bloß Heucheleien und Lügen, sondern immer auch Versuche, die widerstreitenden Kräfte und Kosten einer Gesellschaft in einen Ausgleich zu bringen. Deshalb ist er auch weit entfernt davon, Ständegesellschaft oder Eigentumsgesellschaft als überholt zu bezeichnen. Er glaubt, dass man, zum Beispiel bei der Betrachtung der Kleiderordnung in höfischen Gesellschaften, lernen kann, dass es sich hier nicht um starre Strukturen handelt, sondern um ausgehandelte Verfahren, die aber ihrerseits wieder strukturierend für kommende Ereignisse wirken.
Strukturen sind für Piketty nie "genetisch", sondern immer gemacht und ausgehandelt, nur leider nicht selten in unbeachtet und unerforscht gebliebenen Vergangenheiten. So haben die Fragen der politischen Ordnung und der Eigentumsordnung tatsächlich nie aufgehört, unauflöslich miteinander verknüpft zu sein. Von den Sklavenhaltergesellschaften und Ständeordnungen über die Eigentümergesellschaften bis zu kommunistischen und sozialdemokratischen Gesellschaften. Wobei sich letztere, die Piketty im Zeitraum von 1950 bis 1980 vor allem in West-Europa und den Vereinigten Staaten verortet, als Reaktion auf die von den Eigentümergesellschaften gezeitigten Ungleichheits- und Identitätskrisen herausgebildet haben. Den Markt und den Wettbewerb als solchen gibt es für Piketty so wenig, wie es Gewinn und Lohn, Kapital und Schulden, hochqualifizierte und geringqualifizierte Arbeiter, Einheimische und Fremde, Steuerparadiese und Wettbewerbsfähigkeit als solche gibt.
All das sind soziale und historische Konstruktionen, "die durch und durch nicht nur davon abhängen, welches Rechts-, Steuer-, Bildungs- und Politiksystem man in Kraft zu setzen beschließt, sondern auch von den Begriffen, die man sich davon macht". Und genau um die Begriffe geht es ihm, wenn er etwa die Entwicklung der Spitzensteuersätze in den entwickelten Ländern anschaut.
Bei der Einkommensteuer lag der Spitzensatz in den Vereinigten Staaten zum Beispiel zwischen 1932 bis 1980 im Durchschnitt bei 81 Prozent, in Großbritannien bei 89 Prozent, gegenüber 58 Prozent in Deutschland und 60 Prozent in Frankreich. Ganz offenbar haben diese Steuersätze jenseits der 80 Prozent, nicht zur Zerstörung des Kapitalismus der Vereinigten Staaten geführt. Ims Gegenteil: Die Produktivität in den Vereingten Staaten war damals höher als in den Jahren nach 1980, in denen in den Vereinigten Staaten der Spitzensatz zwischen 30 und 40 Prozent schwankte. Piketty möchte mit dieser Vorführung der Zahlen nicht behaupten, dass höhere Steuern zu höherer Produktivität führen. Er zeigt nur, das höhere Steuern keine Widerspruch zur Produktivität sein müssen, wie das andauernd zu hören ist.
Und Piketty weiß natürlich auch, dass die bisher einmalige Phase der relativ gleichen Verteilung von Eigentum, Bildung und Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten in den Jahren der sozialdemokatischen Gesellschaften von 1950 bis 1980 genau deshalb endete: weil alles in Ordnung war. Seine Analyse des Scheitern der sozialdemokratischen Bildungskonzepte und -politik ist schmerzhaft genau; er will nur ein Tor öffnen für ein neues Gleichheitskonzept, das konkrete Sofortveränderungen im Steuersystem wie in der Bildungspolitik für nicht unmöglich erklärt.
Denn eine gerechte Gesellschaft organisiert soziale und wirtschaftliche Beziehungen, Eigentumsverhältnisse, Einkommens- und Vermögensverteilung derart, dass sie ihren am wenigsten begünstigten Mitgliedern die bestmöglichen Existenzbedingungen bietet. Damit schließt sie Gleichförmigkeit so wenig ein wie absolute Gleichheit.
CORD RIECHELMANN
Thomas Piketty: Kapital und Ideologie. Verlag C. H. Beck, 1312 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 27.04.2020
Ein wahrlich gewaltiges Werk und ebensolches Leseerlebnis, das auch für Laien leicht zugänglich ist und die Gedanken nachhaltig begleitet.
am 12.03.2020
Ein großartiges Werk! Toll geschrieben. Unbedingt lesen!
Ein großartiges Werk! Toll geschrieben. Unbedingt lesen!
Es ist Lesehighlight des Jahres. Solche Werke kommen max. alle 5 Jahre, wenn überhaupt. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber ich bin jetzt schon schwer begeistert.
Klappentext beschreibt den Inhalt sehr treffend: " Kapital und Ideologie ist eine so noch niemals geschriebenen Globalgeschichte der sozialen Ungleichheit und ihrer Ursache, eine unnachsichtige Kritik der zeitgenössischen Politik und zugleich der kühne Entwurf eines neuen und gerechteren ökonomischen Systems. Nichts sehr geschrieben: Der Kapitalismus ist kein Naturgesetz. Märkte, Profite und Kapital sind von Menschen gemacht. Wie sie funktionieren, hängt von unseren Entscheidungen ab."
Es liest sich sehr gut, wie ein gutes, reichhaltige Gespräch mit einem Freund, der sich in der Materie prima auskennt und seine Sicht der Dinge mithilfe von etlichen Diagrammen, Graphiken, Beispielen etc. mit dem Leser teilt.
"Kapital und Ideologie" ist ein großartiges Meisterwerk. Die globale Geschichte so eigenartig, so packend und wohl begründet zu erzählen!
Und: Dass Neoliberalismus keine alternativlose Entwicklung ist, ist hier überzeugend geschildert.
Man kann seitenlang über dieses Buch schreiben. Besser: Lesen Sie selbst.
Das Buch ist leserfreundlich gemacht. Die Anmerkungen findet man in den Fußnoten auf der gleichen oder der nächsten Seite. Sehr praktisch. Man muss nicht stets hinten danach suchen. Gerade bei so einem umfangreichen Buch ist so eine Lösung sehr angenehm. So kann man sich besser auf den Text konzentrieren. Ansonsten: Festeinband in Rot. Umschlagblatt aus festem, glattem Papier. Der Name des Autors und der Titel sind haptisch hervorgehoben. Lesebändchen in Goldgelb. Perfekt als Geschenk.
Fazit: Großartiges Werk! Unbedingte Lesepflicht!









