Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
Ihr Ostergeschenk: 15% Rabatt auf viele Sortimente11 mit dem Code OSTERN15
Jetzt einlösen
mehr erfahren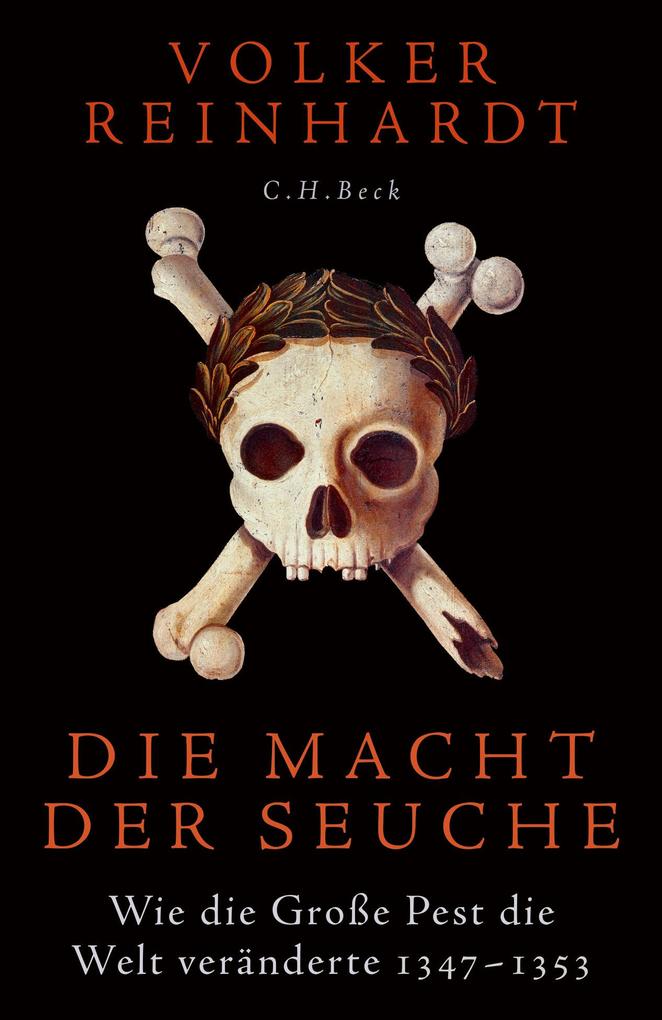
Zustellung: Fr, 04.04. - Mo, 07.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
EINE PANDEMIE VERÄNDERT DIE WELT - DIE NEUE GESCHICHTE DER PEST
Die Große Pest der Jahre um 1348 war eines der einschneidendsten Ereignisse der europäischen Geschichte. Volker Reinhardt rekonstruiert den Verlauf der Epidemie von den Anfängen in Asien bis zu ihrem vorläufigen Erlöschen in Europa, beleuchtet die unterschiedlichen Verhältnisse in ausgewählten Städten und fragt, wie die Überlebenden politisch und wirtschaftlich, religiös und künstlerisch das große Sterben bewältigten. Sein spannend geschriebenes Panorama führt eindringlich vor Augen, was wir dem medizinischen Fortschritt verdanken - und wie verblüffend ähnlich wir heute trotzdem auf eine Pandemie reagieren.
Als im Frühjahr 1348 die Pest nahte, ließ der Mailänder Herrscher Luchino Visconti die Stadt komplett isolieren. Kranke in der Stadt wurden vorsorglich eingemauert. So blieb Mailand als einzige Stadt Italiens verschont. Volker Reinhardt hat die verfügbaren Quellen zur Großen Pest neu gesichtet und zeigt in seinem anschaulich erzählten Buch, dass der vermeintliche europäische Flächenbrand eine Summe von lokalen Dramen war, die die Menschen auf ganz unterschiedliche Weise bewältigten: durch politische Umstürze, Verfolgung von Minderheiten, Restauration alter Verhältnisse oder eben durch ein Lob der Tyrannis à la Mailand. Klassische Pestbeschreibungen wie die von Boccaccio erweisen sich als späte Stilisierung nach antiken Vorbildern, doch Bilder, Bauwerke oder anonyme Chronisten lassen ermessen, wie groß die Verunsicherung war und wie übermächtig die Sehnsucht nach der verlorenen Normalität.
Die Große Pest der Jahre um 1348 war eines der einschneidendsten Ereignisse der europäischen Geschichte. Volker Reinhardt rekonstruiert den Verlauf der Epidemie von den Anfängen in Asien bis zu ihrem vorläufigen Erlöschen in Europa, beleuchtet die unterschiedlichen Verhältnisse in ausgewählten Städten und fragt, wie die Überlebenden politisch und wirtschaftlich, religiös und künstlerisch das große Sterben bewältigten. Sein spannend geschriebenes Panorama führt eindringlich vor Augen, was wir dem medizinischen Fortschritt verdanken - und wie verblüffend ähnlich wir heute trotzdem auf eine Pandemie reagieren.
Als im Frühjahr 1348 die Pest nahte, ließ der Mailänder Herrscher Luchino Visconti die Stadt komplett isolieren. Kranke in der Stadt wurden vorsorglich eingemauert. So blieb Mailand als einzige Stadt Italiens verschont. Volker Reinhardt hat die verfügbaren Quellen zur Großen Pest neu gesichtet und zeigt in seinem anschaulich erzählten Buch, dass der vermeintliche europäische Flächenbrand eine Summe von lokalen Dramen war, die die Menschen auf ganz unterschiedliche Weise bewältigten: durch politische Umstürze, Verfolgung von Minderheiten, Restauration alter Verhältnisse oder eben durch ein Lob der Tyrannis à la Mailand. Klassische Pestbeschreibungen wie die von Boccaccio erweisen sich als späte Stilisierung nach antiken Vorbildern, doch Bilder, Bauwerke oder anonyme Chronisten lassen ermessen, wie groß die Verunsicherung war und wie übermächtig die Sehnsucht nach der verlorenen Normalität.
- Die Große Pest - ihr verheerendes Wirken in Mitteleuropa
- Der Verlauf der Pest von den Anfängen bis zum Erlöschen
- Neue und kritische Analyse der Quellen
- Die Große Pest reduzierte die Bevölkerung in Europa um ein Drittel
Inhaltsverzeichnis
Einleitung - Zeiten der Verunsicherung, einst und heute
Erster Teil - DIE PEST UND DIE MENSCHEN
1. Herkunft und Ankunft
2. Ausbreitung
3. Symptome und Ursachen
4. Sterbeziffern und Bevölkerungsverluste
5. Reich und Arm
6. Auf der Suche nach Brot, Sinn und Seelenheil
Zweiter Teil - DIE MENSCHEN UND DIE PEST
1. Überlebende berichten
2. Kaufleute, Literaten und Parvenüs in Florenz
3. Pest und politischer Neuanfang in Rom
4. Keine Pesttoten: Das Wunder von Mailand
5. Ein Putsch nach der Pest: Venedig
6. Viel Rauch und soziale Distanz: Der Papst in Avignon
7. Eine Stadt rückt zusammen: Die Pest in Paris
8. Pogrome und Geißler: Würzburg, Straßburg, Frankfurt
9. Ursachenforschung und Gegenmaßnahmen: Europäische Vergleiche
Dritter Teil - DIE MENSCHEN NACH DER PEST
1. Gewöhnung, Prävention und kulturelle Prägungen
2. Wirtschaftliche Vorteile der Besitzlosen
3. Die Stärkung der Mächtigen
4. Das neue Selbstbewusstsein der Unterschichten
5. Der Machtverlust der Päpste
6. Wie die Humanisten mit der Pest umgingen
7. Auf der Suche nach der Pest in Bildern und Statuen
8. Kinder der Pest: Die Heilige und der Kapitalist
Epilog: Alte Gewissheiten und neue Hoffnungen
Anhang
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Erster Teil - DIE PEST UND DIE MENSCHEN
1. Herkunft und Ankunft
2. Ausbreitung
3. Symptome und Ursachen
4. Sterbeziffern und Bevölkerungsverluste
5. Reich und Arm
6. Auf der Suche nach Brot, Sinn und Seelenheil
Zweiter Teil - DIE MENSCHEN UND DIE PEST
1. Überlebende berichten
2. Kaufleute, Literaten und Parvenüs in Florenz
3. Pest und politischer Neuanfang in Rom
4. Keine Pesttoten: Das Wunder von Mailand
5. Ein Putsch nach der Pest: Venedig
6. Viel Rauch und soziale Distanz: Der Papst in Avignon
7. Eine Stadt rückt zusammen: Die Pest in Paris
8. Pogrome und Geißler: Würzburg, Straßburg, Frankfurt
9. Ursachenforschung und Gegenmaßnahmen: Europäische Vergleiche
Dritter Teil - DIE MENSCHEN NACH DER PEST
1. Gewöhnung, Prävention und kulturelle Prägungen
2. Wirtschaftliche Vorteile der Besitzlosen
3. Die Stärkung der Mächtigen
4. Das neue Selbstbewusstsein der Unterschichten
5. Der Machtverlust der Päpste
6. Wie die Humanisten mit der Pest umgingen
7. Auf der Suche nach der Pest in Bildern und Statuen
8. Kinder der Pest: Die Heilige und der Kapitalist
Epilog: Alte Gewissheiten und neue Hoffnungen
Anhang
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Bildnachweis
Personenregister
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. März 2021
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
256
Autor/Autorin
Volker Reinhardt
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 25 Abbildungen und 1 Karte
Gewicht
444 g
Größe (L/B/H)
217/144/22 mm
ISBN
9783406767296
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
" Ein Panorama der großen Pest in Europa ( ) In den kurzen Pausen zwischen den Covid-19-Talkshows stellt Die Macht der Seuche` eine willkommene Abwechslung dar.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb
" Der Wunsch nach Autoritäten ist nur eine von vielen Parallelen, die der Historiker Volker Reinhardt zwischen Gegenwart und Vergangenheit zieht.
Die ZEIT Bestenliste, Platz 2
" Volker Reinhardt hält in seinem klugen, instruktiven Buch fest, dass ( ) auch die Corona-Pandemie keine neue Epoche einleiten wird.
Deutschlandfunk, Holger Heimann
" Facettenreicher Einblick in die Lebens- und Sterbenswelt der Grossen Pest.
Neue Zürcher Zeitung, Franz-Julius Morche
" Dem Historiker ist ein handliches Werk gelungen, das Überblick, Einblick und Zusammenhänge im richtigen Maß bietet. " P. M. History
" Führt eindringlich vor Augen, was wir dem medizinischen Fortschritt verdanken. " Der neue Tag
" Als Kenner des frühneuzeitlichen Italiens und Stilist von Rang gelingt es ihm (Reinhardt), die Leser für seine Sichtweise einzunehmen. "
Die WELT, Philip Cassier
" Ein Roman voll von scharfsichtigen Beobachtungen und historischen Erkenntnissen. SWR 2 Bestenliste, Platz 8
" Mit großer erzählerischer Kraft und analytischem Sachverstand beschreibt Reinhardt die zersetzende Macht der Pandemie und erläutert, wie diese in alle Lebensbereiche hineinwirkte und das soziale Gefüge der spätmittelalterlichen Gesellschaft erschütterte.
Spektrum der Wissenschaft
" Ein spannend geschriebenes Werk über die Pest, das frappierend zeigt: Unser Umgang mit Corona ist in vielen Punkten nur Wiederholung. Alles schon da gewesen: " Tödliche-Luft" -Theorie; Querdenker; Quarantäne (von italienisch quaranta, also vierzig Tage Isolation); brutaler Wirtschaftseinbruch, auf den allerdings die aufblühende Renaissance folgte.
ZDF. de, Wulf Schmiese
" Verbindet auf elegante Weise komplizierte und weitreichende Zusammenhänge. ( ) Seine erzählerische Kunst macht aus schrecklichen Geschehnissen ein intelligentes Lesevergnügen.
Falter, Thomas Leitner
" Ein überaus interessantes Psychogramm menschlicher Verhaltensweisen in Bedrohungssituationen.
Spektrum der Wissenschaft, Theodor Kissel
" Ein wahres Kabinettstück. "
Schwäbische Zeitung
" Ein brillant geschriebenes Buch zur großen Pest im 14. Jahrhundert ( ) Inklusive spannender Vergleiche zwischen den beiden Pandemien.
KNA, Christoph Arens
" Reinhardt ( ) ist ein gewissenhafter und methodisch bewusster Geschichtsforscher, der Dinge und Zeiten sorgfältig auseinanderzuhalten weiß.
Kölner Stadt-Anzeiger, Markus Schwering
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Kilb
" Der Wunsch nach Autoritäten ist nur eine von vielen Parallelen, die der Historiker Volker Reinhardt zwischen Gegenwart und Vergangenheit zieht.
Die ZEIT Bestenliste, Platz 2
" Volker Reinhardt hält in seinem klugen, instruktiven Buch fest, dass ( ) auch die Corona-Pandemie keine neue Epoche einleiten wird.
Deutschlandfunk, Holger Heimann
" Facettenreicher Einblick in die Lebens- und Sterbenswelt der Grossen Pest.
Neue Zürcher Zeitung, Franz-Julius Morche
" Dem Historiker ist ein handliches Werk gelungen, das Überblick, Einblick und Zusammenhänge im richtigen Maß bietet. " P. M. History
" Führt eindringlich vor Augen, was wir dem medizinischen Fortschritt verdanken. " Der neue Tag
" Als Kenner des frühneuzeitlichen Italiens und Stilist von Rang gelingt es ihm (Reinhardt), die Leser für seine Sichtweise einzunehmen. "
Die WELT, Philip Cassier
" Ein Roman voll von scharfsichtigen Beobachtungen und historischen Erkenntnissen. SWR 2 Bestenliste, Platz 8
" Mit großer erzählerischer Kraft und analytischem Sachverstand beschreibt Reinhardt die zersetzende Macht der Pandemie und erläutert, wie diese in alle Lebensbereiche hineinwirkte und das soziale Gefüge der spätmittelalterlichen Gesellschaft erschütterte.
Spektrum der Wissenschaft
" Ein spannend geschriebenes Werk über die Pest, das frappierend zeigt: Unser Umgang mit Corona ist in vielen Punkten nur Wiederholung. Alles schon da gewesen: " Tödliche-Luft" -Theorie; Querdenker; Quarantäne (von italienisch quaranta, also vierzig Tage Isolation); brutaler Wirtschaftseinbruch, auf den allerdings die aufblühende Renaissance folgte.
ZDF. de, Wulf Schmiese
" Verbindet auf elegante Weise komplizierte und weitreichende Zusammenhänge. ( ) Seine erzählerische Kunst macht aus schrecklichen Geschehnissen ein intelligentes Lesevergnügen.
Falter, Thomas Leitner
" Ein überaus interessantes Psychogramm menschlicher Verhaltensweisen in Bedrohungssituationen.
Spektrum der Wissenschaft, Theodor Kissel
" Ein wahres Kabinettstück. "
Schwäbische Zeitung
" Ein brillant geschriebenes Buch zur großen Pest im 14. Jahrhundert ( ) Inklusive spannender Vergleiche zwischen den beiden Pandemien.
KNA, Christoph Arens
" Reinhardt ( ) ist ein gewissenhafter und methodisch bewusster Geschichtsforscher, der Dinge und Zeiten sorgfältig auseinanderzuhalten weiß.
Kölner Stadt-Anzeiger, Markus Schwering
 Besprechung vom 05.02.2021
Besprechung vom 05.02.2021
Abstand halten hat schon damals geholfen
Zivilisationsbrüche, Kontaktverbote und die Sehnsucht nach dem starken Mann: Volker Reinhardt entwirft ein Panorama der Großen Pest in Europa.
In der Pandemie ist alles Pandemie. Wir reden über Kino und Corona, Menschenrechte und Corona, Kochen und Corona, soziale Ungleichheit in Zeiten von Corona. Deshalb ist eine Wohltat, dass ein Buch, das von der Großen Pest des vierzehnten Jahrhunderts in Europa handelt, von Kunst, Literatur, Tuchhandel, Klansherrschaft und imaginären Reisen erzählt. Es geht in Volker Reinhardts Studie um Paolo Uccello und Donatello, um die Erfindung der Renaissance, um den Politiker Cosimo de' Medici und den Fabrikanten Francesco Datini, der das größte Privatvermögen seiner Zeit besaß, um Petrarcas vermutlich erfundene Besteigung des Mont Ventoux und vieles mehr. In den kurzen Pausen zwischen den Covid-19-Talkshows stellt "Die Macht der Seuche" eine willkommene Abwechslung dar.
Aber zuerst muss Volker Reinhardt natürlich das finstere Tal der historischen Fakten durchwandern. Das erledigt der an der Schweizer Universität Freiburg lehrende Frühneuzeithistoriker mit quellenkritischer Delikatesse. So entlarvt er die verbreitete Annahme, die Pest sei aus Asien nach Europa gelangt, weil die tatarischen Belagerer des genuesischen Stützpunkts Caffa auf der Krim im Jahr 1347 Pestleichen über die Mauern geschleudert hätten, als Erdichtung eines Chronisten aus Oberitalien. Tatsächlich erreichte die Seuche auf Handelsschiffen aus Caffa über Konstantinopel den westlichen Mittelmeerraum, wo sie sich zuerst in Messina, dann in der Mutterstadt Genua und schließlich in Marseille ausbreitete und von dort ins Landesinnere vordrang. Die Geschwindigkeit, mit der die Infektion vorankam, war je nach der Dichte des Verkehrsnetzes und der Intensität der Handelsbeziehungen von Region zu Region verschieden, doch bis 1351 hatte sie ganz Europa erfasst.
Ganz Europa? Nein, drei Regionen blieben von der zweiten nachchristlichen Pandemie durch das Bakterium Yersinia pestis - die erste, von den Historikern als Justinianische Pest bezeichnete, hatte zwischen 540 und 750 gewütet - weitgehend verschont: die Pyrenäen, das Landesinnere Polens und das Gebiet um Mailand. Hier stellt Reinhardt seine als Überblick angelegte Betrachtung lokalgeschichtlich scharf. Denn während Polen und die Pyrenäen von ihrer Randlage und geringen Bevölkerungsdichte profitierten, lag die Metropole Mailand im Auge des italienischen Peststurms. Dass ihre Einwohnerschaft dennoch nicht dezimiert wurde, ist allein mit seuchenpolitischen Maßnahmen des Stadtregenten Luchino Visconti (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Filmregisseur, den Reinhardt "Luchino Visconti II." nennt) zu erklären. Interessanterweise schweigen die meisten zeitgenössischen Quellen zu diesem Thema. Nur zwei Chronisten aus Pisa und Siena berichten übereinstimmend, in Mailand seien bloß drei Familien gestorben, weil man deren Häuser unmittelbar nach dem Ausbruch der Krankheit zugemauert habe. Als die Pest fünfzehn Jahre später wieder zuschlug, ließ Viscontis Großneffe ein Lazarett vor den Stadtmauern aus dem Boden stampfen. Offensichtlich ahmte er die erfolgreiche Pandemie-Strategie seines Vorgängers nach: Isolation der Kranken, Einreisebeschränkungen, Reduzierung der Sozialkontakte.
In Staaten und Regionen, in denen solche Maßnahmen nicht oder zu spät angewandt wurden, schlug Yersinia pestis gnadenlos zu. Nach verlässlichen Schätzungen starb zwischen 1347 und 1353 etwa ein Drittel der Bevölkerung Europas an der Seuche. Dabei gab es ein klares Gefälle zwischen dichter und lockerer besiedelten Städten: Während das bevölkerungsarme Rom unter der Herrschaft des Volkstribuns Cola di Rienzo vergleichsweise glimpflich davonkam, stand Venedig vor dem Zusammenbruch. Vier Jahre nach dem Ende der Pestwelle putschte der Doge Marino Faliero mit Hilfe bürgerlicher Kreise gegen die Adelsrepublik. Faliero wurde enthauptet, im Großen Ratssaal des Dogenpalasts hängt anstelle seines Porträts ein von Tintoretto gemaltes schwarzes Banner.
Falieros Coup bezeugt für Volker Reinhardt eine allgemeine Legitimationskrise republikanischer Herrschaftsformen als Folge der Pest. Die Überlebenden, schockiert vom Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung in der Pandemie, sehnten sich nach Anführern, die diese Ordnung zukünftig garantierten. Ein Beleg für diesen Trend ist neben der stabilen Tyrannei der Visconti in Mailand der Aufstieg der Medici in Florenz. Anders als das traditionelle Patriziat, das nach dem Muster eines Herrenclubs agierte, suchte sich Cosimo der Ältere seine Anhänger in allen Bevölkerungsschichten. Auf Paolo Uccellos Sintflut-Fresko im Kreuzgang von Santa Maria Novella erscheint er im staatsmännischen Ornat als Retter der geplagten Menschheit. Anscheinend hatte Cosimo nicht nur die Macht der Straße, sondern auch die der Bilder begriffen. Als Kunstmäzen schrieb er sich ins kollektive Gedächtnis einer Stadt ein, die mit Werken wie Donatellos Georgsstatue ihre Siege über ihre Nachbarkommunen feierte.
Volker Reinhardt ist ein vorsichtiger Pandemiehistoriker. Das zeigt sich nicht nur an seiner Zurückhaltung bei der Schilderung der Zustände in Nord- und Westeuropa, mit denen er als Experte für die Geschichte Italiens weniger vertraut ist, sondern auch am Umgang mit seinen eigenen Thesen. Aufgabe des Wissenschaftlers sei es auch, "Nichtwissen einzugestehen". Reinhardt macht mit dieser Ankündigung Ernst: Es sei "verführerisch, aber letztlich unbeweisbar", die Zunahme an Adelsherrschaften im frühneuzeitlichen Europa mit der Erschütterung durch die Pestwellen zu erklären, und auch Versuche, das auf die Freuden des Diesseits gestimmte Lebensgefühl der Frührenaissance als Reaktion auf die Seuche zu deuten, gehörten "ins Reich der Spekulation".
Umso bedauerlicher ist es, dass sich der Autor selbst gelegentlich in die Gefilde des Spekulativen verirrt. So sinniert er in seiner Einführung über den möglichen Autoritätsverlust, den "Virologen und andere ,Experten'" durch das Corona-Geschehen erleiden könnten. Später ist von "hinsichtlich ihrer Wirksamkeit umstrittenen Schutzmasken des Jahres 2020" die Rede. Mit solchen Ausfälligkeiten springt Volker Reinhardt ohne Not aus der Position des Experten in die des Amateurs. Dabei braucht sein Pestpanorama dieses leitartikelnde Finish gar nicht. Überall dort, wo es ausschließlich bei seinem historischen Gegenstand bleibt, leuchtet es ganz von selbst.
ANDREAS KILB
Volker Reinhardt: "Die Macht der Seuche."
Wie die Große Pest die Welt veränderte 1347-1353.
C. H. Beck Verlag, München 2021. 256 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 24.06.2022
Leider wenig neue Erkenntnisse und die naturwissenschaftliche Dimension bleibt fast vollständig außen vor.
LovelyBooks-Bewertung am 26.04.2021
¿Leitmotive sind die Plötzlichkeit und Heftigkeit des Krankheitsausbruchs, das Entsetzen über die Symptome der Seuche, die Rat- und Hilflosigkeit der Mediziner, die Wirkungslosigkeit der Gegenmaßnahmen, die Risse und Brüche im sozialen Gefüge, speziell im familiären Zusammenhalt, der Zusammenbruch der gewohnten Riten, vor allem beim Sterben und Begräbnis, und schließlich die Angst vor der Verwilderung der Sitten und der Erosion der öffentlichen Ordnung.' (Seite 57)Volker Reinhardt setzt sich in seinem Buch ¿Die Macht der Seuche' detailliert mit dem Wüten der Pest von 1347 bis 1353 in Europa auseinander. Dabei zieht er auch Parallelen zwischen der Pest und der Covid-19-Pandemie, erwähnt Gemeinsamkeiten und Unterschiede.Im ersten Teil seines Buches (¿Die Pest und die Menschen') geht Reinhardt auf die Ausbreitung der Pest, Symptome und Ursachen, Anzahl der Toten etc. ein, im zweiten Teil (¿Die Menschen und die Pest') lässt er Augenzeugen zu Wort kommen, setzt sich genauer mit der Pest in Florenz, Rom, Mailand, Venedig, Avignon und Paris auseinander, erzählt von Pogromen in Würzburg, Straßburg und Frankfurt, thematisiert Ursachenforschung und Gegenmaßnahmen. Im dritten Teil (¿Die Menschen nach der Pest') berichtet Reinhardt von den Auswirkungen der Pest, z.B. auf unterschiedliche soziale Schichten, auf den Humanismus, auf Kunst und Kultur.Mir hat das Buch inhaltlich gut gefallen, obwohl ich das erste Kapitel als dasjenige empfinde, das sich am flüssigsten lesen ließ und das thematisch am spannendsten war.Sprachlich war mir das Buch bisweilen etwas zu sperrig, vor allem im späteren Verlauf des Buches. Auch empfand ich einige Schilderungen als zu ausufernd, z.B. die Berichte über die einzelnen Städte, und als etwas zu sachlich und trocken.Nichtsdestotrotz habe ich durch die Lektüre viel Neues erfahren, und Reinhardt schafft es, die von ihm angeschnittenen Themen verständlich zusammenzufassen und dem Leser viel Wissen zu vermitteln.¿Konkret bedeutet das: Wenn man aus der Geschichte der großen Seuchen etwas für die Zeit der Corona-Pandemie und ihre Folgen lernen kann, dann dass noch keine Epidemie jemals eine neue ¿Epoche' eingeläutet hat.' (Seite 235)








