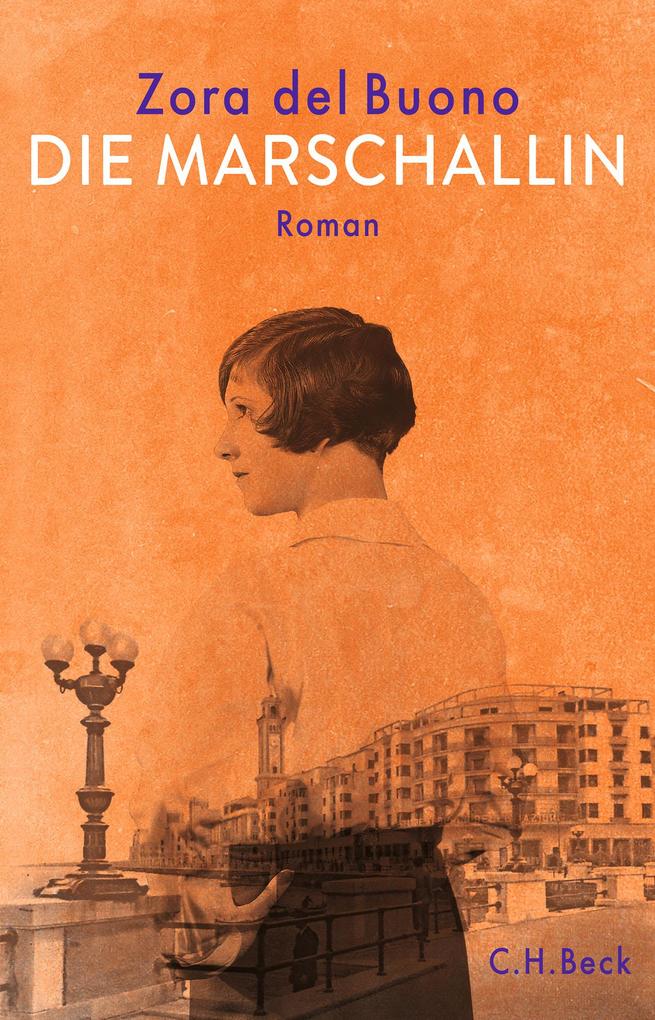
Zustellung: Fr, 27.12. - Mo, 30.12.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
DAS SCHILLERNDE PORTRÄT EINER MÄCHTIGEN FRAU IN MÖRDERISCHEN ZEITEN
Zora del Buono hat von ihrer Großmutter nicht nur den Vornamen geerbt, sondern auch ein Familienverhängnis, denn die alte Zora war in einen Raubmord verwickelt. Diese Geschichte und ihre Folgen bis heute erzählt dieser große Familienroman.
Die Slowenin Zora lernt ihren späteren Ehemann, den Radiologieprofessor Pietro Del Buono, am Ende des Ersten Weltkriegs kennen. Sie folgt ihm nach Bari in Süditalien, wo sie, beide überzeugte Kommunisten, ein großbürgerliches und doch politisch engagiertes Leben im Widerstand gegen den Faschismus Mussolinis führen. Zora ist herrisch, eindrucksvoll, temperamentvoll und begabt, eine Bewunderin Josip Broz Titos, dem sie Waffen zu liefern versucht und dem ihr Mann das Leben rettet. Sie will mehr sein, als sie kann, und drückt doch allen in ihrer Umgebung ihren Stempel auf. Ihr Leben und das Leben ihrer Familie, ihrer Kinder und Enkelkinder, vollziehen sich in einer Zeit der Kriege und der Gewalt, erbitterter territorialer und ideologischer Kämpfe, die unsere Welt bis heute prägen. In einem grandiosen Schlussmonolog erzählt die alte Zora Del Buono ihre Geschichte zu Ende, eine Geschichte der Liebe, der Kämpfe, des Hasses und des Verrats. «Die Marschallin» ist ein farbiger, lebenspraller Roman über eine unvergessliche Frau und ein tragisches Familienschicksal.
Zora del Buono hat von ihrer Großmutter nicht nur den Vornamen geerbt, sondern auch ein Familienverhängnis, denn die alte Zora war in einen Raubmord verwickelt. Diese Geschichte und ihre Folgen bis heute erzählt dieser große Familienroman.
Die Slowenin Zora lernt ihren späteren Ehemann, den Radiologieprofessor Pietro Del Buono, am Ende des Ersten Weltkriegs kennen. Sie folgt ihm nach Bari in Süditalien, wo sie, beide überzeugte Kommunisten, ein großbürgerliches und doch politisch engagiertes Leben im Widerstand gegen den Faschismus Mussolinis führen. Zora ist herrisch, eindrucksvoll, temperamentvoll und begabt, eine Bewunderin Josip Broz Titos, dem sie Waffen zu liefern versucht und dem ihr Mann das Leben rettet. Sie will mehr sein, als sie kann, und drückt doch allen in ihrer Umgebung ihren Stempel auf. Ihr Leben und das Leben ihrer Familie, ihrer Kinder und Enkelkinder, vollziehen sich in einer Zeit der Kriege und der Gewalt, erbitterter territorialer und ideologischer Kämpfe, die unsere Welt bis heute prägen. In einem grandiosen Schlussmonolog erzählt die alte Zora Del Buono ihre Geschichte zu Ende, eine Geschichte der Liebe, der Kämpfe, des Hasses und des Verrats. «Die Marschallin» ist ein farbiger, lebenspraller Roman über eine unvergessliche Frau und ein tragisches Familienschicksal.
- Ein farbiger Familienroman über eine starke Frau, politische Kämpfe und ein großes Verhängnis
- Eine Zeit der Kriege und der Gewalt, der Liebe und des Verrats
Inhaltsverzeichnis
Personenverzeichnis
Prolog
I
Bovec, Mai 1919
Berlin, November 1920
Neapel, Dezember 1923
Ustica, August 1927
Bari, November 1932
Bari, November 1935
Bovec, August 1938
Im Zug, Mai 1939
Bari, Juni 1940
Bari, April 1942
Bovec, Oktober 1943
Bari, Juni 1944
El Shatt, Februar 1946
Castel del Monte, Mai 1947
Bari, April 1948
Monopoli, Juli 1948
Bari, September 1948
II
Nova Gorica, Februar 1980
Epilog
Prolog
I
Bovec, Mai 1919
Berlin, November 1920
Neapel, Dezember 1923
Ustica, August 1927
Bari, November 1932
Bari, November 1935
Bovec, August 1938
Im Zug, Mai 1939
Bari, Juni 1940
Bari, April 1942
Bovec, Oktober 1943
Bari, Juni 1944
El Shatt, Februar 1946
Castel del Monte, Mai 1947
Bari, April 1948
Monopoli, Juli 1948
Bari, September 1948
II
Nova Gorica, Februar 1980
Epilog
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. März 2021
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
382
Autor/Autorin
Zora del Buono
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
610 g
Größe (L/B/H)
223/152/35 mm
ISBN
9783406754821
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Das alles wird mit vielen interessanten Figuren in einem großen Spannungsbogen erzählt, ohne Pathos oder Sentimentalität, dafür aber mit einem unterschwelligen Humor, der für die Menschenliebe der Autorin spricht.
Die ZEIT - Was wir lesen, Petra Gerster, heute-Moderatorin
"Den besten deutschsprachigen Roman des Herbstes hat die Schweizerin Zora del Buono geschrieben, einen reichen, abenteuerfrohen, lebenswahren Aktivistinnenroman.
SPIEGEL, Volker Weidermann
"Atemberaubend.
Süddeutsche Zeitung, Fritz Göttler
"Ein süffig und stilsicher erzählter Roman.
Neue Züricher Zeitung, Rainer Moritz
"Ein großer Wurf. ( ) Mit all seinen Figuren und Schauplätzen ist Die Marschallin` ein großes Lesevergnügen, so temperament- und grauenvoll, wie es das vergangene Jahrhundert vielleicht wirklich war.
Die ZEIT, Eva Menasse
"Del Buonos Buch ist so, wie Literatur sein soll: überraschend, nicht vorhersehbar, geduldig dabei, detailprall, abgründig, tiefsinnig, nicht moralisierend und frei von Klischees. Was del Buono macht, ist Kunst.
Die Weltwoche, Michael Maar
"Ein wundervoller, aktueller Roman. In das Leben dieser Frau hat sich Weltgeschichte eingeschrieben.
SRF 52 Beste Bücher, Felix Münger
"Dass der Roman stilistisch (zudem) ein unerhörtes Vergnügen ist, ohne jede Phrase oder Prätention, macht ihn zu einem doppelten glücklichen Sonderfall.
Spiegel Online, Elke Schmitter
"Präzise gezeichnete Miniaturen, die sich zu einem lebensprallen Panorama verbinden.
Gießener Anzeiger, Heidrun Helwig
"Detailgenau, vielschichtig und raffiniert. Bei Netflix würde Die Marschallin unter Filme mit starken Frauen einsortiert werden.
Die Tageszeitung, Doris Akrap
"Eine brillante Erzählarchitektin.
Schweiz am Wochenende, Julia Stephan
"Eine spannende Geschichtslektion.
Blick, Daniel Arnet
"`Die Marschallin` setzt nicht nur einer faszinierenden, widersprüchlichen Figur ein Denkmal, sondern lässt eine ganze Epoche erstehen, und wir bewegen uns staunend durch eine Welt, in der Multikulturalität zum ganz selbstverständlichen Alltag gehörte.
Neue Zürcher Zeitung, Manfred Papst
"Del Buono steht eine Sprache zu Gebote, deren Präzision in Poesie umschlägt."
Richard Kämmerlings, Die Welt
"Einen lebenssatteren Roman mit interessanteren Figuren kann man derzeit kaum finden." Elke Heidenreich, Kölner Stadtanzeiger
"Ein Jahrhundertroman.
SPIEGEL Online, Elke Heidenreich
"Die Stärke des Buches ist, dass alle Figuren so lebendig und vital sind, als wäre die Autorin dabei gewesen.
SRF Literaturclub, Nicola Steiner
"Große Familiensaga.
SonntagsBlick, Daniel Arnet
"Zora del Buonos Die Marschallin` ist der interessanteste Roman des deutschsprachigen Herbstes. SPIEGEL Online
Die ZEIT - Was wir lesen, Petra Gerster, heute-Moderatorin
"Den besten deutschsprachigen Roman des Herbstes hat die Schweizerin Zora del Buono geschrieben, einen reichen, abenteuerfrohen, lebenswahren Aktivistinnenroman.
SPIEGEL, Volker Weidermann
"Atemberaubend.
Süddeutsche Zeitung, Fritz Göttler
"Ein süffig und stilsicher erzählter Roman.
Neue Züricher Zeitung, Rainer Moritz
"Ein großer Wurf. ( ) Mit all seinen Figuren und Schauplätzen ist Die Marschallin` ein großes Lesevergnügen, so temperament- und grauenvoll, wie es das vergangene Jahrhundert vielleicht wirklich war.
Die ZEIT, Eva Menasse
"Del Buonos Buch ist so, wie Literatur sein soll: überraschend, nicht vorhersehbar, geduldig dabei, detailprall, abgründig, tiefsinnig, nicht moralisierend und frei von Klischees. Was del Buono macht, ist Kunst.
Die Weltwoche, Michael Maar
"Ein wundervoller, aktueller Roman. In das Leben dieser Frau hat sich Weltgeschichte eingeschrieben.
SRF 52 Beste Bücher, Felix Münger
"Dass der Roman stilistisch (zudem) ein unerhörtes Vergnügen ist, ohne jede Phrase oder Prätention, macht ihn zu einem doppelten glücklichen Sonderfall.
Spiegel Online, Elke Schmitter
"Präzise gezeichnete Miniaturen, die sich zu einem lebensprallen Panorama verbinden.
Gießener Anzeiger, Heidrun Helwig
"Detailgenau, vielschichtig und raffiniert. Bei Netflix würde Die Marschallin unter Filme mit starken Frauen einsortiert werden.
Die Tageszeitung, Doris Akrap
"Eine brillante Erzählarchitektin.
Schweiz am Wochenende, Julia Stephan
"Eine spannende Geschichtslektion.
Blick, Daniel Arnet
"`Die Marschallin` setzt nicht nur einer faszinierenden, widersprüchlichen Figur ein Denkmal, sondern lässt eine ganze Epoche erstehen, und wir bewegen uns staunend durch eine Welt, in der Multikulturalität zum ganz selbstverständlichen Alltag gehörte.
Neue Zürcher Zeitung, Manfred Papst
"Del Buono steht eine Sprache zu Gebote, deren Präzision in Poesie umschlägt."
Richard Kämmerlings, Die Welt
"Einen lebenssatteren Roman mit interessanteren Figuren kann man derzeit kaum finden." Elke Heidenreich, Kölner Stadtanzeiger
"Ein Jahrhundertroman.
SPIEGEL Online, Elke Heidenreich
"Die Stärke des Buches ist, dass alle Figuren so lebendig und vital sind, als wäre die Autorin dabei gewesen.
SRF Literaturclub, Nicola Steiner
"Große Familiensaga.
SonntagsBlick, Daniel Arnet
"Zora del Buonos Die Marschallin` ist der interessanteste Roman des deutschsprachigen Herbstes. SPIEGEL Online
 Besprechung vom 28.10.2020
Besprechung vom 28.10.2020
Ein Engel für Tito
Die Gefahr der Dominanz des Naheliegendsten: Zora del Buonos Roman "Die Marschallin"
Wohl der, die solches Personal für einen Familienroman aufbieten kann! Die Großmutter der Autorin wollte Titos Partisanen Waffen zukommen lassen und wurde vom späteren Staatspräsidenten Jugoslawiens mit einem Orden geehrt. Zora Del Buono war eine kleine, offenbar willensstarke Frau: Kommunistin, Arztgattin und Familienkommandeurin, herrschsüchtig in der näheren Umgebung, freigiebig in der weiteren. "Die Marschallin" wurde sie nicht nur wegen der abgöttischen Verehrung für Tito genannt, und ihre Enkelin - die nicht als Einzige in der Familie den Vornamen der Großmutter trägt, das Adelsprädikat jedoch anders als diese klein schreibt - übernahm die Rangbezeichnung als Titel ihres siebten Buchs.
Zora die Ältere wächst im westlichen Slowenien auf und lernt nach dem Krieg einen rothaarigen Sizilianer kennen. Der Arzt Pietro Del Buono behandelt ihren Bruder, der sich beim Spiel mit der immer noch herumliegenden Munition aus den jahrelangen Isonzoschlachten verletzt hat. Nach dem Studium der Radiologie in Berlin heiratet Pietro Zora. Erst leben sie in Neapel, dann in Bari, in einer Villa mit sechsundzwanzig Zimmern, die die tatkräftige Mutter von drei Söhnen entworfen hat. Ungeachtet des großbürgerlichen Lebenswandels, den die florierende radiologische Praxis erlaubt, sind die Eheleute überzeugte Kommunisten. Mussolinis Faschisten belästigen sie nicht, obwohl Zora und Pietro keinen Hehl aus ihrer Gesinnung machen. Pietro rettet sogar Tito das Leben, sein Vater hilft als Bürgermeister auf der Verbannungsinsel Ustica dem KP-Theoretiker Antonio Gramsci, und es gibt Kontakte zu Palmiro Togliatti, dem Leiter der verbotenen KPI, sowie zu Titos Partisanen.
So reizvoll sich diese stark geraffte Zusammenfassung anhört, so mühelos individuelle, familiäre und gesellschaftspolitische Sphären ineinander verflochten scheinen - der Roman liest sich, als gälte es, nicht von einem aufregenden Leben zu erzählen, sondern von einem für alle in der Umgebung anstrengenden. Vielleicht hat sich Zora del Buono, die 1962 geborene Journalistin und Buchautorin, den Schattenseiten der Familienüberlieferung nicht ganz entziehen können.
Ihr Roman schreitet in Momentaufnahmen voran, jedem Kapitel sind Ort und Jahr in Slowenien und Italien zwischen 1919 und 1948 vorangestellt. Aus einer Alltagssituation heraus - der Gang zu einem Vortrag, die Vorbereitung eines Abendessens, eine Zugfahrt, noch einmal die Stunden vor einem Abendessen - erinnern sich jeweils einer oder eine aus der Familie, selten auch ein Bekannter. Man lässt die seit dem letzten Kapitel verflossenen ein, zwei oder auch fünf Jahre Revue passieren, bevor die Vergangenheit zur Gegenwart aufschließt, zum Vortrag, dem Abendessen, der Ankunft im Bahnhof.
Die betont alltäglichen Erzählsituationen und der dominante Erinnerungsgestus beruhigen. Zu großen Teilen ist alles Neue, auch das Erschreckendste, immer schon geschehen: "ein Jahr war das nun her". Weil aber Zora del Buono mit Ausnahme von zwei Kapiteln alle auf diese eine Weise erzählt - ob nun ein Kind geboren, eine Schwiegertochter vergrault oder ein Mensch um sein Leben fürchtet -, wird der Leser regelrecht sediert.
Die Figur der Marschallin schrumpft dabei. Zwar ist von manchen Wutanfällen und Durchtriebenheiten die Rede. Doch die in der Erinnerung geschwungene Faust, der Hieb auf den Tisch, die vergifteten Worte zum Geschenk für die Schwiegertochter werden verkleinert im Guckloch des Rückblicks. An keiner Stelle gibt Zora del Buono der Impulsivität und der Leidenschaft ihrer Vorfahrin Raum, die den Gatten und andere Männer, so sagen sie jedenfalls, begeistert.
Geradezu kraftlos wirken manche Szenen. Als Pietro Anfang der zwanziger Jahre in Berlin studiert, scheint die Aufzählung der Passanten auf der Straße einer Fernsehvorabendserie zu entstammen ("Gassenjungen, Selbstgedrehte im Mundwinkel, auf dem Weg zur nächsten kleinen Gaunerei"), mündet aber - wie ein Geständnis wider Willen - in die Erwähnung von Alfred Döblin. Und das politische Interesse der Eheleute weiß Zora del Buono nur durch die gemeinsame Zeitungslektüre morgens im Bett zu veranschaulichen, nicht durch erhitzte, bis aufs Blut geführte Diskussionen über die scharfen Kurswechsel der Komintern. Den Roman zeichnet eine lähmende Dominanz des Naheliegendsten aus.
Der zweite Romanteil überspringt zweiunddreißig Jahre: 1980 grantelt die kränkelnde Zora in einem Altersheim in Nova Gorica ihrem Tod entgegen. Sie erinnert sich an den dementen Ehemann, den sie in einem italienischen Pflegeheim zurückgelassen hat, und an die vielen Toten der Familie. Außerdem sind in den Monolog, der die eigene Verantwortung für ein Mordopfer und andere tragische Ereignisse kleinredet, noch fünf Berichte eingehängt, die trocken und in kleinerer Schrift über die Tode von Verwandten und Freunden berichten. Ob sie nicht mehr in den Monolog hineinpassten? Alle fünf sterben bei Verkehrsunfällen. Das mag verbürgt sein, passt aber in seiner Monotonie zum Gesamteindruck.
JÖRG PLATH
Zora del Buono: "Die Marschallin". Roman.
Verlag C. H. Beck, München 2020. 382 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 23.09.2024
3,5 Sterne
LovelyBooks-Bewertung am 17.05.2023
Zora des Buono erzählt die Geschichte ihrer markanten Großmutter - sehr politische Einblicke zwischen 1919 und 1948 in Italien/Slowenien









