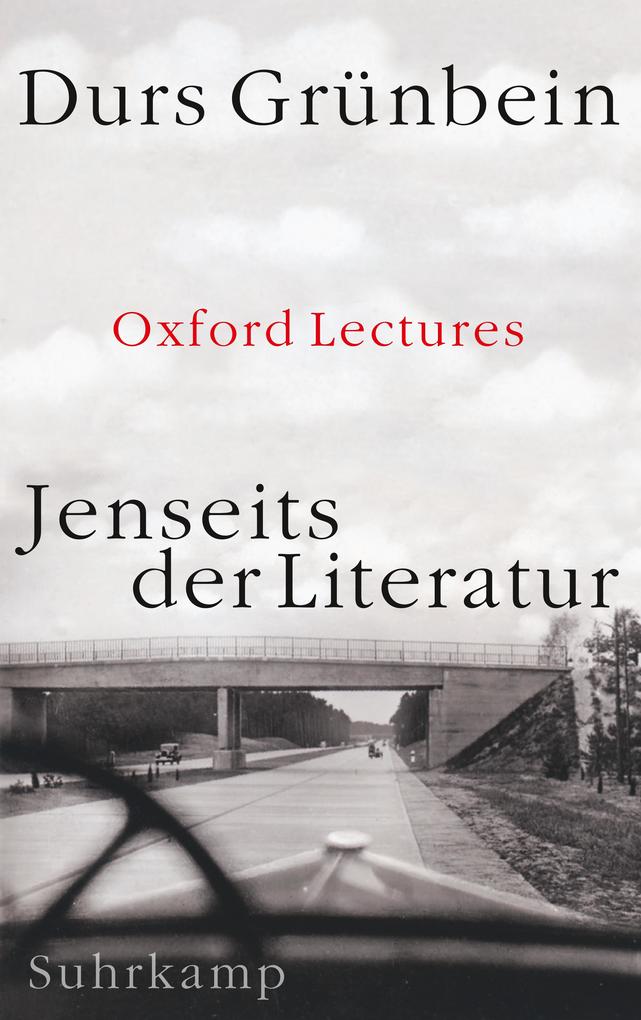
Zustellung: Mo, 28.04. - Mi, 30.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
In seinen vier Vorlesungen, die er als Lord Weidenfeld Lectures im Jahr 2019 in Oxford gehalten hat, setzt sich der Dichter Durs Grünbein mit einem Thema auseinander, das ihn seit jenem Augenblick beschäftigt hat, als er die eigene Position in der Geschichte seiner Nation, seiner Sprachgemeinschaft und seiner Familie als historisch wahrzunehmen begann: Wie kann es sein, dass DIE GESCHICHTE, seit Hegel und Marx ein Fetisch der Geisteswissenschaften, die individuelle Vorstellungskraft bis in die privaten Nischen, bis in den Spieltrieb der Dichtung hinein bestimmt? Will nicht anstelle dessen Poesie die Welt mit eigenen, souveränen Augen betrachten?
In Form einer Collage oder »Photosynthese«, in Text und Bild, lässt Grünbein den fundamentalen Gegensatz zwischen dichterischer Freiheit und nahezu übermächtiger Geschichtsgebundenheit exemplarisch aufscheinen: Von der scheinbaren Kleinigkeit einer Briefmarke mit dem Porträt Adolf Hitlers bewegt er sich über das Phänomen der »Straßen des Führers«, also der Autobahnen, hinein in die Hölle des Luftkriegs. Am Schluss aber steht eine erste Erfahrung von Ohnmacht im Schreiben und die daraus erwachsende, bis heute gültige Erkenntnis: »Es gibt etwas jenseits der Literatur, das alles Schreiben in Frage stellt. Und es gibt die Literatur, die Geschichte in Fiktionen durchkreuzt. «
Die renommierten Lord Weidenfeld Lectures sind seit 1993 einer der Höhepunkte im akademischen Jahr der Universität Oxford. Dazu eingeladen werden bedeutende Geisteswissenschaftler, Schriftsteller und Dichter. Zu den früheren Inhabern dieser Professur zählen George Steiner, Umberto Eco, Amos Oz und Mario Vargas Llosa.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. Oktober 2020
Sprache
deutsch
Auflage
Originalausgabe
Seitenanzahl
176
Autor/Autorin
Durs Grünbein
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
Mit 40 Abbildungen
Gewicht
248 g
Größe (L/B/H)
208/128/15 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783518429518
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Durs Grünbeins faszinierender Versuch einer alternativen Geschichte der NS-Zeit. « Manfred Osten, DIE WELT
»Mit seinen im besten Sinne engagierten Lectures leistet Durs Grünbein seinen Teil gegen die fatale Sehnsucht nach der geschlossenen Gesellschaft. « Kai Sina, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Grünbein [kann] durch seine inspirierten Recherchen ebenso überzeugen wie durch den anderen Blick, mit dem er Bekanntes wieder fremd macht. « Hermann Wallmann, WDR
»Grünbein bewegt sich sprachlich wie fachlich gekonnt im NS-Koordinatensystem und analysiert, wie wirkmächtig Technik, Ideologie und Sprache sich verbunden haben. « Passauer Neue Presse
»Durs Grünbein ist ein Meister des [Essay-]Genres . . . « ORF
»Jenseits der Literatur ist ein geharnischter, kluger und umsichtiger Essay. « Michael Braun, Kölner Stadt-Anzeiger
»Durs Grünbeins brillanter Gedankenstrom in vier Teilen sollte viel diskutiert und gelesen werden. « Peter Helling, NDR
»Ausgehend vom historischen Detail und ausgerüstet mit einem enormen Wissen, zieht [Durs Grünbein] historische Koordinaten nach und sucht nach den Verschaltungen von Technik, Ideologie und Sprache. « Jörg Schieke, MDR Kultur
»Mit seinen im besten Sinne engagierten Lectures leistet Durs Grünbein seinen Teil gegen die fatale Sehnsucht nach der geschlossenen Gesellschaft. « Kai Sina, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Grünbein [kann] durch seine inspirierten Recherchen ebenso überzeugen wie durch den anderen Blick, mit dem er Bekanntes wieder fremd macht. « Hermann Wallmann, WDR
»Grünbein bewegt sich sprachlich wie fachlich gekonnt im NS-Koordinatensystem und analysiert, wie wirkmächtig Technik, Ideologie und Sprache sich verbunden haben. « Passauer Neue Presse
»Durs Grünbein ist ein Meister des [Essay-]Genres . . . « ORF
»Jenseits der Literatur ist ein geharnischter, kluger und umsichtiger Essay. « Michael Braun, Kölner Stadt-Anzeiger
»Durs Grünbeins brillanter Gedankenstrom in vier Teilen sollte viel diskutiert und gelesen werden. « Peter Helling, NDR
»Ausgehend vom historischen Detail und ausgerüstet mit einem enormen Wissen, zieht [Durs Grünbein] historische Koordinaten nach und sucht nach den Verschaltungen von Technik, Ideologie und Sprache. « Jörg Schieke, MDR Kultur
 Besprechung vom 14.01.2021
Besprechung vom 14.01.2021
Ein Buch der Unruhe gegen 28 Prozent
Funkkontakt mit den Toten: In seinen "Oxford Lectures" erklärt Durs Grünbein sein Schreiben
Wenn es die Zeit verlangt, sollte auch ein Dichter sich nicht zu fein sein, in die Arena zu steigen. Dieser Maxime scheint Durs Grünbein bereits seit einigen Jahren zu folgen. Unter großer öffentlicher Anteilnahme geschah dies, als er 2018 bei einer skandalträchtigen Dresdner Podiumsveranstaltung zum Thema Meinungsfreiheit gegen einen echauffierten Uwe Tellkamp, dem aus dem Publikum der neurechte Publizist Götz Kubitschek zur Seite sprang, die Grundprinzipien der offenen Gesellschaft verteidigte. Aber nicht nur in der Sache stellte sich Grünbein gegen seinen Mitdiskutanten, sondern auch im Stil: Dem autoritären Gestus Tellkamps, der mit einem irritierenden Beleidigtsein einherging, begegnete er mit einer bis in die Körperhaltung reichenden Gelassenheit, ohne dabei in der Sache weniger entschieden zu sein. Das war groß.
Grünbeins Vorlesungen, die er 2019 als Inhaber der Weidenfeld-Gastprofessur an der Universität Oxford vorgetragen hat, kommen nun ebenfalls ohne jede intellektuelle Spitzfingerigkeit daher. Dies zeigt sich zunächst in der Redeweise. Grünbein wurde in der Vergangenheit, oft mit Bewunderung, von einigen auch mit Befremden, als gelehrter Dichter bezeichnet, was insbesondere aus seiner intensiven Neigung zur antiken Kultur und einem damit einhergehenden ornatus difficilis herrührte. Wie anders, wie bemerkenswert geradeheraus dagegen nun die "Oxford Lectures", in denen sich Grünbein unverhohlen gegen die regressiven bis revanchistischen Tendenzen der deutschen Gegenwart wendet: "Keiner springt aus der historischen Zeit, niemand entzieht sich der Formung durch die Geschichte . . . Und so gibt es auch nicht den vielbeschworenen Schlußstrich." Eine erinnerungspolitische Selbstverständlichkeit, die auszusprechen fast ein bisschen banal sein könnte? So hätte man, so hätte vermutlich auch Grünbein selbst vor einigen Jahren noch eingewandt. Heute kann man es offenbar nicht oft und nicht ausdrücklich genug sagen.
Dem gegenwärtig in der Tat viel-, nämlich laut Umfrage von präzise 28 Prozent der Deutschen beschworenen Wunsch nach einem "Schlußstrich" hat Grünbein zunächst nur eines entgegenzusetzen, nämlich seine "Unruhe". Von ihr spricht er in der ersten und in der letzten der insgesamt vier Vorlesungen. Von der Unruhe des Kindes, in dessen Briefmarkensammlung sich auch eine Marke mit dem Kopf desjenigen Mannes befindet, "dessen Name sich damals nur hinter vorgehaltener Hand aussprechen ließ". Und von der Unruhe des Erwachsenen, der nicht davon ablassen kann, "wie gebannt auf die irren zwölf Jahre der Naziherrschaft" zu blicken, ohne dabei sicher bestimmen zu können, woher dieses Gebanntsein eigentlich rührt.
Die erste Lecture setzt also mit Überlegungen zur Hitler-Briefmarke im Kontext der NS-Propaganda ein. Grünbein hebt dabei mit starkem Ekel das massenhafte Ablecken der Marke hervor, "die Vorstellungen dieser sklavischen Vielzüngigkeit, Doppelzüngigkeit, klebrigen Servilität". Im nächsten Vortrag spricht er über die Autobahn, jahrzehntelang die Lieblingschiffre der Geschichtsrelativierer, und beschreibt dabei nicht bloß den ideologischen und ästhetischen Gehalt des riesigen Bauprojekts (konkret: die Choreographierung der Autofahrt als überwältigendes Heimaterlebnis), sondern auch die Entrechtung und Ausbeutung der Arbeiter zu bloßen "Lohnsklaven" (denen, nach Kriegsbeginn, "echte Sklaven" folgen sollten, nämlich deportierte Zwangsarbeiter aus ganz Europa). Überreste hat der nationalsozialistische Autofetisch aber nicht nur in den Biographien und Landschaften hinterlassen, sondern auch in der Sprache: Aus Victor Klemperers klassischer Untersuchung der "Lingua Tertii Imperii" erfährt Grünbein, dass zum Beispiel das Wort "spuren" zunächst ein Begriff des Automobilbaus war, bevor die Nazis es gezielt auf den Bereich der Politik und der Gesellschaft übertrugen.
Das Interesse an Medien und Technik, Ideologie und Sprache, das sich in den ersten beiden Lectures ausdrückt, schlägt sich auch in der dritten nieder. Grünbein widmet sich in ihr dem anhaltenden Reizthema des Luftkriegs, wobei er der einseitigen Fixierung auf deutsches Leiden eine europäische Perspektive gegenüberstellt: Die Zerstörung Dresdens bezeichnet er, der ja selbst dorther stammt, als "das klägliche Ende der Angreifer", deren Bomben allein in England mehr als 40 000 Zivilisten umgebracht hatten. Jenseits dieser erinnerungspolitischen Intervention, die in stillschweigender Tradition der Radioreden von Thomas Mann steht und natürlich eine kritische Auseinandersetzung mit den umstrittenen Thesen W. G. Sebalds einschließt, beschäftigt sich Grünbein besonders eingehend mit der Funktion der seinerzeit hochmodernen Luftbildfotografie (unter anderem auf touristischen Postkarten), die man für die Planung der Bombardements genutzt hatte.
Schließlich erfolgt in der vierten Lecture der vielleicht etwas unvermittelte Sprung zur Literatur im engeren Sinne, genauer: zu einem Satz von Karl Philipp Moritz, den Grünbein schon früh als Zitat bei dem Philosophen Gilles Deleuze gefunden hat. Er lautet, von Deleuze in anderem Wortlaut wiedergegeben als im "Anton Reiser" zu finden: "Man schreibt für die sterbenden Kälber." Das Kalb stehe für die geschundene Kreatur schlechthin, so legt Grünbein aus, es repräsentiere den Kulminationspunkt einer "Gewaltgeschichte", die sich "transgenerativ" übertrage und somit buchstäblich "jeden" betreffe. Die unerlässliche Aufgabe der Literatur bestehe nun darin, die Überführung des individuellen Leids in eine "kollektive Erzählung" zu verhindern, weil es dadurch unweigerlich auf Abstand gebracht werde und die historische Allgemeinvorstellung verwirre. Als "Spezialisten", die gar nicht anders können, als "mit den Toten in andauerndem Funkkontakt" zu stehen (eine poetologische Grundansicht Grünbeins, die er schon in früheren Essays ausgearbeitet hat), sind es die Dichter, die diesen Prozess beständig durchkreuzen.
In diesem Sinne reagieren die Oxforder Vorträge auf die beunruhigende Ahnung, dass es heute eine "nostalgische Anziehungskraft" des Faschismus geben könnte, weil sich dieser mittlerweile zu einem "Mythos" verformt habe. Diese mythische, also durch die historische Realität nicht mehr gedeckte Erzählung zu stören, indem man ihr die reale Gewaltgeschichte der Jahre 1933 bis 1945 noch einmal, womöglich anders, jedenfalls mit allem Nachdruck entgegenhält - darin scheint zumindest eine Absicht dieser Vorlesungen zu liegen. Der Ton ist dabei über weite Strecken nüchtern und sachlich, zum Teil auch sehr persönlich und immer wieder thetisch zugespitzt, weshalb einige Aussagen unvermeidlich Rückfragen, möglicherweise auch Widerspruch provozieren werden - fair enough. Mit seinen im besten Sinne engagierten Lectures leistet Durs Grünbein seinen Teil gegen die fatale Sehnsucht nach der geschlossenen Gesellschaft.
KAI SINA
Durs Grünbein: "Jenseits der Literatur". Oxford Lectures.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 176 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








