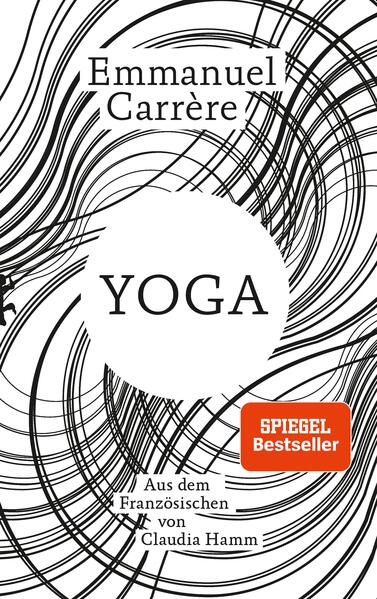
Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Alles beginnt gut: Emmanuel Carrère erfreut sich eines gelungenen Lebens und plant ein feinsinniges Büchlein über Yoga. Heiter und sachkundig will er seine Erkenntnisse über die »inneren Kampfkünste« darlegen, die er seit einem Vierteljahrhundert praktiziert. Bei seinen Recherchen in einem Meditationszentrum läuft noch alles bestens, doch dann wird er eingeholt: vom Tod eines Freundes beim Anschlag auf Charlie Hebdo, von unkontrollierbarer Leidenschaft, Trennung und Verzweiflung. Sein Leben kippt, eine bipolare Störung wird diagnostiziert und Carrère verbringt vier quälende Monate in der Psychiatrie, wo er versucht, seinen Geist mit Gedichten an die Leine zu legen. Entlassen und verlassen lernt er auf Leros in einer Gruppe minderjähriger Geflüchteter ganz anders Haltlose kennen, aber findet auch Trost durch Musik und Gespräch. Zurück in Paris stirbt sein langjähriger Verleger, und doch gibt es am Ende auch wieder Licht. Denn Yoga ist die Erzählung vom mal beherrschten, mal entfesselten Schwanken zwischen den Gegensätzen. Durch eine schonungslose Selbstanalyse zwischen Autobiografie, Essay, Chronik und Roman gelingt Carrère der Zugang zu einer tieferen Wahrheit: was es heißt, ein in den Wahnsinn der heutigen Welt geworfener Mensch zu sein.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
03. März 2022
Sprache
deutsch
Auflage
4. Auflage
Seitenanzahl
341
Autor/Autorin
Emmanuel Carrère
Übersetzung
Claudia Hamm
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Gewicht
554 g
Größe (L/B/H)
221/144/38 mm
ISBN
9783751800587
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 13.03.2022
Besprechung vom 13.03.2022
Die komische, aber schöne Leerstelle
Als Emmanuel Carrères Roman "Yoga" in Frankreich erschien, wehrte sich die Exfrau des Autors. Aber ist das für unsere Lektüre von Belang?
Als "Yoga" vor etwas mehr als einem Jahr in Frankreich erschien, schrieb jemand, die Aufregung um dieses Buch sei ein bisschen wie "Verbotene Liebe" in Café-de-Flore-Version. Das ganze kleine Milieu von Saint-Germain-des-Prés sprach wochenlang von nichts anderem. Man flüsterte sich die privaten Details des bröckelnden Liebesglücks der Carrères zu, mutmaßte, er habe das Buch umschreiben müssen, weil die Exfrau sonst gegen ihn prozessiert hätte, bedauerte, es sei vor den Kürzungen noch viel besser gewesen.
Besagte Exfrau befeuerte das Ganze dann noch zusätzlich, als sie in der Zeitschrift "Vanity Fair" eine Stellungnahme veröffentlichte, in der sie ihren Exmann der Lüge bezichtigte. Er, der immer behauptet habe, die Literatur sei der Ort der Wahrheit, erfinde oder verdrehe Dinge. Außerdem halte er sich nicht an die bei ihrer Scheidung getroffene Abmachung, dass sie bestimmen könne, ob und wie sie in seinen Büchern vorkomme; eine Abmachung, die in diesem Fall in der Tat dazu führte, dass alle Stellen, an denen sie erwähnt wurde, gestrichen werden mussten. Seinen Ausweichversuch, zu behaupten, vieles sei fiktiv, hielt sie zudem für doppelt opportunistisch, denn im Grunde, so glaubte sie, habe er doch nur eines im Sinn: den Prix Goncourt.
Man muss hier vielleicht dazusagen, dass die Sache mit dem Goncourt in Frankreich ein bisschen so ist wie die mit dem Oscar in den Vereinigten Staaten. Es gibt ein paar Künstler, die jedes Mal als Favoriten gelten und nie einen bekommen. Carrère ist seit langem einer dieser Kandidaten. Man warf ihm in der Vergangenheit trotz seines Erfolgs vor, er schreibe ja doch nur über sich, und diese Nabelschau sei, auch in ihrer genialsten Form, keine Fiktion, der Goncourt jedoch gehe nur an fiktionale Erzählungen. Diesmal, so vermutete man, würde es aber endlich klappen. Immerhin sprach man von dem Buch als "Roman", immerhin schrieb Carrère, wie gesagt, es sei zwar alles wahr, aber eben auch einiges total erfunden. Nur ging er dann am Ende des Jahres doch wieder ohne seinen Preis nach Hause. Vielleicht wegen des Skandals um Scheidungsverträge, Persönlichkeitsrechte und die Frage nach der Wahrheit in der Literatur.
Aber ist das für die Lektüre dieses Buches, das von so disparaten Dingen wie Yoga, Meditation, vom Attentat auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo", der Flüchtlingskrise, Depressionen, transzendental gutem Sex und einer Ehekrise handelt, ohne je fahrig zu wirken, überhaupt wichtig? Es mag für Carrère zwar schade um den Preis sein, für die Leserinnen und Leser ist es jedoch ziemlich egal. Wie es auch gleichgültig ist, ob der Mann nun vor oder nach seinem Psychiatrie-Aufenthalt auf der griechischen Insel Leros mit syrischen Flüchtlingen arbeitete. Oder ob er, wie er im Buch behauptet, zwei Monate oder, wie seine Exfrau meint, nur ein paar Tage auf der griechischen Insel blieb.
Das, was Emmanuel Carrère in "Yoga" schreibt, vermittelt, jenseits der Person des Autors, eine eigene literarische Wahrheit. Was sonst ist wichtig? Man kann sogar annehmen, dass diese akribische und selten zu seinen Gunsten ausfallende Introspektion eines Mannes, dessen so sicher geglaubtes Leben plötzlich durch sein eigenes Zutun auseinanderbricht, nach zwei Jahren Pandemie für noch mehr Menschen wahrhaftig und nachvollziehbar klingt als zuvor.
Es sei "ein Privileg, seinem chaotischen, holprigen und elenden Leben eine Form geben zu können", das weiß Emmanuel Carrère, nur gehe es doch im Grunde allen gleich: "Wenig schmeichelhafte, ja beschämende Dinge auszusprechen, hilft nicht nur einem selbst, sondern auch anderen", glaubt er. Und auch wenn dieses Buch nun wirklich und zum Glück trotz des Titels nichts von einem Selbsthilfebuch hat, stimmt das wahrscheinlich. Ursprünglich sollte es ganz anders werden. Es sollte, so berichtet Carrère zu Beginn des Textes immer wieder in rührend komischer Manier, ein heiteres und feinsinniges kleines Buch werden. Ein sonniges Nachdenken über Yoga und Meditation. Der Autor praktiziert beides seit Jahren, nicht wie wir als Gymnastik, sondern um, wie er meint, ein besserer Mensch zu werden.
Carrère, der seinen Lesern in früheren Büchern schon großzügige Einblicke in seine eher komplex geratene Psyche gegeben hat, strebt an, weniger narzisstisch und liebender zu sein. Der Mann, dem wir auf den ersten Seiten in einem Vipassana-Camp begegnen, glaubt offenbar auch daran, dass ihm das ein bisschen gelungen ist. Der Schriftsteller, der da auf seinem Zafu hockt und seinem Atem lauscht, glaubt, seinem selbstzerstörerischen Ich entkommen zu sein. Er glaubt, nur noch das "gewöhnliche Unglück", also die Dramen des Lebens, nicht mehr das "neurotische", also selbst produzierte Unglück fürchten zu müssen. Nur täuscht er sich leider.
Das Glück, das er seit zehn Jahren recht fassungslos, aber dankbar erlebt, bekommt einen zunächst unmerklichen, dann immer größer werdenden Riss, der sich irgendwann zu einem Abgrund auftut, auf den der Autor dann hilflos und ohne Bremsfunktion zurast. Dieser Riss ist eine Affäre, von der er erzählt. Der Abgrund tut sich unter anderem durch die Trennung von seiner Frau auf. Die wiederum beschreibt er nie, weil er sie, wie wir ja wissen, nicht beschreiben darf. Das schafft eine komische, aber auch schöne Leerstelle. Diese nie wirklich, also nie durch geschriebene Worte beendete Liebe schwebt weiter durch die Seiten wie ein Geist.
In gewisser Weise sorgt das ursprünglich ja nicht geplante Auslassen der Trennung, der furchtbaren Einsamkeit, die darauf folgt, für noch mehr Wahrhaftigkeit. Emmanuel Carrère erfährt hier, mit sechzig Jahren, dass er unter einer bipolaren Störung leidet, dass er zwei in einem ist, einer mit hohen Höhen, einer mit tiefen Tiefen, und dass nun leider der Zweite dran zu sein scheint. Der Autor verbringt mehrere Monate in der Psychiatrie des Pariser Krankenhauses Saint Anne, in der er mit Methoden behandelt wird, die mehr nach Antonin Artaud und Dreißigerjahren als nach Carrère und heute klingen: Man unterzieht ihn regelmäßigen Elektroschock-Sitzungen, die sein Gehirn auf null stellen, wie bei einem Reset.
Vielleicht ist dieser Teil, die "Geschichte meines Wahnsinns", der stärkste. Weil Carrère versucht, diesen Ort, also die Depression, zu beschreiben, wohl wissend, dass dieser Raum sich einem entzieht: Wenn man darin hockt, ist man davon überzeugt, nie wieder lebendig rauszukommen; wenn man draußen ist, hat man keine Ahnung, wie man je dort gelandet ist. Und auch wenn das alles nun wahrscheinlich entsetzlich deprimierend klingt, ist es das überhaupt nicht.
Dieses brutal ehrlich wirkende Buch stellt fest, was wir im Grunde alle wissen und woran Emmanuel Carrère noch einmal auf besonders harte Weise erinnert wurde: dass man sich selbst nicht entkommt, ganz gleich, wie sehr man daran glauben möchte. Durch die Liebe schon gar nicht.
Nur zeigt es auch, dass man überlebt. Wenn man sitzen bleibt, weiter atmet, die Gedanken kommen und gehen lässt, wie sie eben kommen und gehen. Insofern wird "Yoga" seinem Titel und dem ursprünglichen Plan des heiteren kleinen Buches auf unverhoffte Weise dann doch gerecht: Es wirkt wie eine besonders intensive Meditationssitzung.
ANNABELLE HIRSCH
Emmanuel Carrère: "Yoga". Aus dem Französischen von Claudia Hamm, Verlag Matthes & Seitz, 341 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 21.02.2025
Authentische biografische Erzählung, die gegen Ende jedoch etwas wirr wird. Interessante Infos zu Yoga und Meditation,
LovelyBooks-Bewertung am 06.04.2024
Beginnt sehr interessant, doch mit der Zeit wird es langatmig und sehr deprimierend¿









