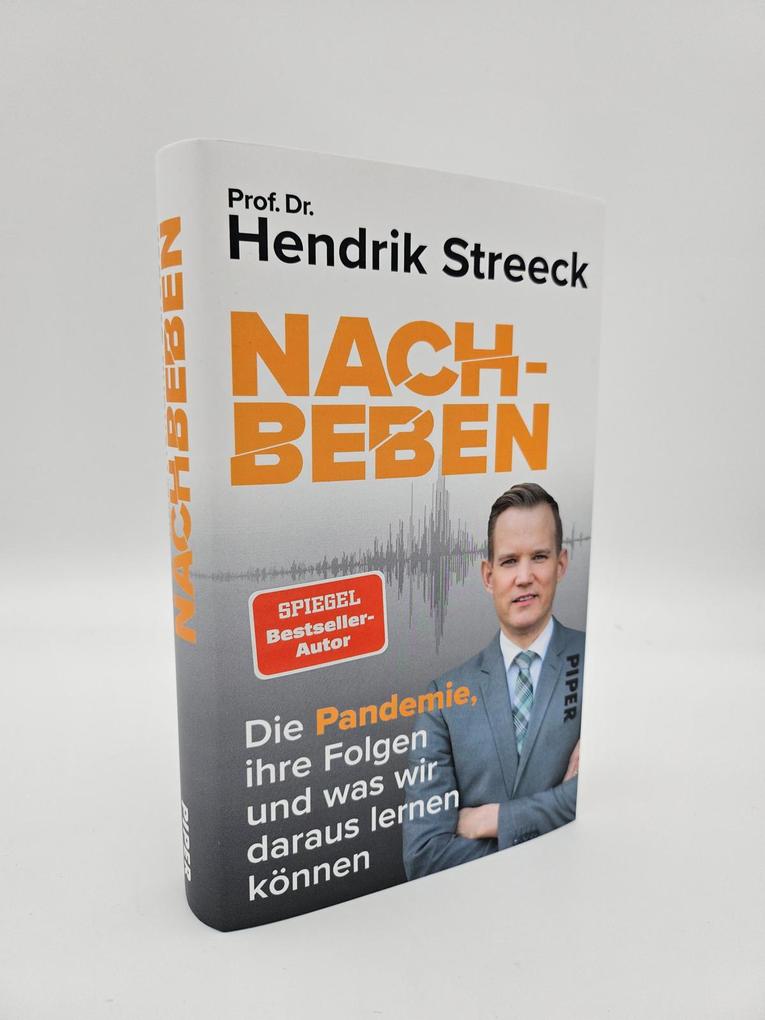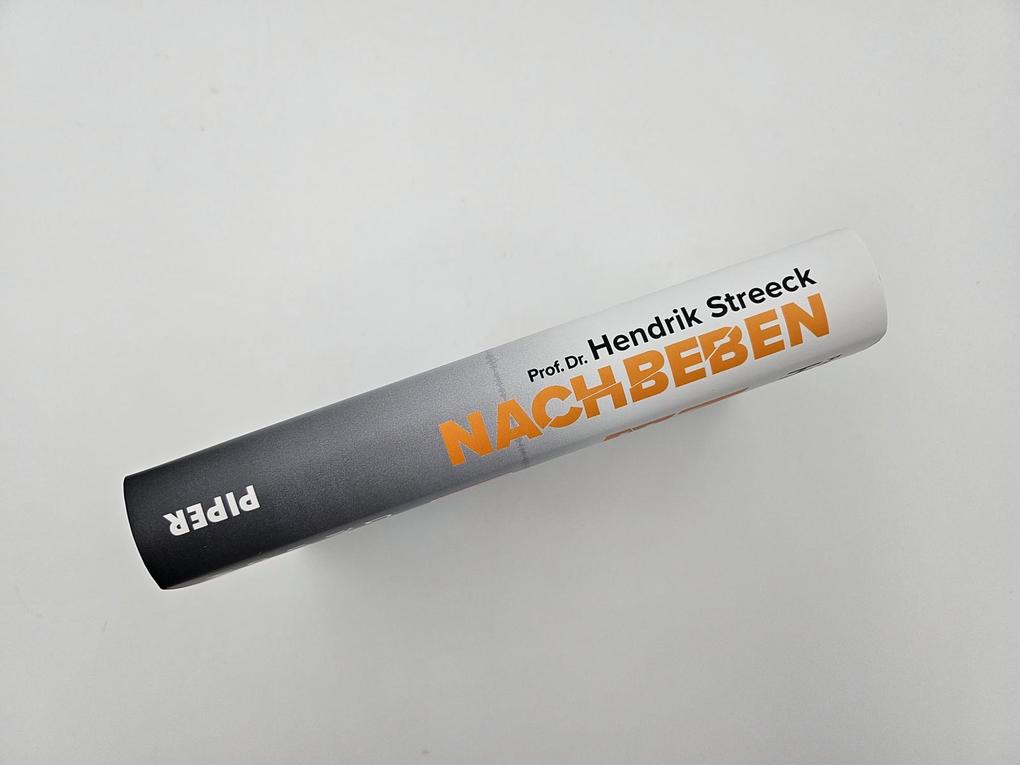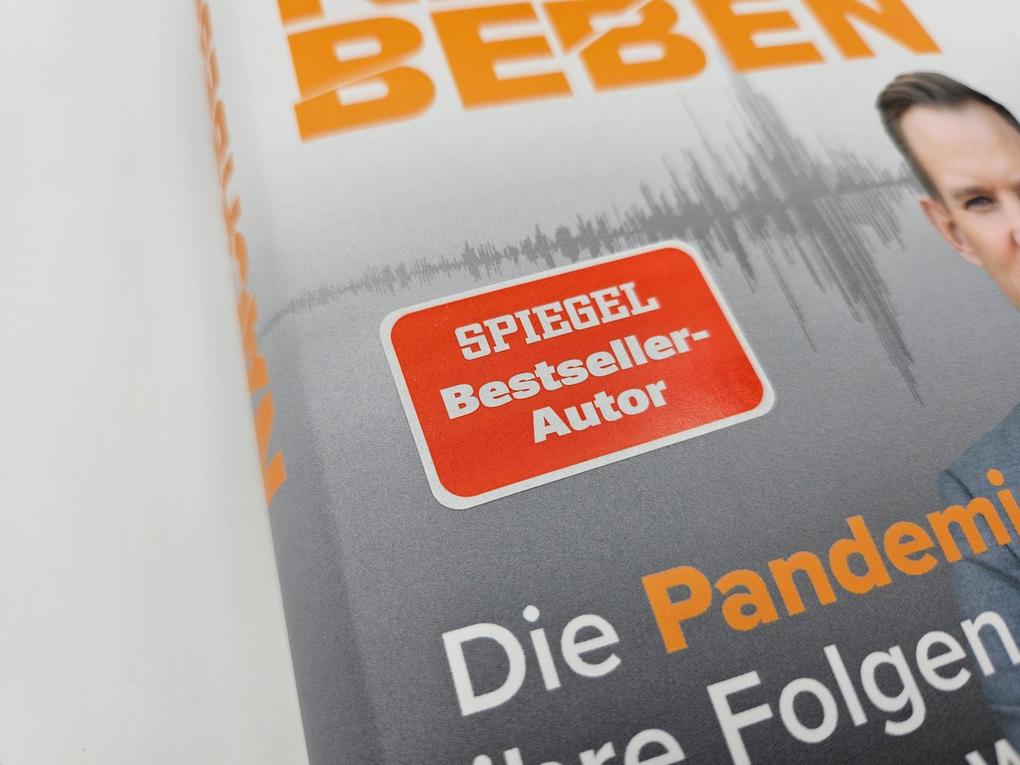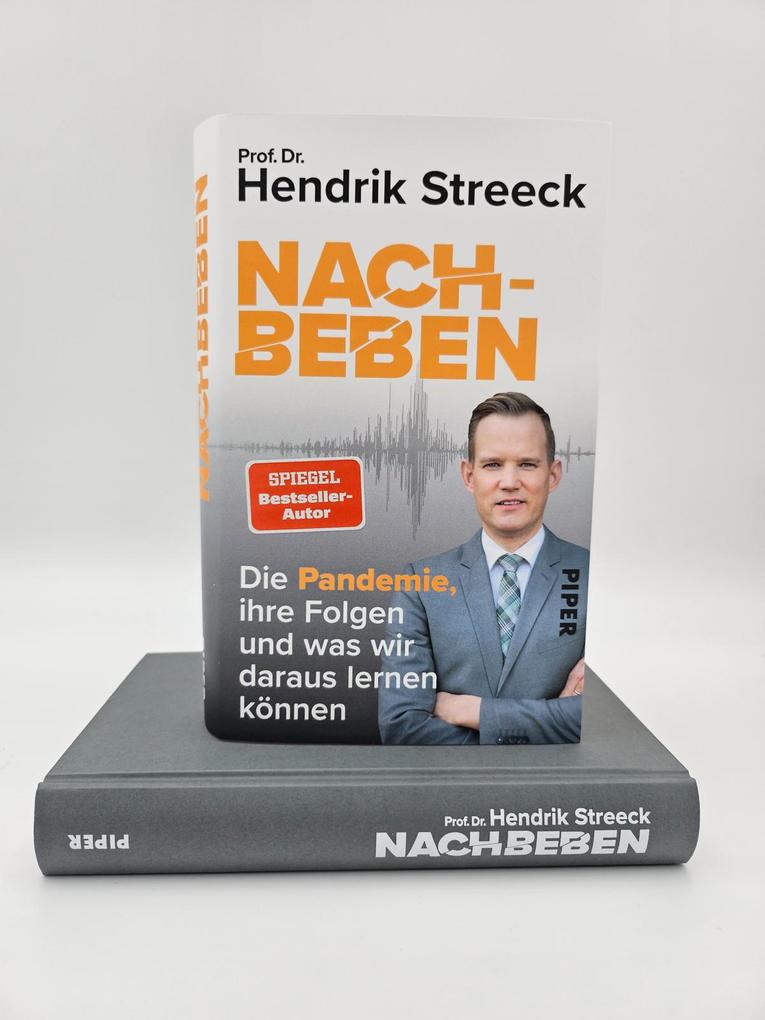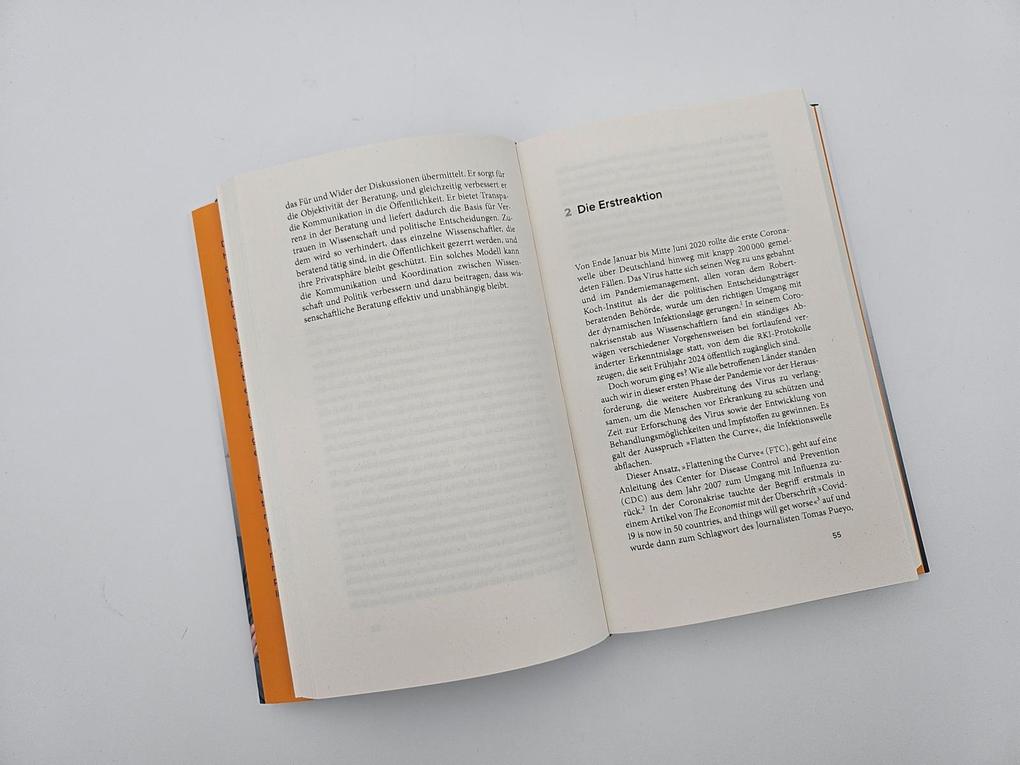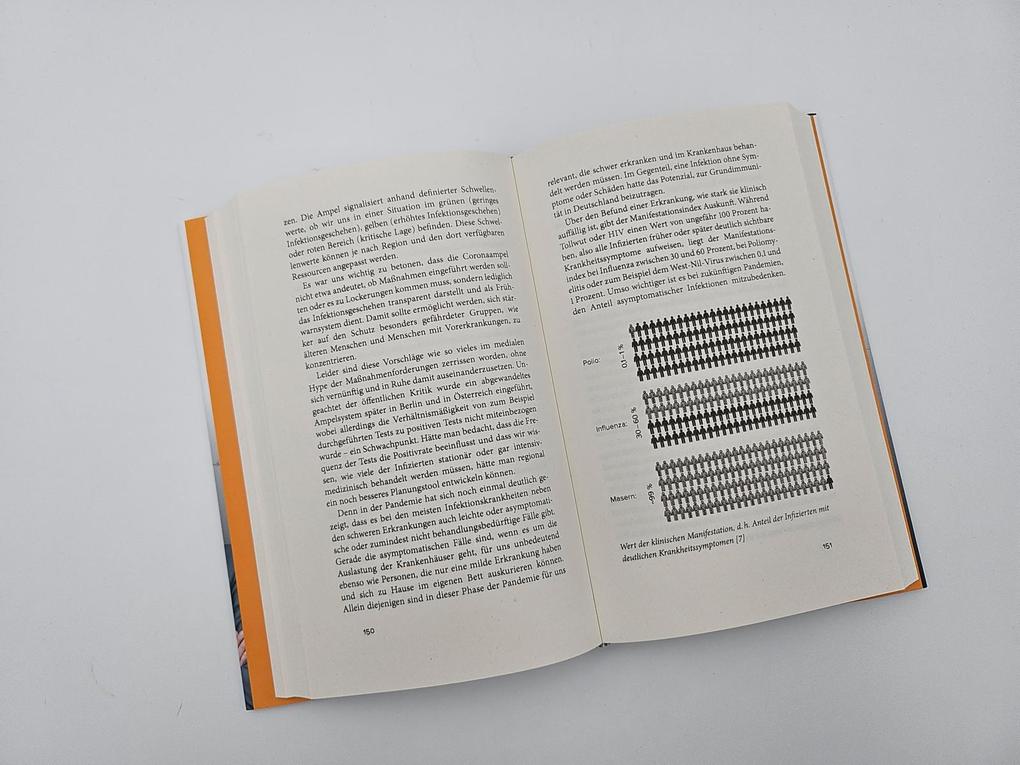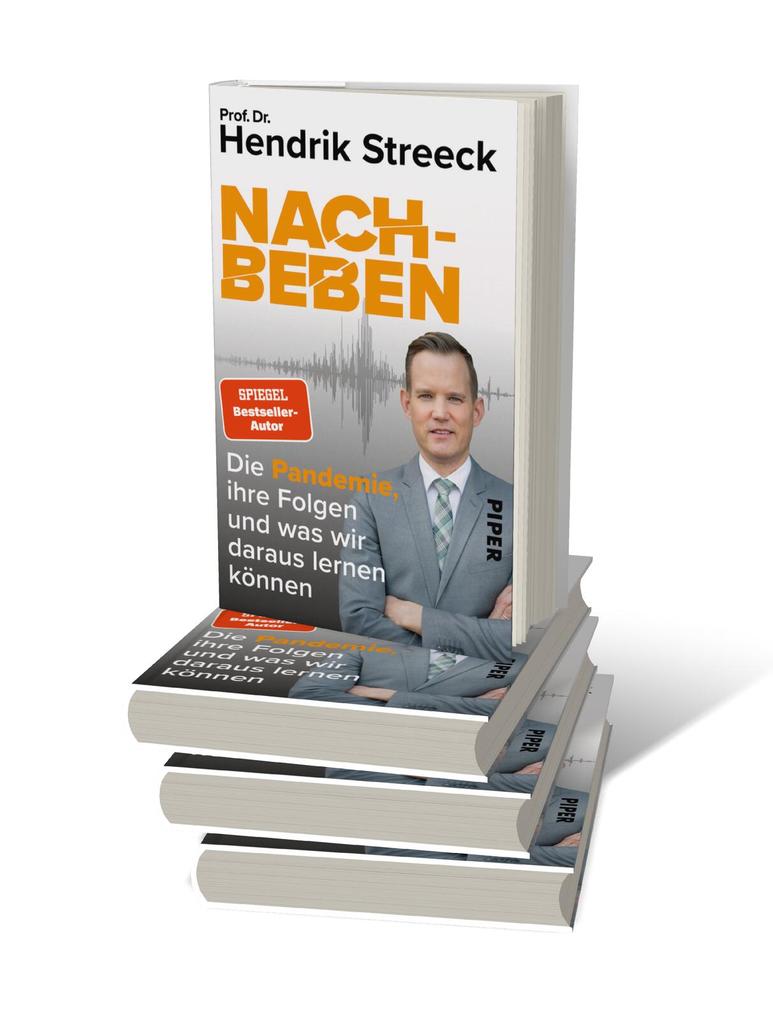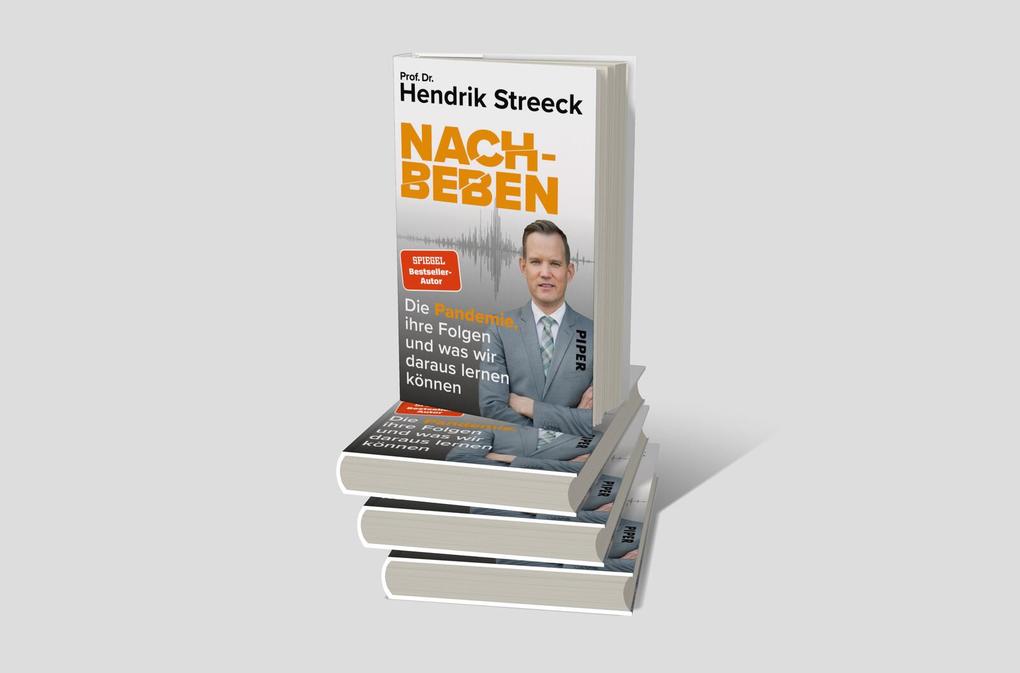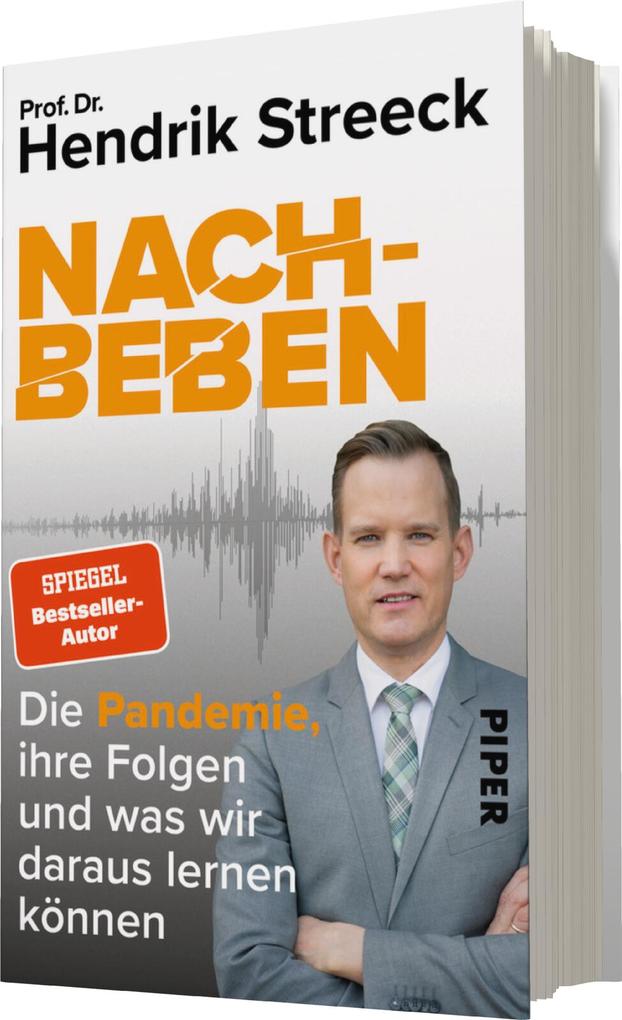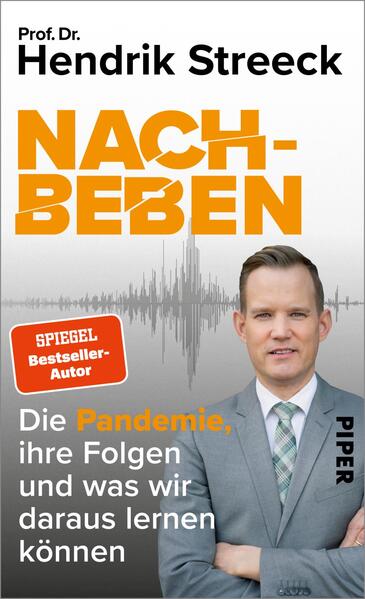
Zustellung: Do, 06.02. - Sa, 08.02.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die fällige Bilanz
Die Pandemie ist vorbei, das Virus ist geblieben. Drei Jahre Ausnahmezustand liegen hinter uns, die geprägt waren von Ungewissheit, von sinnvollen und sinnlosen Maßnahmen, von Warnungen, Mahnungen und Überspitzungen. Wir sollten diese Zeit nicht einfach verdrängen, sondern sie aufarbeiten, aus ihr lernen und die so gewonnenen Erkenntnisse nutzen, nicht zuletzt, um uns auf zukünftige Pandemien und Krisen aller Art besser vorzubereiten.
Essenziell für die richtigen Schlussfolgerungen ist eine ergebnisoffene, ehrliche, aber auch konsequente Aufarbeitung und Benennung von Fehlern und Versäumnissen. Dabei geht es nicht darum anzuklagen - es geht um Glaubwürdigkeit. Denn nur so können wir vermeintlich unversöhnliche Positionen auf dem Pfad eines offenen, diskussionsfreudigen und gar versöhnlichen Diskurses zusammenführen. Das ist nicht nur eine medizinische, sondern auch eine politische und gesamtgesellschaftliche Herausforderung.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
Auflage
Seitenanzahl
315
Autor/Autorin
Hendrik Streeck
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
416 g
Größe (L/B/H)
206/132/35 mm
ISBN
9783492073073
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Streecks Buch enthält wertvolle Hinweise für den Umgang mit künftigen Pandemien. « Markus Reiter, Stuttgarter Zeitung
 Besprechung vom 27.09.2024
Besprechung vom 27.09.2024
Aufrichtigkeit? Schön wär's
Wissenschaftsjournalismus dient ihm als Feindbild: Hendrik Streeck zieht eine Bilanz der Corona-Pandemie
Bald fünf Jahre sind vergangen, seit das Coronavirus in Deutschland angekommen ist. Im Rückblick löst jene Phase der Pandemie, die auf den ersten bestätigten Fall vom 28. Januar 2020 folgte, hauptsächlich drei Reaktionen aus. Ein großer Teil der Menschen ist erleichtert, dass das Ganze vorbei zu sein scheint. Viele, die unter den Langzeitfolgen ihrer Covid-Erkrankung leiden, fühlen sich damit alleingelassen. Wieder andere verlangen nach einer Aufarbeitung der Pandemie.
Zu dieser letzten Gruppe gehören Querdenker genauso wie Wissenschaftler, Experten und einige Politiker, die die richtigen Lehren aus den vergangenen Jahren ziehen wollen. Die nächste Pandemie kommt bestimmt, sagen sie - und wir sollten dann besser vorbereitet sein. Das findet auch Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Streeck war in der Hochphase der Pandemie häufiger Gast in Talkshows und profilierte sich mit Forderungen nach weniger Beschränkungen. Damit hob er sich von Christian Drosten ab, der an der Berliner Charité arbeitet und das "Team Vorsicht" repräsentierte.
39 Millionen nachgewiesene Infektionen, mehrere Hunderttausend Long-Covid-Fälle und rund 184.000 Corona-Tote in Deutschland später legt Streeck nun mit "Nachbeben" ein Buch vor, das auszuführen verspricht, was wir aus der Pandemie lernen können. Die Rückschau erscheint für den siebenundvierzigjährigen Wissenschaftler zu einem wichtigen Zeitpunkt: Anfang September nominierte ihn der CDU-Kreisverband Bonn als Direktkandidaten für den Bundestag. Die Monographie darf mithin als Versuch verstanden werden, der politischen Karriere eine Richtung zu geben. Es gelte, ist darin zu lesen, "die Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden, den Populismus zu bekämpfen und das Vertrauen in unsere demokratischen Institutionen wiederherzustellen".
Streeck beklagt, die Effizienz von Maßnahmen sei wissenschaftlich nicht ausreichend untersucht worden. Er schlägt vor, künftig systematischer und mithilfe von Praxisversuchen zu ermitteln, was bei der Eindämmung des Virus funktioniert und was nicht, etwa indem in einer Region eine Maskenpflicht gilt, während sie in einer anderen aufgehoben wird. Er regt an, dafür die Expertisen des Staates besser zu bündeln, und warnt davor, zu sehr auf seine eigene Disziplin zu hören. Vor allem Psychologen und Ökonomen möchte er stärker in die Krisenberatung einbezogen sehen. Zudem müsse man sich darüber Gedanken machen, wie der Schulunterricht in Pandemiezeiten gelingen kann.
Schließlich solle die wissenschaftliche Politikberatung in Deutschland straffer organisiert werden. Dabei schwebt Streeck vor, im Bundeskanzleramt einen wissenschaftlichen Chefberater zu installieren und Verfahren zu entwickeln, an deren Ende einzelne Forscher mit einem Sprechermandat ausgestattet werden. Solchen teils sinnvollen Lehren aus der Pandemie widmet der Autor leider nur wenig Platz. Den größten Teil beanspruchen Darlegungen, die den Effekt von Nebelkerzen haben. Geht es etwa um die Effizienz von Lockdowns, Masken und Testungen, gehen die vorliegenden Erkenntnisse immer wieder unter in einem Gemisch aus Details und widersprüchlichen Studienergebnissen. Laufend ist zu lesen, das alles sei doch "sehr komplex", und dass FFP2-Masken nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn man sie korrekt trägt, müsste eigentlich nicht erwähnt werden. Zur Impfung findet Streeck gleichwohl klare Worte: Ja, es gibt Nebenwirkungen, aber deren Zahl ist im Vergleich zur Zahl der Menschenleben, die sie gerettet hat, sehr klein.
Verständnis bringt Streeck auf für Aktionen wie #Allesdichtmachen, in deren Rahmen Schauspieler, Künstler und Regisseure im April 2021 auf ihre wirtschaftliche Not wegen abgesagter Veranstaltungen und Dreharbeiten aufmerksam machten. Die Aktion wurde damals von vielen als zynisch angesehen, ignoriere sie doch das Leid auf den Intensivstationen und der Hinterbliebenen. Die Initiatoren erhalten bei Streeck fast den Status einer verfolgten Minderheit, die angeblich bis heute viel weniger Aufträge bekommt.
Wissenschaftler haben Streeck zufolge Äußerungen zur Rolle von Schulen beim Infektionsgeschehen zurückgezogen, um nicht "im medialen Feuer zu verbrennen". Belege dafür gibt es keine. Überhaupt dient ihm der Wissenschaftsjournalismus als Feindbild. Aus seinen Reihen wurden Streecks Thesen häufig kritisiert, und so verschwindet die sonst demonstrierte Liberalität des Autors, wenn es heißt: "Der Wissenschaftsjournalismus sollte zwar Forschungsergebnisse klar kommunizieren und richtig einordnen, deren Bewertung sollte allerdings innerhalb der Wissenschaft erfolgen."
Am ärgerlichsten an "Nachbeben" ist, wie Streeck seine Rolle während der Pandemie sieht. Ein aufrichtiger Wissenschaftler hätte das Buch zum Anlass genommen, eigene Irrtümer einzuräumen, man denke an den Beginn von Corona, als Christian Drosten vor dem warnte, was uns bevorstand, während Streeck auf Twitter das Geschehen verharmloste. Sein erster Tweet zum Thema aus dem Januar 2020 lautete: "Nach den bisherigen Daten ist die #influenza dieses Jahr eine größere Gefahr als das neue #coronavirus. Die meisten Menschen scheinen nur milde Symptome zu haben." Einige Wochen später schob er nach: "Es sollte Mut machen, dass trotz der bisher fast 100 #SARSCoV2 Infektionen in Deutschland, wir nur selten schwere Verläufe sehen und keine Todesfälle zu beklagen haben. Unsere Einschätzung des Virus ist richtig gewesen." Eine lange Liste auch seiner späteren Irrtümer - etwa zur Herdenimmunität - hätte ein ganzes Kapitel darüber füllen können, warum Fehler zur Wissenschaft gehören und wie man damit umgeht. Streeck hingegen hat die beiden Tweets gelöscht.
Mehrfach kritisiert der Autor, andere hätten vorschnelle Folgerungen aus unreifen Daten gezogen. Unerwähnt bleibt, dass er selbst vorläufige, noch nicht begutachtete Daten aus dem kleinen Untersuchungsgebiet um Heinsberg heranzog, um an der Seite des damaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet in einer Pressekonferenz in der Düsseldorfer Staatskanzlei eine umgehende bundesweite Rücknahme der Lockdowns zu fordern. Während Streeck heute moniert, Christian Drostens Einschätzungen seien als Meinung der Wissenschaft als solcher aufgenommen worden, hat er selbst versucht, sich als deren Sprachrohr in Stellung zu bringen: "Positionspapier von Wissenschaft und Ärzteschaft zur Strategieanpassung im Umgang mit der Pandemie" hieß das Dokument, das er Ende 2020 medienwirksam als einer der Hauptautoren vorlegte.
Sachliche Fehler wie die Behauptung, der Marsch von Querdenkern auf den Reichstag habe Bestürzung ausgelöst, "da er an die Bilder der Stürmung des US-Capitols nach der Abwahl von Donald Trump erinnerte", mag man überlesen (der Sturm auf den Reichstag war 2020, der aufs Capitol 2021). Ins Auge stechen dafür Aussagen wie die, dass in Schleswig-Holstein "theoretisch jedem Covid-19-Infizierten ein Intensivbett" zur Verfügung hätte stehen können, "ohne die Kapazitäten zu überschreiten".
Streeck geht über das Leid der Menschen hinweg, die von Covid betroffen waren oder sind. Die trotz aller Maßnahmen immense Zahl der Toten blendet er weitgehend aus, sie ist ihm eigentlich nur eine statistische Nebenbetrachtung wert. Wird im Vorwort angerissen, in Deutschland sei eine Million Menschen von Long Covid betroffen, spielen diese teils Schwerkranken im Weiteren keine größere Rolle. Auch was die heutige Versorgung von Long-Covid-Patienten betrifft, bietet das Buch keinerlei Lehren. Insgesamt ist es für jene Leser, die sich einen Kompass für die Vorbereitung auf die nächste Pandemie erwarten, eine große Enttäuschung. CHRISTIAN SCHWÄGERL
Hendrik Streeck: "Nachbeben". Die Pandemie, ihre Folgen und was wir daraus lernen können.
Piper Verlag, München 2024. 320 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
am 05.11.2024
Sehr gut und sachlich geschrieben.
Die Pandemie ist Gott sei Dank vorbei, das Coronavirus ist leider geblieben. Haben wir etwas gelernt aus den letzten Jahren der Pandemie? Sehr sachlich und glaubwürdig stellt sich Hendrik Streeck vielen Fragen und versucht, Antworten zu finden, auch wenn es nicht immer eine klare und eindeutige gibt, wie zum Beispiel gleich zu Beginn: woher stammt SARS-CoV-2 wirklich? Vermutlich wird dies unklar bleiben, es existieren lediglich Vermutungen. In den einzelnen, sehr übersichtlich gestalteten Kapiteln das auch für Laien sehr gut lesbaren Sachbuchs folgt Streeck dem Verlauf der Corona-Pandemie und erläutert auf überaus seriöse Weise, welche sinnvollen Maßnahmen, aber auch, welche weniger nützlichen Vorschriften in rascher Abfolge auf die Menschen hereingeprasselt sind. Niemals geht es um Anklage oder Schuldzuweisung. Von der Möglichkeit, eine Pandemie zu verhindern über erste Reaktionen und Maßnahmen, Es geht weiter zur Impfung und einer Betrachtung des Themas Impfpflicht. Auch wenn es sehr schwierig ist, wird doch ab und zu auf andere Länder in Europa geschaut, um zu erfahren, wie es dort mit Lockdowns, Testen und Kontaktbeschränkungen ausgesehen hat. Hendrik Streeck bietet in seinem Buch viele Lösungsmöglichkeiten und Anregungen. Ich kann dieses Sachbuch für eine große Zahl an Lesern weiterempfehlen, denn eines ist gewiss die nächste Pandemie wird nicht ewig auf sich warten lassen.
LovelyBooks-Bewertung am 05.11.2024
Sehr gut und sachlich geschrieben.