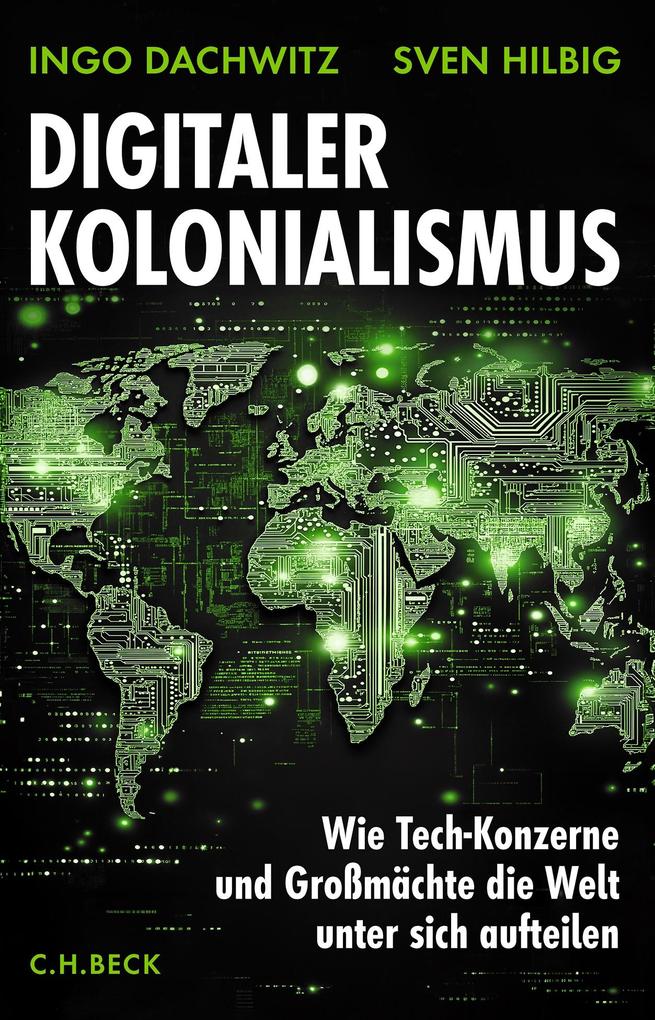
Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der Kolonialismus im digitalen Zeitalter - wie Tech-Imperien die Welt unter sich aufteilen
Innovativ, mächtig, rücksichtlos: Kaum eine Geschichte wird so oft erzählt wie die vom unaufhaltsamen Aufstieg der Tech-Konzerne an die Spitze der global vernetzten Welt. Nur ein Kapitel wird dabei ausgelassent: Der Preis, den der globale Süden dafür bezahlt. Der Tech-Journalist Ingo Dachwitz und der Globalisierungsexperte Sven Hilbig beleuchten diesen blinden Fleck und zeigen die weltweiten Folgen des digitalen Kolonialismus sowie bestehende Ansätze für eine gerechtere Digitalisierung auf. Soviel steht fest: AI will not fix it.
Das Versprechen der Digitalen Revolution ist die Heilserzählung unsererZeit. Dieses Buch erzählt eine andere Geschichte: Die des digitalen Kolonialismus. Statt physisches Land einzunehmen, erobern die heutigen Kolonialherren den digitalen Raum. Statt nach Gold und Diamanten lassen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen nach Rohstoffen graben, die wir für unsere Smartphones benötigen. Statt Sklaven beschäftigen sie Heere von Klickarbeiter:innen, die zu Niedriglöhnen in digitalen Sweatshops arbeiten, um soziale Netzwerke zu säubern oder vermeintlich Künstliche Intelligenz am Laufen zu halten. Der Kolonialismus von heute mag sich sauber und smart geben, doch eines ist gleich geblieben: Er beutet Mensch und Natur aus und kümmert sich nicht um gesellschaftliche Folgen vor Ort. Im Wettkampf der neuen Kolonialmächte ist Digitalpolitik längst zum Instrument geopolitischer Konflikte geworden - der Globale Süden gerät zwischen die Fronten.
Innovativ, mächtig, rücksichtlos: Kaum eine Geschichte wird so oft erzählt wie die vom unaufhaltsamen Aufstieg der Tech-Konzerne an die Spitze der global vernetzten Welt. Nur ein Kapitel wird dabei ausgelassent: Der Preis, den der globale Süden dafür bezahlt. Der Tech-Journalist Ingo Dachwitz und der Globalisierungsexperte Sven Hilbig beleuchten diesen blinden Fleck und zeigen die weltweiten Folgen des digitalen Kolonialismus sowie bestehende Ansätze für eine gerechtere Digitalisierung auf. Soviel steht fest: AI will not fix it.
Das Versprechen der Digitalen Revolution ist die Heilserzählung unsererZeit. Dieses Buch erzählt eine andere Geschichte: Die des digitalen Kolonialismus. Statt physisches Land einzunehmen, erobern die heutigen Kolonialherren den digitalen Raum. Statt nach Gold und Diamanten lassen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen nach Rohstoffen graben, die wir für unsere Smartphones benötigen. Statt Sklaven beschäftigen sie Heere von Klickarbeiter:innen, die zu Niedriglöhnen in digitalen Sweatshops arbeiten, um soziale Netzwerke zu säubern oder vermeintlich Künstliche Intelligenz am Laufen zu halten. Der Kolonialismus von heute mag sich sauber und smart geben, doch eines ist gleich geblieben: Er beutet Mensch und Natur aus und kümmert sich nicht um gesellschaftliche Folgen vor Ort. Im Wettkampf der neuen Kolonialmächte ist Digitalpolitik längst zum Instrument geopolitischer Konflikte geworden - der Globale Süden gerät zwischen die Fronten.
- "Beim digitalen Kolonialismus fließen Daten und Profite nur in eine Richtung." Renata Ávila Pinto, Menschenrechtsverteidigerin
- KI und Daten, Rohstoffe und Repression: Eine umfassende Analyse des digitalen Kolonialismus
- Augenöffner für Leser:innen: Wieso die Digitalisierung auf Ausbeutung beruht
- Die Rolle Europas neben den Digitalimperien USA und China
- Sehr gut lesbare Mischung aus tiefgreifender Analyse und bewegenden Reportagen
- Basierend auf Kooperationen und Interviews mit Forscher:innen und Aktivist:innen aus dem Globalen Süden
- Mit einem eindringlichen Appell von Renata Ávila Pinto, Geschäftsführerin der "Open Knowledge Foundation"
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Des Kolonialismus neue Kleider
1. Arbeitskraft: Die ausgebeuteten Arbeiter:innen hinter der Künstlichen Intelligenz
1. 1 Geisterarbeit
1. 2 Das Milliardengeschäft mit der Content Moderation
1. 3 Die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen imTech-Outsourcing
1. 4 Die politische Ökonomie der globalen Arbeitsteilung
1. 5 Der Widerstand der Geisterarbeiter:innen
2. Daten: Gefährlicher Extraktivismus der Tech-Konzerne
2. 1 Die Datenökonomie: Fest in der Hand von Konzernen aus dem Globalen Norden
2. 2 Daten und KI als koloniales Herrschaftswissen
2. 3 Digitale Landwirtschaft: Reiche Ernte für Tech- und Agrarkonzerne
3. Rohstoffe: Digitaler Fortschritt auf Kosten von Menschen und Natur
3. 1 Koloniale Kontinuität: Der «Ressourcenfluch» des Globalen Südens
3. 2 Mythos grüne Digitalisierung
3. 3 Kobalt-Abbau in der Demokratischen Republik Kongo: Die sozial-ökologischen Kosten des Ressourcenhungers
3. 4 Lithiumabbau in Südamerika: Wer profitiert vom Boom des weißen Goldes?
4. Repression: Das blutige Geschäft mit Zensur, Überwachung und Kontrolle
4. 1 Zensur, Hass und Propaganda: Wie sich Soziale Medien zu Handlangern von autoritären Regimen machen
4. 2 Die Globale Überwachungsindustrie: Profit und Kontrolle im Dienst der kolonialen Ordnung
5. Infrastruktur: Wie Kabel- und Satellitenprojekte die Abhängigkeit des Globalen Südens aufrechterhalten
5. 1 Tiefer, schneller, weiter: Unterseekabel und die digitale Souveränität des Globalen Südens
5. 2 Satelliteninternet und das neue Wettrennen um den Weltraum
6. Geopolitik: Wie sich das Wettrennen der digitalen Großmächte USA und China auf den Globalen Süden auswirkt
6. 1 Chinas Aufstieg zur digitalen Kolonialmacht
6. 2 Die WTO , der Kalte Tech-Krieg und seine Folgen
7. Europa: Das falsche Versprechen vom Dritten Weg der Digitalisierung
7. 1 Zwischen Werten und Wertschöpfung: Europas «Dritter Weg»
7. 2 Global Gateway: Europas Tor zu den Daten und Rohstoffen Afrikas
7. 3 Festung Europa: Mit Technik gegen Geflüchtete
7. 4 Unsere Verantwortung
Wider den digitalen Kolonialismus: Nachwort von Renata Ávila Pinto
Danksagung
Bildnachweis
Anmerkungen
1. Arbeitskraft: Die ausgebeuteten Arbeiter:innen hinter der Künstlichen Intelligenz
1. 1 Geisterarbeit
1. 2 Das Milliardengeschäft mit der Content Moderation
1. 3 Die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen imTech-Outsourcing
1. 4 Die politische Ökonomie der globalen Arbeitsteilung
1. 5 Der Widerstand der Geisterarbeiter:innen
2. Daten: Gefährlicher Extraktivismus der Tech-Konzerne
2. 1 Die Datenökonomie: Fest in der Hand von Konzernen aus dem Globalen Norden
2. 2 Daten und KI als koloniales Herrschaftswissen
2. 3 Digitale Landwirtschaft: Reiche Ernte für Tech- und Agrarkonzerne
3. Rohstoffe: Digitaler Fortschritt auf Kosten von Menschen und Natur
3. 1 Koloniale Kontinuität: Der «Ressourcenfluch» des Globalen Südens
3. 2 Mythos grüne Digitalisierung
3. 3 Kobalt-Abbau in der Demokratischen Republik Kongo: Die sozial-ökologischen Kosten des Ressourcenhungers
3. 4 Lithiumabbau in Südamerika: Wer profitiert vom Boom des weißen Goldes?
4. Repression: Das blutige Geschäft mit Zensur, Überwachung und Kontrolle
4. 1 Zensur, Hass und Propaganda: Wie sich Soziale Medien zu Handlangern von autoritären Regimen machen
4. 2 Die Globale Überwachungsindustrie: Profit und Kontrolle im Dienst der kolonialen Ordnung
5. Infrastruktur: Wie Kabel- und Satellitenprojekte die Abhängigkeit des Globalen Südens aufrechterhalten
5. 1 Tiefer, schneller, weiter: Unterseekabel und die digitale Souveränität des Globalen Südens
5. 2 Satelliteninternet und das neue Wettrennen um den Weltraum
6. Geopolitik: Wie sich das Wettrennen der digitalen Großmächte USA und China auf den Globalen Süden auswirkt
6. 1 Chinas Aufstieg zur digitalen Kolonialmacht
6. 2 Die WTO , der Kalte Tech-Krieg und seine Folgen
7. Europa: Das falsche Versprechen vom Dritten Weg der Digitalisierung
7. 1 Zwischen Werten und Wertschöpfung: Europas «Dritter Weg»
7. 2 Global Gateway: Europas Tor zu den Daten und Rohstoffen Afrikas
7. 3 Festung Europa: Mit Technik gegen Geflüchtete
7. 4 Unsere Verantwortung
Wider den digitalen Kolonialismus: Nachwort von Renata Ávila Pinto
Danksagung
Bildnachweis
Anmerkungen
Produktdetails
Erscheinungsdatum
22. April 2025
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
351
Autor/Autorin
Ingo Dachwitz, Sven Hilbig
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 8 Karten und 1 Abbildung
Gewicht
532 g
Größe (L/B/H)
220/150/35 mm
ISBN
9783406823022
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Bravourös und nachvollziehbar
Die Presse
Sehr aufschlussreiches Buch
Bayern 2
Die Ungerechtigkeiten, die Ingo Dachwitz und Sven Hilbig anführen . . . die pure Masse an Fakten . . . ist schlicht alarmierend . . . Diese Dimensionen sichtbar zu machen, ist das große Verdienst dieses wichtigen Buches.
DLF, Vera Linß
Dachwitz und Hilbig liefern nicht nur eine fundierte Analyse des Ist-Zustandes, sie wollen auch Hoffnung machen, Lösungsansätze aufzeigen.
Delmenhorster Kreisblatt, Marco Julius
Wer verstehen will, wie und warum sich die Welt gerade in einem solchen Affentempo verändert, der wird sich mit diesem Buch so einiges an Klarheit verschaffen.
Süddeutsche Zeitung, Andrian Kreye
Die Autoren analysieren mit kühler Präzision, in einer Sprache, die nicht anklagt, sondern offenlegt. Sie schreiben gegen die Selbstverständlichkeit der digitalen Abhängigkeit an.
NZZ am Sonntag, Sylke Gruhnwald
Die Autoren schließen eine riesige Lücke in der öffentlichen Wahrnehmung.
der Freitag, Daniél Kretschmar
Ihre Abhandlung kommt zur rechten Zeit und wird hoffentlich eine große Leserschaft finden.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Eckert
Starkes Werk dem die Gratwanderung zwischen dem Vermitteln von Fakten und ihrer Bewertung aus ethisch-moralischer Sicht perfekt gelingt.
Spektrum. de, Maxime Pasker
Wie brutal der globale Süden heute schon ganz real durch Big Tech Monopole bedroht und geplündert wird, haben Ingo Dachwitz und Sven Hilbig über Jahre recherchiert. "
ZDF Aspekte, Katty Salié
Das große Verdienst von Hilbig und Dachwitz ist, dass sie, wo immer es möglich ist, die eurozentristische Perspektive verlassen und Forschende aus Ländern des Globalen Südens zu Wort kommen lassen.
Buchkultur, Anne Aschenbrenner
Die Presse
Sehr aufschlussreiches Buch
Bayern 2
Die Ungerechtigkeiten, die Ingo Dachwitz und Sven Hilbig anführen . . . die pure Masse an Fakten . . . ist schlicht alarmierend . . . Diese Dimensionen sichtbar zu machen, ist das große Verdienst dieses wichtigen Buches.
DLF, Vera Linß
Dachwitz und Hilbig liefern nicht nur eine fundierte Analyse des Ist-Zustandes, sie wollen auch Hoffnung machen, Lösungsansätze aufzeigen.
Delmenhorster Kreisblatt, Marco Julius
Wer verstehen will, wie und warum sich die Welt gerade in einem solchen Affentempo verändert, der wird sich mit diesem Buch so einiges an Klarheit verschaffen.
Süddeutsche Zeitung, Andrian Kreye
Die Autoren analysieren mit kühler Präzision, in einer Sprache, die nicht anklagt, sondern offenlegt. Sie schreiben gegen die Selbstverständlichkeit der digitalen Abhängigkeit an.
NZZ am Sonntag, Sylke Gruhnwald
Die Autoren schließen eine riesige Lücke in der öffentlichen Wahrnehmung.
der Freitag, Daniél Kretschmar
Ihre Abhandlung kommt zur rechten Zeit und wird hoffentlich eine große Leserschaft finden.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Andreas Eckert
Starkes Werk dem die Gratwanderung zwischen dem Vermitteln von Fakten und ihrer Bewertung aus ethisch-moralischer Sicht perfekt gelingt.
Spektrum. de, Maxime Pasker
Wie brutal der globale Süden heute schon ganz real durch Big Tech Monopole bedroht und geplündert wird, haben Ingo Dachwitz und Sven Hilbig über Jahre recherchiert. "
ZDF Aspekte, Katty Salié
Das große Verdienst von Hilbig und Dachwitz ist, dass sie, wo immer es möglich ist, die eurozentristische Perspektive verlassen und Forschende aus Ländern des Globalen Südens zu Wort kommen lassen.
Buchkultur, Anne Aschenbrenner
 Besprechung vom 02.04.2025
Besprechung vom 02.04.2025
Die willigen Helfer der Diktatoren
Wo die Putzcrew des Internets schuftet: Ingo Dachwitz und Sven Hilbig erörtern, was der Aufstieg der Techkonzerne für den globalen Süden bedeutet
Vor sechzig Jahren veröffentlichte Kwame Nkrumah, der erste Präsident Ghanas und engagierter Panafrikanist, sein Buch "Neokolonialismus: Die letzte Stufe des Imperialismus", eine wenig verklausulierte Hommage an Wladimir Iljitsch Lenin. Das Wesen des Neokolonialismus, so Nkrumah, bestehe darin, "dass der Staat, der ihm unterworfen ist, theoretisch unabhängig ist und über alle äußeren Merkmale internationaler Souveränität verfügt. Doch in Wirklichkeit werden sein Wirtschaftssystem und damit auch seine politische Ordnung von außen gelenkt."
Als ob es Nkrumahs These sogleich bestätigen wollte, zog das arg verschnupfte Außenministerium der Vereinigten Staaten als Reaktion auf die Schrift bereits zugesagte Hilfsmittel in Millionenhöhe zurück. Einige Wissenschaftler und Publizisten begannen in dieser Zeit ebenfalls zu argumentieren, die Unabhängigkeit Afrikas sei eine Illusion. Sie beklagten in diesem Zusammenhang etwa das Gebaren ehemaliger Kolonialmächte - allen voran Frankreichs, der USA und der Sowjetunion -, aber auch von multinationalen Unternehmen und Organisationen wie der Weltbank.
Nicht nur finstere Rassisten verweisen seit geraumer Zeit auf die Mitverantwortung illegitimer und autokratischer Herrscher, die in Afrika und anderen Regionen des globalen Südens hohe Schulden angehäuft und löchrige Strukturen errichtet haben. Zugleich jedoch scheint das zunächst recht plakativ anmutende Konzept des Neokolonialismus immer wieder neue Nahrung zu bekommen. Ein häufig herangezogenes Beispiel ist die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen sich vollziehende Ausbeutung von Rohstoffen - eine Kontinuität aus der Kolonialperiode. Von den erzielten Profiten hat die einheimische Bevölkerung kaum etwas. Kobalt etwa ist nötig für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien in Smartphones oder Laptops.
Der größte Lieferant des Metalls, die Demokratische Republik Kongo, ist heute eines der ärmsten Länder der Welt, zudem von Krieg und Vertreibung heimgesucht. 62 Millionen Menschen, nahezu ein Drittel der Bevölkerung, leben unterhalb der Armutsgrenze, also von weniger als 2,15 US-Dollar pro Tag. Viele Menschen dort sind mit ökologischen Verwerfungen durch den Rohstoffabbau konfrontiert. Die Hände reiben sich ausländische Bergbauunternehmen sowie Tech- und Autokonzerne, die satte Gewinne abgreifen.
Ein anderer begehrter Rohstoff ist jüngerer Natur - Daten. Die Digitalisierung, schreiben Ingo Dachwitz und Sven Hilbig in ihrem materialreichen Buch, komme zwar als immaterieller Prozess daher, beruhe aber häufig auf materiellen Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen. "Statt physisches Land einzunehmen, erobern die neuen Kolonialherren den digitalen Raum." Die Autoren, der eine Journalist, der andere Experte für Digitalisierung und Handelspolitik bei einer gemeinnützigen Organisation, sehen Kolonialismus hier "auf doppelte Weise am Werk". Zuerst habe eine kolonial geprägte globale Wirtschafts- und Wissensordnung die Voraussetzungen für den Aufstieg großer Techkonzerne geschaffen. Sodann würden diese Firmen gemeinsam mit willfährigen Regierungen die neue Ordnung weiter perpetuieren.
Dabei bedienen sie sich, wie die Studie nachzeichnet, nicht nur bei Rohstoffen wie Kobalt, sondern auch bei Arbeitskräften in Ländern wie Kenia und Indien, wo niedrige Löhne, prekäre Arbeitsbedingungen und geringe Arbeitsplatzsicherheit die Regel sind. Digitale Tagelöhner schuften und unter enormem Zeit- und Performancedruck als "Putzcrew des Internets", indem sie etwa toxische Daten aus dem Trainingsdatensatz von ChatGPT herausfiltern. Dafür sind sie laufend mit Inhalten über Kindesmissbrauch, Mord, Selbstmord oder Folter konfrontiert.
Trotz der schlechten Arbeitsbedingungen und einer Hire-and-fire-Politik der Unternehmen hängen viele Geistesarbeiter der Techbranche, die meisten haben einen Universitätsabschluss, an ihren Jobs, denn es gibt meistens keine Alternativen. Inzwischen beginnen sich einige von ihnen gewerkschaftlich zu organisieren. In Kenia hat eine Gruppe erreicht, dass sich der Internetkonzern Meta vor einem dortigen Gericht verantworten muss. Die kenianische Anwältin Mercy Mutemi, die die Kläger vertritt, schießt scharf gegen Mark Zuckerbergs Unternehmen: "Big Tech wird heute auf den geschundenen Rücken und Seelen der afrikanischen Jugend aufgebaut. Diese Menschen haben gelitten, und Meta hat davon profitiert."
Die Verheißung vom Internet als Demokratisierungsmaschine hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend als Schimäre erwiesen. Vielmehr werden, wie Dachwitz und Hilbig zeigen, digitale Technologien zunehmend für Zensur, Überwachung und Kontrolle genutzt. Nicht zuletzt der Arabische Frühling habe vor eineinhalb Jahrzehnten als Weckruf für Diktatoren gewirkt. Die damaligen Massenproteste in Nordafrika und auf der Arabischen Halbinsel gegen wirtschaftliche Aussichtslosigkeit und autokratische Herrschaft umwehte der Geist der "Cyberbefreiung". Denn dank des Internets war das Aufbegehren dezentral und doch vernetzt.
Das Autorenduo verweist jedoch zurecht darauf, dass das Gerede von der Social-Media-Revolution eurozentrische Züge trug und die entscheidende Rolle lokaler Strukturen und analoger Netzwerke des Widerstands ignorierte. Hinzu kommt, dass autoritäre Herrscher überall auf der Welt reagierten, indem sie ihre Regime seither digital massiv aufrüsten, Überwachungstechnologien und Cyberwaffen einkaufen. Techfirmen aus dem globalen Norden sind dabei statt zu Freiheitsbringern zu willigen Helfern von Diktatoren geworden.
Das Buch zeigt weiter auf, wie der Datenhunger der digitalen Großunternehmen und die Datafizierung Rassismus und Diskriminierung befeuern. Und es beleuchtet, wie China sich besonders auf dem afrikanischen Kontinent als eine "digitale Kolonialmacht" etabliert, die sich neben dem Ausbau von Infrastruktur vor allem auf die Ankurbelung des Kaufs und Verkaufs von Dienstleistungen und Waren übers Internet konzentriert und lokalen Start-ups und kleineren Unternehmen das Wasser abgräbt. Dachwitz und Hilbig legen abschließend dar, dass nicht nur Konzerne und Politiker in der Verantwortung stehen, sondern Nutzer. Man komme nicht um die bittere Wahrheit herum, dass die digitalen Dienste und Geräte, die das Leben im globalen Norden prägen, auf Ausbeutung in anderen Teilen der Welt basieren. Ihre Abhandlung kommt jedenfalls zur rechten Zeit und wird hoffentlich eine große Leserschaft finden. ANDREAS ECKERT
Ingo Dachwitz und Sven Hilbig: "Digitaler Kolonialismus". Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen.
C. H. Beck Verlag, München 2025. 351 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








