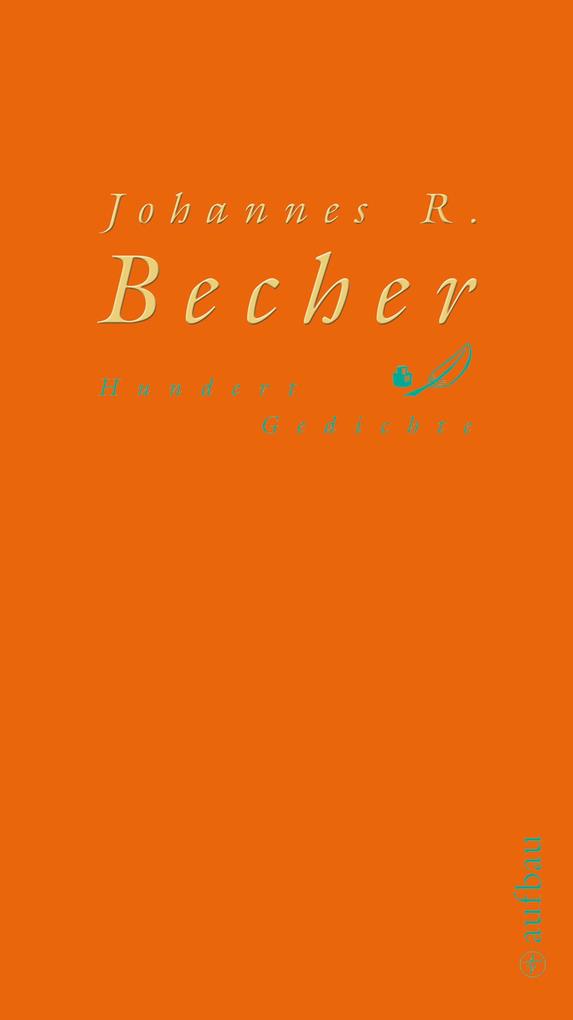Der Dichter meidet strahlende Akkorde.
Er stößt durch Tuben, peitscht die Trommel schrill.
Er reißt das Volk auf mit gehackten Sätzen.
Aus dem Gedicht "Eingang" im Band "An Europa" (1916)
Johannes R. Becher (1891-1958) war ein Vielschreiber, der wie kaum ein anderer in seine Zeit eingreifen wollte. Mit eben dieser Zeit, aus der sie hervorgingen, in der sie durchaus streitbar und umstritten gewirkt haben, sind die meisten seiner Gedichte vergangen, ausgewaschen vom Fluss der Zeiten. Es wäre ein Leichtes, aus diesem Schutt des Erledigten jene Verse auszuwählen, die ihn als Erzstalinisten entlarven oder seinen Verfall von einer "Flamme des Expressionismus" zur "Stalllaterne der Partei" illustrieren würden, wie es heute im Feuilleton heißt. Doch was hätten wir davon? Eine Bestätigung mehr für unser selbstgerechtes Besserwissen, das uns den vergangenen Zeiten so überlegen dünkt und nicht merken lässt, wie wir zu Gefangenen des eigenen Zeitgeists werden.
Das unsäglich Schwache, das sich mit dem Staatsdichter Becher verbindet, sei nicht verschwiegen. Aber es soll uns auch nicht mehr daran hindern, das Lebendige wahrzunehmen, das er uns über die Zeiten hinweg mitzuteilen hat. Weiterwirkendes, das gerade aus der Intensität erwächst, mit der er sich in die Kämpfe seiner Zeit einließ.
(. . .) In Balladen hatte er erprobt, massenhaften Schicksalen ein Gesicht zu geben, statt gesichtslose Massen zu agitieren. Im Exil, doppelt bedroht vom braunen und roten Terror, setzt er den Versuch fort, durch Rückbesinnung auf tradierte Formen, wie das Sonett, Erfahrungen haltbar und verbindlich mitzuteilen, einen Halt in der Sprache zu stiften, Menschlichkeit in unmenschlichen Zeiten.
So entstand "Der Glücksucher und die sieben Lasten" (1938), der wohl beste Lyrikband Bechers. Thomas Mann nannte ihn "das repräsentative Gedichtbuch unserer Zeit und unseres schweren Erlebens". Und Pasternak antwortete auf "Wiedergeburt", den nachfolgenden Band: "Ich danke dir, du wahrer, großer, einziger Dichter. . . . es ist ein siegreiches Glück, solch einen Reichtum wie dein Buch, solch eine Insel im heutigen Lügenmeere zu besitzen."
(. . .) Sein poetisches Testament hat er noch auf dem Krankenbett als Flaschenpost verfasst: "Petrarca" - ein Bild der DDR, gespiegelt im Labyrinth der Zeiten. Und ein letztes Bekenntnis zum Fegefeuer der Dichtung, die nicht in den Himmel der Ideologen gehört: "Ich litte dort in eurem Paradiese / (. . .) / Ich wähl die Hölle und begehr nur diese!"