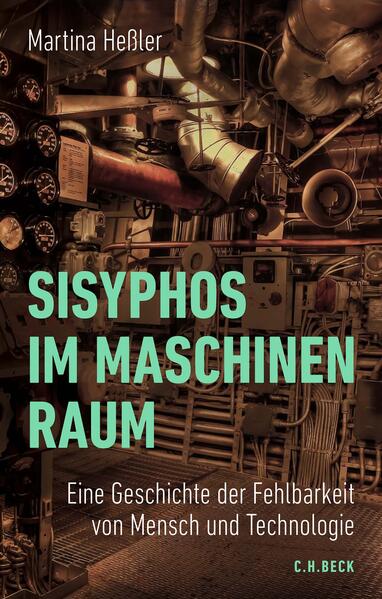
Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mensch und Maschine - eine neue Geschichte
Das menschliche Verhältnis zur Technik ist von einer bedenklichen Schieflage geprägt: Menschen erscheinen als Mängelwesen, die unnötige Fehler machen und Dummheiten begehen, während ihre Maschinen und Technologien als Überwinder ihrer Schwächen gefeiert werden. Martina Heßler erzählt die beeindruckende Geschichte dieses wirkmächtigen Gedankens, in dem sich die menschliche Fehlbarkeit hartnäckig mit technologischer Perfektion verbindet.
Von Automaten in frühen Fabriken über Sicherheitsgurte, Lügendetektoren und nette Roboter bis zu Computern als Präsidentschaftskandidaten und zur Cyborg-Reparatur: Die Geschichte der technologischen Überwindung menschlicher Fehler ist eine Geschichte des Technikchauvinismus, in der wir Menschen mehr und mehr einem modernen Sisyphos ähneln - im selbst gebauten Maschinenraum unentwegt mit der Beseitigung von Fehlern und Defekten beschäftigt. Derzeit verspricht künstliche Intelligenz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und menschliche Grenzen zu sprengen. Wie Martina Heßler eindrucksvoll darlegt, wird aber bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert versucht, fehlerhafte Menschen mit überlegenen Maschinen einzuhegen, zu ersetzen und zu übertreffen. Das Bild einer perfekten Maschine, die alle denkbaren Probleme lösen kann, hat seither den gesellschaftlichen Fortschritt maßgeblich geprägt. Es wird Zeit, diese unzeitgemäße Illusion zu verabschieden.
Das menschliche Verhältnis zur Technik ist von einer bedenklichen Schieflage geprägt: Menschen erscheinen als Mängelwesen, die unnötige Fehler machen und Dummheiten begehen, während ihre Maschinen und Technologien als Überwinder ihrer Schwächen gefeiert werden. Martina Heßler erzählt die beeindruckende Geschichte dieses wirkmächtigen Gedankens, in dem sich die menschliche Fehlbarkeit hartnäckig mit technologischer Perfektion verbindet.
Von Automaten in frühen Fabriken über Sicherheitsgurte, Lügendetektoren und nette Roboter bis zu Computern als Präsidentschaftskandidaten und zur Cyborg-Reparatur: Die Geschichte der technologischen Überwindung menschlicher Fehler ist eine Geschichte des Technikchauvinismus, in der wir Menschen mehr und mehr einem modernen Sisyphos ähneln - im selbst gebauten Maschinenraum unentwegt mit der Beseitigung von Fehlern und Defekten beschäftigt. Derzeit verspricht künstliche Intelligenz, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und menschliche Grenzen zu sprengen. Wie Martina Heßler eindrucksvoll darlegt, wird aber bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert versucht, fehlerhafte Menschen mit überlegenen Maschinen einzuhegen, zu ersetzen und zu übertreffen. Das Bild einer perfekten Maschine, die alle denkbaren Probleme lösen kann, hat seither den gesellschaftlichen Fortschritt maßgeblich geprägt. Es wird Zeit, diese unzeitgemäße Illusion zu verabschieden.
- "Menschen sind für die Fabrikarbeit unzureichend konstruiert." Der Ingenieur John Diebold über die Zukunft der Automobilindustrie, 1954
- Eine Geschichte der Schattenseiten des Verhältnisses von Mensch und Maschine in der Moderne
- Erzählt in einer Fülle von packenden Storys: von Automaten in frühen Industriefabriken bis zur künstlichen Intelligenz von heute
- Der Glaube an die Überlegenheit der Technik ist eine Illusion
- In Wahrheit sind Mensch und Maschine in eine nicht enden wollende Sisyphusarbeit der Mängelbeseitigung verstrickt
Inhaltsverzeichnis
Einleitung:
Eine besondere Form der menschlichen Fehlbarkeit
1. Der im Vergleich zur Technik fehlerhafte Mensch
Lesarten menschlicher und maschineller Unvollkommenheiten
Die Überlegenheit der Technik | Die Minderwertigkeit des Menschen: Günther Anders und die «Faulty Construction» | Mängel, Sünden, Irrtümer: Menschliche Unvollkommenheiten
2. Obsessionen der mechanischen Moderne
Das Ideal der Maschine und fehlerhafte Menschen seit dem frühen 19. Jahrhundert
Mechanische Maschinen: Der fehlerhafte Mensch in der Fabrik | Geistige Automaten: Entscheidungsmaschinen statt fehlerhafter Menschen | Der fehlerhafte Mensch im Automobil | Soziale Maschinen: Der fehlerhafte Mensch und seine zuverlässigen Gefährten | Moralische Maschinen: Der fehlerhafte Mensch am Lügendetektor | Die Obsession der Moderne und die perfekte mechanische Maschine
3. Sisyphos im Maschinenraum
Die Tücken des fehlerhaften Menschen im 20. Jahrhundert
Endlose Steigerung: Die Droge der Maschinisierung | Anwälte menschlicher Kläger: Die Human Factors-Forschung in den 1950er Jahren und ein neuer Blick auf Fehler
4. Computerbugs, irrtümliche KI und kaputte Superhumans
Fehlerhafte Maschinen von den 1970er Jahren bis heute
Ein neues Zeitalter technologischer Fehler | Irren ist maschinell: Künstlich fehlerhafte Intelligenz | Alltägliche Cyborgs: Biologischer Schrott und reparierte Körper
Schluss
Doch keine Welt ohne Fehler
Literatur
Anmerkungen
Register
Eine besondere Form der menschlichen Fehlbarkeit
1. Der im Vergleich zur Technik fehlerhafte Mensch
Lesarten menschlicher und maschineller Unvollkommenheiten
Die Überlegenheit der Technik | Die Minderwertigkeit des Menschen: Günther Anders und die «Faulty Construction» | Mängel, Sünden, Irrtümer: Menschliche Unvollkommenheiten
2. Obsessionen der mechanischen Moderne
Das Ideal der Maschine und fehlerhafte Menschen seit dem frühen 19. Jahrhundert
Mechanische Maschinen: Der fehlerhafte Mensch in der Fabrik | Geistige Automaten: Entscheidungsmaschinen statt fehlerhafter Menschen | Der fehlerhafte Mensch im Automobil | Soziale Maschinen: Der fehlerhafte Mensch und seine zuverlässigen Gefährten | Moralische Maschinen: Der fehlerhafte Mensch am Lügendetektor | Die Obsession der Moderne und die perfekte mechanische Maschine
3. Sisyphos im Maschinenraum
Die Tücken des fehlerhaften Menschen im 20. Jahrhundert
Endlose Steigerung: Die Droge der Maschinisierung | Anwälte menschlicher Kläger: Die Human Factors-Forschung in den 1950er Jahren und ein neuer Blick auf Fehler
4. Computerbugs, irrtümliche KI und kaputte Superhumans
Fehlerhafte Maschinen von den 1970er Jahren bis heute
Ein neues Zeitalter technologischer Fehler | Irren ist maschinell: Künstlich fehlerhafte Intelligenz | Alltägliche Cyborgs: Biologischer Schrott und reparierte Körper
Schluss
Doch keine Welt ohne Fehler
Literatur
Anmerkungen
Register
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
297
Autor/Autorin
Martina Heßler
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
474 g
Größe (L/B/H)
218/147/30 mm
ISBN
9783406823305
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Heßler erforscht, seit wann der Mensch als letzter Bug im System` gilt und warum weder Technikverherrlichung noch Technikverdammung weiterhelfen.
Philosophie Magazin, Jutta Person
Lesenswerte Geistesgeschichte Die technikchauvinistische Vorstellung, dass der Mensch im Vergleich zur Maschine defizitär ist gewinnt, wie aktuell in den USA zu sehen ist, auch politisch an Einfluss.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannah Schmidt-Ott
Sehr verständlich und unterhaltsam geschrieben. Wirklich empfehlenswert.
Deutschlandfunk Kultur, Thomas Gross
Philosophie Magazin, Jutta Person
Lesenswerte Geistesgeschichte Die technikchauvinistische Vorstellung, dass der Mensch im Vergleich zur Maschine defizitär ist gewinnt, wie aktuell in den USA zu sehen ist, auch politisch an Einfluss.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hannah Schmidt-Ott
Sehr verständlich und unterhaltsam geschrieben. Wirklich empfehlenswert.
Deutschlandfunk Kultur, Thomas Gross
 Besprechung vom 15.03.2025
Besprechung vom 15.03.2025
Kein Mangel an Mängeln
Technik ist, was mehr Technik braucht: Martina Heßler folgt der Geschichte des Abgleichs menschlicher Fähigkeiten mit den Leistungen von Maschinen.
Die Erzählung vom fehlerhaften Menschen, mithin vom Menschen als Mängelwesen, ist alt, doch sie hält sich hartnäckig. Seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts soll Technik den Menschen vor seinen Mängeln, Sünden und Irrtümern bewahren. Das Versprechen dahinter war kein geringeres als das auf eine perfekte Welt, in der, unbehelligt vom menschlichen Makel, Wohlstand, Ordnung und Gerechtigkeit herrschen sollten.
Martina Heßler hat der Geschichte des fehlerhaften Menschen ein Buch gewidmet, genauer: der Geschichte des im Vergleich zur Maschine fehlerhaften Menschen und seiner Entsprechung, der fehlbaren Technik. In "Sisyphos im Maschinenraum" fragt die Professorin für Technikgeschichte an der Technischen Universität Darmstadt weniger nach den materiellen Bedingungen und Effekten der technologischen Entwicklung als nach den Weisen, wie über sie gesprochen wird. Anhand vieler Quellen erzählt Heßler die wechselhafte Geschichte des Verhältnisses von menschlichen und maschinellen Fehlern in der Wahrnehmung von Zeitgenossen, von Ingenieuren, Experten, Wissenschaftlern und Unternehmen.
Dabei entfaltet sie die Geschichte eines anhaltenden Technikchauvinismus, der den Menschen als eine potentielle Fehlerquelle behandelt. Die Versuche, menschliche Mängel mittels Maschinen auszumerzen, führen zu Paradoxien, die eine endlose Steigerungsdynamik antreiben - denn die Technisierung von Abläufen produziert stets neue menschliche Fehler, die wiederum mittels Technik eingehegt werden müssen. Man denke nur an Autos, die Freiheit und Mobilität versprechen, deren Geschwindigkeit menschliche Sinne und Reaktionsfähigkeit jedoch überfordert, weshalb allerlei Assistenzsysteme vom Bremskraftverstärker bis zum Antiblockiersystem verbaut werden müssen, um diese Defizite auszugleichen. Am Ende dieser Technisierungsdynamik steht das autonome Fahren, in dem der Risikofaktor Mensch gänzlich ausgeschaltet ist.
Diese Steigerung ist jedoch keine Entwicklung hin zu einer besseren Welt. Durchaus elegant verbindet die Autorin ihre Argumentation immer wieder mit Positionen des Technikkritikers Günther Anders, der ihr als Gewährsmann und Quelle dient. Anders sprach angesichts der Atombombe vom "prometheischen Gefälle", dem Zurückbleiben der Menschen hinter ihren Produkten, denen sie schlicht nicht mehr gewachsen sind.
Doch Heßler ruft noch eine weitere mythologische Figur auf: Der prometheische Mensch wird für sie in der modernen Welt zum Sisyphos, der den Stein immer wieder den Berg hinaufrollt, zur endlosen Wiederholung verdammt. Dieser moderne Sisyphos ist allerdings nicht mehr allein auf die Kraft seines Körpers angewiesen, er hat Technologien entwickelt, die ihm die Arbeit erleichtern. Und dennoch kann er sie nicht vollenden: Stets gibt es Probleme, die Technik überfordert ihn oder streikt gleich ganz, weshalb er gezwungen ist, permanent neue Technik zu entwickeln, die den Mangel ausgleicht. Seine Arbeit, die immer nur komplexer wird und nie ein Ende findet, verrichtet er in einer technologisch gestalteten Welt, dem Maschinenraum.
Wie gestaltet sie sich nun, die Geschichte des fehlerhaften Menschen und der technischen Einhegungsversuche? Historisch war das Verständnis vom Menschen als Mängelwesen vor allem aus dem Vergleich mit dem Tier entstanden, das über mannigfaltige Fähigkeiten verfügte, die dem Menschen nicht zu eigen waren. Erst im neunzehnten Jahrhundert wurde die Maschine zur Vergleichsreferenz, deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit, also Fehlerfreiheit, dem Menschen haushoch überlegen schien. "Irritierend und obsessiv" nennt Heßler die Abwertung von Menschen und ihren Körpern, die damit einherging.
Eine interessante Wendung nimmt die etwas monotone Geschichte Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. Im Zweiten Weltkrieg wurde unter anderem durch massenhaft falsch abgeworfene Bomben deutlich, dass die Technik den Menschen überfordern konnte. Die Human-Factor-Forschung argumentierte, dass Mensch und Maschine zusammenarbeiten müssten, wofür die Maschinen auf die begrenzten Möglichkeiten der Menschen einzustellen seien. Ab den Siebzigerjahren rückten dann fehlerhafte Maschinen in den Fokus. Die mechanische, regelhaft funktionierende Maschine in den Fabriken wurde zunehmend durch komplexere Versionen abgelöst. Deren Fehleranfälligkeit war aber so groß, dass menschliche Fähigkeiten neue Relevanz erlangten. Doch das war nur von kurzer Dauer. Bald waren die Maschinen - etwa in Form von Software - so komplex, dass Menschen sie nicht mehr überblicken, ihre Fehler rasch erkennen und beheben konnten. Bei der Arbeit mit Maschinen, die durch Künstliche Intelligenz zum Lernen befähigt sind, verschmelzen menschliche und maschinelle Fehler schließlich miteinander, etwa indem die statistische Arbeitsweise von Large Language Models menschliche Fehler und Vorurteile reproduziert.
Insofern ist Heßlers Buch auch als eine Absage an naiven Technikglauben zu lesen. Weder ein qua Technik von Fehlern befreiter Mensch noch eine von menschlichen und maschinellen Fehlern befreite, durchtechnisierte und leistungsoptimierte Welt ist erreichbar. Insbesondere technische Lösungen, die in der alten Logik der Komplexitätsbeherrschung durch Komplexitätssteigerung verhaftet bleiben, sind nicht nachhaltig. Herausgekommen ist eine lesenswerte Geistesgeschichte, die ein wenig an dem Umstand krankt, dass ihr Material nur wenige Überraschungen bereithält. Die technikchauvinistische Vorstellung, dass der Mensch im Vergleich zur Maschine defizitär ist und die Welt nur mittels technologischer Hochrüstung verbessert werden kann, ist eben allgegenwärtig. Und sie gewinnt, wie aktuell in den USA zu sehen ist, auch politisch an Einfluss. HANNAH SCHMIDT-OTT
Martina Heßler: "Sisyphos im Maschinenraum". Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie.
C. H. Beck Verlag, München 2025.
297 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sisyphos im Maschinenraum" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









