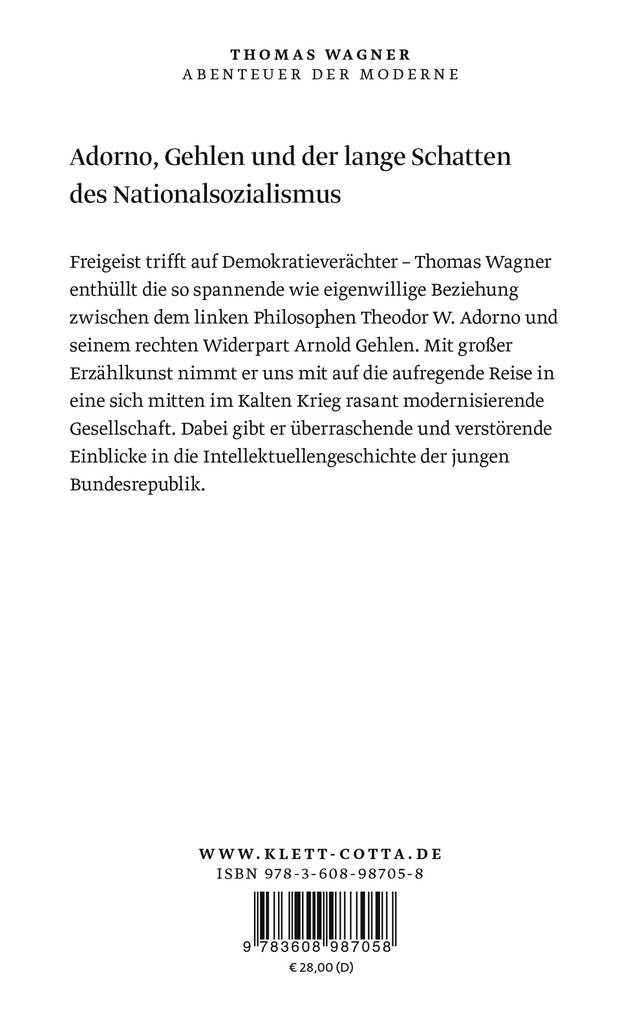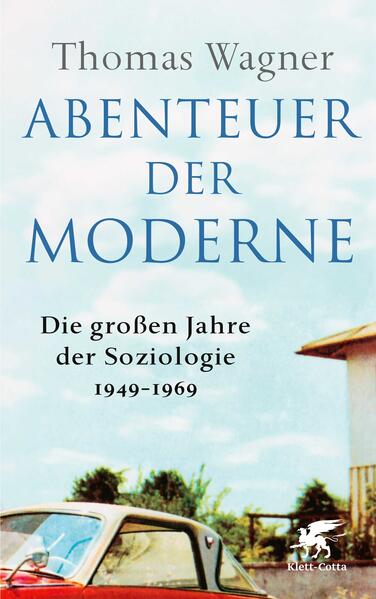
Zustellung: Fr, 25.04. - Mo, 28.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Adorno, Gehlen und der lange Schatten des Nationalsozialismus
Freigeist trifft auf Demokratieverächter - Thomas Wagner enthüllt die so spannende wie eigenwillige Beziehung zwischen dem linken Philosophen Theodor W. Adorno und seinem rechten Widerpart Arnold Gehlen. Mit großer Erzählkunst nimmt er uns mit auf die aufregende Reise in eine sich mitten im Kalten Krieg rasant modernisierende Gesellschaft. Dabei gibt er überraschende und verstörende Einblicke in die Intellektuellengeschichte der jungen Bundesrepublik.
Frühjahr 1958: Theodor W. Adorno bezichtigt seinen Kollegen Arnold Gehlen mit einem vernichtenden Gutachten des faschistischen Denkens - und verhindert dessen Berufung nach Heidelberg. Wenige Jahre später schreiben sie sich Briefe, treffen sich privat und führen eine Reihe von Rundfunkgesprächen - wieso? Vor dem Hintergrund von Wiederbewaffnung und deutscher Teilung schildert Thomas Wagner die Geschichte dieser außergewöhnlichen Begegnung. Er zeigt, wie sich die Soziologie als neue Leitwissenschaft etabliert und welchen Anteil ehemalige Nationalsozialisten dabei haben. Sein Erzählbogen reicht von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in die Hauptstadt der DDR. Mit illustren Figuren wie Arendt, Benn, Brecht, Augstein, Plessner und Harich entsteht ein plastisches Bild von der intellektuellen Gründung der Bundesrepublik. Die Wurzeln der aufgeheizten Debatten unserer Gegenwart erscheinen dadurch in einem überraschend neuen Licht.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Februar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage, 2025
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
336
Autor/Autorin
Thomas Wagner
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
2 Abb.
Gewicht
488 g
Größe (L/B/H)
215/143/35 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag
ISBN
9783608987058
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Das Buch steckt voller produktiv verwirrender Anekdoten, und es ist mit zahlreichen Vor- und Rückblenden so geschickt montiert und flüssig geschrieben, dass man von der ersten bis zur letzten Seite mit nicht nachlassender Neugier auf die nächste Volte gespannt bleibt. «Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 30. März 2025 Mark Siemons, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
»Das Buch besticht dadurch, dass das Kernduell Adorno-Gehlen durch verschiedene Kontexte mit anderen Protagonisten erweitert wird, sodass immer neue, zum Teil unerwartete Konstellationen entstehen. «Jörg Später, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. März 2025 Jörg Später, FAZ
»Wie Wagner sich jetzt auf Buchlänge dem großen Rechtsaußen der deutschen Soziologie widmet, ist ein großer Glücksfall. «Mladen Gladic, Die Welt am Sonntag, 02. März 2025 Mladen Gladic, Welt am Sonntag
»Wagner liefert zu alldem sehr gut geschriebene, eingängige Analysen. Die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Buches besteht aber nicht bloß in der rekonstruierten Konstellation und auch nicht darin, dass er Harich hinzuzieht. Vielmehr findet sich darin eine Typenlehre [ ]«Thomas Meyer, Süddeutsche Zeitung, 04. April 2025 Thomas Meyer, Süddeutsche Zeitung
»Das Buch liest sich beinahe tatsächlich wie ein Abenteuerroman. Selbst wer nicht mit allen Details der akademischen Welt jener Zeit vertraut ist, findet rasch in diesen stilistisch fein formulierten, so leicht daherkommenden Text über ein so großes und schweres Thema. «Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz & Elend, 18. März 2025 Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz und Elend
»Wagners Buch spiegelt, lebhaft erzählt, die geistesgeschichtlichen Kontroversen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts weit über den engeren Fachbereich der Soziologie hinaus die Gesellschaft in ihren Bann schlugen. «Urs Meier, Journal 21, 16. März 2025 Urs Meier, Journal 21
»Anekdoten mit Fakten ausgewogen mischend, macht Wagner den Disput Gehlen/Adorno zur intellektuellen Romanze ohne Happy End. «Matthias Dusini, Falter, 19. Februar 2025 Matthias Dusini, FALTER
»Das Buch besticht dadurch, dass das Kernduell Adorno-Gehlen durch verschiedene Kontexte mit anderen Protagonisten erweitert wird, sodass immer neue, zum Teil unerwartete Konstellationen entstehen. «Jörg Später, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. März 2025 Jörg Später, FAZ
»Wie Wagner sich jetzt auf Buchlänge dem großen Rechtsaußen der deutschen Soziologie widmet, ist ein großer Glücksfall. «Mladen Gladic, Die Welt am Sonntag, 02. März 2025 Mladen Gladic, Welt am Sonntag
»Wagner liefert zu alldem sehr gut geschriebene, eingängige Analysen. Die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Buches besteht aber nicht bloß in der rekonstruierten Konstellation und auch nicht darin, dass er Harich hinzuzieht. Vielmehr findet sich darin eine Typenlehre [ ]«Thomas Meyer, Süddeutsche Zeitung, 04. April 2025 Thomas Meyer, Süddeutsche Zeitung
»Das Buch liest sich beinahe tatsächlich wie ein Abenteuerroman. Selbst wer nicht mit allen Details der akademischen Welt jener Zeit vertraut ist, findet rasch in diesen stilistisch fein formulierten, so leicht daherkommenden Text über ein so großes und schweres Thema. «Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz & Elend, 18. März 2025 Jürgen Nielsen-Sikora, Glanz und Elend
»Wagners Buch spiegelt, lebhaft erzählt, die geistesgeschichtlichen Kontroversen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts weit über den engeren Fachbereich der Soziologie hinaus die Gesellschaft in ihren Bann schlugen. «Urs Meier, Journal 21, 16. März 2025 Urs Meier, Journal 21
»Anekdoten mit Fakten ausgewogen mischend, macht Wagner den Disput Gehlen/Adorno zur intellektuellen Romanze ohne Happy End. «Matthias Dusini, Falter, 19. Februar 2025 Matthias Dusini, FALTER
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Gruppenbild mit Duellanten
Theodor W. Adorno gegen Arnold Gehlen: Thomas Wagner blickt auf die Zeit großer öffentlicher Wirkung der Soziologie.
Von Jörg Später
Von Jörg Später
Wir habe zu viele Soziologen", klagte Helmut Schmidt während seiner Kanzlerzeit. Die Studenten sollten besser "anständige Berufe" anstreben. Die heutige Generation ist seinem Rat gefolgt, denn die Zahl der geisteswissenschaftlichen Studierenden hat sich halbiert, während die Betriebswirtschaft unangefochten auf Platz 1 steht. Visionen haben heute nur noch Oligarchen, und die Soziologie ist beinahe ein Fach wie alle anderen. Das war zu Schmidts Zeiten eben noch anders, als die Gesellschaftslehre als die Leitwissenschaft im demokratischen Industriekapitalismus galt.
"Die großen Jahre der Soziologie 1949 - 1969", so lautet der Untertitel von Thomas Wagners Buch, das sich historisierend über die öffentliche Präsenz und die politischen Subtexte dieser "Wissenschaft von der Gesellschaft" annähert. Keine systematische Abhandlung ist beabsichtigt, sondern der Kultursoziologe und freie Autor rekonstruiert die Geschichte anhand von Konstellationen zwischen den Schulen und ihren Oberhäuptern, von Schlüsselszenen und geschickten Verknappungen ihrer Kontexte. Es handelt sich um ein gelungenes und durchdachtes Buch, ärgerlich sind allein eine Flut von Zwischenüberschriften wie "Dicke Fräulein und Arschkriecher". Worin das "Abenteuer der Moderne" bestehen soll, erfährt man nicht.
Die Hauptdarsteller sind Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen, die im Laufe der Sechzigerjahre im Radio und einmal auch im Fernsehen über Themen wie "Ist die Soziologie eine Wissenschaft vom Menschen?" diskutierten. Hier trafen der Frankfurter Kritiker der "verwalteten Welt" und der "Institutionalist" aus der nationalsozialistischen Leipziger Schule aufeinander. Die Gespräche waren überaus höflich, manchmal sogar freundlich, obgleich doch der zurückgekehrte, einst als Jude vertriebene Emigrant mit dem "interessantesten Demokratieverächter der Zeit" (Rudolf Augstein) diskutierte. Gehlen war ein Philosoph des Nationalsozialismus und ein Verehrer des Führers gewesen, allerdings bereits damals, als der Geist noch rechts stand, ein bürgerlicher Individualist, der mit dem Krawall der völkischen Jugend nichts zu tun haben wollte. Nun also, um 1968 herum, wehte der Wind von links.
Vor dem Gespräch mit Adorno hatte Gehlen offenbar Kreide gefressen. Aber warum sprach Adorno überhaupt mit ihm, obwohl er bestens über dessen Biographie informiert war? Wagner schickt sich an, dieses Rätsel der seltsamen Nähe zu lösen und damit gleich die besonderen politischen, sozialen und kulturellen Konstellationen im postnationalsozialistischen Deutschland zu erhellen. Nach 1945, als der Kalte Krieg, der Marshallplan und der antitotalitäre Konsens den Neuanfang der Soziologie ermöglichten, gab es zunächst acht Lehrstühle, und zwar aus antifaschistischer Perspektive im Verhältnis 3:5. Ein "Bürgerkrieg in der Soziologie" drohte, die "Leipziger", neben Gehlen auch Helmut Schelsky, und "die Frankfurter" beäugten sich gegenseitig. Doch die Wiederaufbaugesellschaft brauchte praxisrelevante Daten. Und das Institut für Sozialforschung brauchte Aufträge, so lieferte man eine "Auswahlstudie" für Offiziersanwärter für den Aufbau einer demokratischen Wehrmacht (die daraus entstandene Bundeswehr setzte dann aber schlicht auf Wehrmachtgeneräle). Adorno, der wie kaum ein anderer die Bedeutung des "Zivilisationsbruchs Auschwitz" begriffen hatte, war nicht zimperlich, was den Umgang mit NS-belasteten Personen anging. "Als ich mich entschloss, nach Deutschland zu gehen, war ich mir darüber klar, dass ich es dann auch mit Nazis, ehemaligen oder hartgesottenen, zu tun bekommen würde; in jedem Augenblick nochmals darauf zu reflektieren, schiene mir naiv."
Im Dezember 1953 begegnete er das erste Mal Gehlen, hier noch eher feindselig. 1958 verhinderten die Frankfurter mit einem vernichtenden Gutachten Gehlens Installierung in Heidelberg. Helmuth Plessner, wie Gehlen aus der Philosophischen Anthropologie stammend, aber mit Horkheimer und Adorno kooperierend, hielt Gehlen für einen "Lump", Faschisten und Verbrecher. Plötzlich jedoch entstand, so Wagner, ein Tauwetter. 1960 veröffentlichte Gehlen ein Buch über moderne Kunst, "Zeit-Bilder" - Zur Soziologie und Ästhetik der modernen Malerei", welches das Eis brach, sowohl bei Plessner als auch bei Adorno. Nun begannen private Besuche. Gehlen, in Speyer wohnend, war mobil, wie Wagner berichtet, denn er hatte einen VW, mittlerweile von Gastarbeitern hergestellt, der zum Exportschlager geworden war, ein Symbol des Wohlstands.
So begannen die Radiogespräche, in denen Adorno die Strategie anwandte, die Argumente des Gegners nach höflicher Wertschätzung auf die Mühlen der Kritischen Theorie umzuleiten, sodass Gehlen manchen wie ein Stichwortgeber erschien. In manchen Dingen waren sie sich einig, so hinsichtlich der Familienähnlichkeiten zwischen den Künsten und den neuen Wissenschaften. Im Zuge der Studentenproteste ging Gehlen Adorno dann doch wieder aus dem Weg. Während zum Soziologentag in Frankfurt 1968 unter Adornos Schirmherrschaft 1300 meist studentische Besucher die Legitimationsprobleme des "Spätkapitalismus" hitzig erörterten, unterschrieb der abwesende Gehlen wie ein Viertel aller Professoren das "Marburger Manifest" gegen die "Demokratisierung der Universitäten".
Das Buch besticht dadurch, dass das Kernduell Adorno-Gehlen durch verschiedene Kontexte mit anderen Protagonisten erweitert wird, sodass immer neue, zum Teil unerwartete Konstellationen entstehen. In den tragenden Nebenrollen: Wolfgang Harich, der marxistische DDR-Querdenker, der Gehlen höher schätzte als Adorno; der Kölner Sozialforscher Helmut König, der das Comeback von Gehlen und Schelsky mit Unbehagen sah, aber dem auch die Frankfurter Theoriehegemonie missfiel; und natürlich Helmut Schelsky, der nach Gehlens staatsfetischistischem Buch "Moral und Hypermoral" (1969) mit dem alten Freund aus Leipzig brach (jener habe wohl aus dem Nationalsozialismus nichts gelernt), bevor er sich kurze Zeit später wegen des "Psychoterrorismus" der 68er als "Anti-Soziologe" gerierte und gegen die "Priesterherrschaft" der linken Intelligenz zu Felde zog.
Wagner beleuchtet vor allem "Adornos satisfaktionsfähigen Gegner" und porträtiert ihn als einen der intellektuellen Gründerväter der Bundesrepublik wider Willen (so Axel Schildt folgend). Wobei dieser Staat für Gehlen kein richtiger Leviathan mehr war, sondern eine Milchkuh, ein von CDU und SPD geführter Sozialverein, auch unter dem strammen Helmut Schmidt. Dem Autor geht es zum einen darum, die scharfe Grenze zwischen Kritischer Theorie und Philosophischer Anthropologie aufzulösen, und zum anderen, Gehlens Wirkung, Stichwort "Hypermoral", auf politisch linksstehende Intellektuelle von heute zu behaupten. Ein Stichwortgeber für Rechtsintellektuelle im Kreis von Criticón (1970 - 2007) bis Sezession (seit 2009) war und ist er allemal. Die Operation Arnold Gehlen ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Das verhindern weder die Soziologen noch die "anständigen Berufe".
Thomas Wagner: "Abenteuer der Moderne". Die großen Jahre der Soziologie 1949 - 1969.
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025. 336 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 17.04.2025
Zeitgeschichte
Theodor W. Adorno und Arnold Gehlen, zwei völlig unterschiedliche Charaktere, menschlich wie politisch. Bestimmt interessant, gerade auch die Zeit Anfang der sechziger Jahre. Aber ein Buch darüber,? Wen interessiert das? Das dachte ich mir, bis ich es gelesen habe. Wir haben es nicht nur mit den Anfängen der Soziologie zu tun, nein, Thomas Wagner spannt den Bogen dieser Geschichte bis in die Weimarer Republik und weiter nach Vorne. Es ist die Geschichte für und Basbyboomer, denn wir sind hier groß geworden. Es ist ein spannend geschriebenes Buch, denn die Frage wasrum diese beiden Akteure Adorno/Gehlen überhaupt miteinander sprachen und sogar einige Rundfunkgespräche miteinander führten, will dieses Buch uns zeigen. Und Anfang der sechziger war politisch einiges los. Dies wird auch gut beleuchtet und uns spannend widergegeben.
Wer sich auf dieses Buch einlässt, wird es mit Gewinn lesen. Also für wen ist es geschrieben? Für Jede und Jeden. Viel Spaß bei der Lektüre.