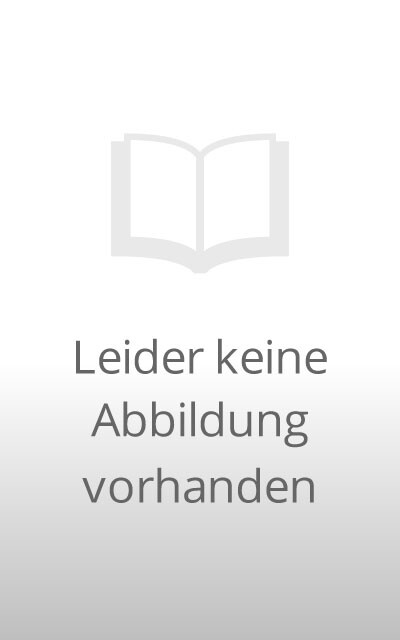
Zustellung: Mi, 21.05. - Fr, 23.05.
Noch nicht erschienen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. Mai 2025
Sprache
englisch
Seitenanzahl
88
Reihe
Macmillan Readers New
Autor/Autorin
F. Scott Fitzgerald
Herausgegeben von
John Milne
Weitere Beteiligte
Margaret Tarner
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
ISBN
9783199129585
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 10.04.2025
Besprechung vom 10.04.2025
Die magische Formel eines amerikanischen Klassikers
"Old sport": Wie ein Mann namens Jay Gatsby seinen Nachbarn zum Freund und Komplizen machte. Vor hundert Jahren erschien F. Scott Fitzgeralds größter Roman.
Von Horst H. Kruse
Vor 100 Jahren, am 10. April 1925, erschien F. Scott Fitzgeralds "The Great Gatsby", der weltweit meistgelesene und meistzitierte Roman der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Es war Fitzgeralds dritter Roman, ein Werk, in das der Autor große Hoffnungen gesetzt hatte - in literarisch-künstlerischer wie auch in kommerzieller Hinsicht. Zwar brachte es ihm durchaus anerkennende Rezensionen und den Beifall von Kritikern und Freunden, aber der erhoffte finanzielle Erfolg stellte sich nicht ein. Eine noch im gleichen Jahr folgende kleinere Druckauflage blieb weitgehend unverkauft, und im Todesjahr des Autors, 1940, registrierte sein New Yorker Verlag Scribner den Absatz von lediglich sieben Exemplaren. Sehr viel erfolgreicher war der ebenfalls 1925 erschienene Roman "An American Tragedy" des von Fitzgerald verehrten älteren Kollegen Theodore Dreiser, dessen Titel auch für das eigene Werk passend gewesen wäre - passend allein deshalb, weil beide Werke sich in ihrer Thematik gleichen. Weder Jay Gatsby noch Clyde Griffiths gelingt es, seinen Traum zu realisieren. Beide Protagonisten scheitern in ihrem Streben nach Selbstverwirklichung und Erfolg in und an einer in Materialismus und Statusdenken erstarrenden Gesellschaft, die das Ideal einer offenen Gesellschaft als Bedingung für die Verwirklichung des American Dream zunehmend zerstört.
Für die bald nach seinem Tod beginnende Wiederentdeckung des Autors und die Würdigung von "The Great Gatsby" als zentralem Werk der amerikanischen Nationalliteratur findet sich ein interessanter Beleg in J. D. Salingers Erfolgsroman "Der Fänger im Roggen" aus dem Jahr 1951. Dort bekundet der Protagonist Holden Caulfield seine Bewunderung für Fitzgeralds Roman auf einprägsame Weise in der ihm eigenen Sprache: "I was crazy about The Great Gatsby. Old Gatsby. Old sport." Die Handlung von Salingers Roman verweist auf die späten Vierzigerjahre. Es darf unterstellt werden, dass sich Holdens Bemerkung direkt oder indirekt einem häufig für die Wiederentdeckung Fitzgeralds angeführten Umstand verdankt: der Veröffentlichung von "The Great Gatsby" im Oktober 1945 als Band 862 der von 1943 bis 1947 in großer Anzahl kostenlos an amerikanische Soldaten verteilten Armed Services Editions.
Salinger diente damals in der amerikanischen Armee in Deutschland und gehörte somit zur Zielgruppe für die auf diesem Wege verbreitete Literatur. Er hatte Fitzgeralds Roman bereits in einer Kurzgeschichte vom Juli 1944 erwähnt, und vieles spricht dafür, dass er ihn nun als Quelle literarischer Inspiration ein weiteres Mal in Händen hält, als Paperback, als eines von insgesamt 155.000 auf diese Weise erschienenen Exemplaren. Im Begleittext wird der spezifisch amerikanische Charakter des Werks deutlich hervorgehoben. Gatsbys Aufstieg und sein Niedergang hätten sich in keinem anderen Land ereignen können: "Here is a story that is American to the core."
Holden Caulfields geläufige Verwendung des Adjektivs "old" als Zeichen der Wertschätzung einer Person trifft sich auf eindrucksvolle Weise mit Gatsbys auf eben diese Art gebildeter Form der Anrede eines Gegenübers als "old sport". Die ebenso gefällige wie auffällige Kollokation "Old Gatsby. Old Sport" in Salingers Roman wird mit dazu beigetragen haben, die Aufmerksamkeit auf diesen, den Protagonisten von Fitzgeralds Roman kennzeichnenden Ausdruck zu lenken und eine Diskussion zu befeuern, die bis in die Gegenwart anhält und längst das Internet erreicht hat. Gleich mehrere Videosequenzen, sogenannte Supercuts, des 55-maligen Vorkommens von "old sport" in Baz Luhrmanns Verfilmung aus dem Jahre 2013 liefern einen eindeutigen Beleg für den ikonischen Status von Jay Gatsbys sprachlicher Eigenheit.
Die dergestalt auffällige Rolle von "old sport" in der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des Romans führt zur Frage nach dessen Rolle in der Entstehungs- und Quellengeschichte des Romans. Es spricht für seine Vielschichtigkeit, die Komplexität seiner Entstehungsgeschichte sowie die Mannigfaltigkeit und Lebendigkeit des literarischen Lebens im Amerika der Zwanzigerjahre, dass diese Frage selbst ein Jahrhundert nach dem Erscheinen noch zu überraschenden Antworten führt.
Als wichtiger Hinweis zur Herkunft von Gatsbys "old sport" gilt ein von Fitzgerald in seinem Scrapbook aufgehobener Zeitungsausschnitt mit einem Foto des Autors nebst seiner Frau Zelda und der Tochter Scottie, aufgenommen auf Long Island, wo sie ab Ende 1922 lebten. Am Rande findet sich eine kurze handschriftliche Nachricht vom 20. Juli 1923 mit der Schlussformel "How are you and the family old sport?" und der Unterschrift "Gerlach". Die Unterschrift verweist auf einen im Jahre 1947 von Zelda namentlich, vom Autor selbst lediglich indirekt erwähnten Max von Gerlach, den Zelda ausdrücklich als Vorbild für die Figur des Jay Gatsby benennt. Die naheliegende Vermutung, dass dieser Gerlach Fitzgerald neben anderen Details auch das den Protagonisten charakterisierende "old sport" geliefert habe, erscheint indes eher zweifelhaft angesichts weiterer Umstände im Leben des Autors, die ausdrücklich auf Theodore Dreiser als sein literarisches Vorbild verweisen. Im Jahre 1919 erschien dessen "Twelve Men", eine Sammlung von Charakterskizzen von Menschen, denen Dreiser persönlich begegnet war und denen er einen nachhaltigen Eindruck auf sich und sein Werk zuschreibt.
Die neunte dieser Skizzen ("'Vanity, Vanity,' Saith the Preacher") handelt von Joseph G. Rabinovitch, einem Einwanderer aus Odessa, der seinen Nachnamen in Robin ändert und durch fragwürdige Bankgeschäfte ein enormes Vermögen anhäuft. Als Zeichen seines Reichtums lässt er sich an der Nordküste Long Islands eine eindrucksvolle Villa errichten, die er als Schauplatz großartig inszenierter Feste nutzt. Ein plötzliches Ende seiner Karriere bringt ihn für einige Zeit ins Gefängnis und lässt ihn, der großen Zahl früherer Freunde und Bewunderer zum Trotz, allein und einsam zurück - gemieden selbst vom mitfühlenden Erzähler seiner Geschichte. In ihren großen Zügen, vor allem in ihrem melancholischen Grundton weist diese Geschichte voraus auf "The Great Gatsby". Es darf als sicher gelten, dass Fitzgerald bei seiner Lektüre hier eine erste Anregung für seinen Roman fand.
Als ebenso sicher kann gelten, dass ihn sein Interesse am Werk und an der Person Dreisers veranlasste, dessen von gleicher Traurigkeit und Melancholie getragene Charakterskizze seines älteren Bruders Paul zu lesen ("My Brother Paul", die dritte der Sammlung), in der die gleichen Motive aufscheinen. Der unter seinem ebenfalls amerikanisierten Nachnamen bekannt gewordene Paul Dresser war ein beliebter und überaus erfolgreicher Komponist, der sich der leichten Muse verschrieben hatte und unter anderem als Verleger zu großem Reichtum gelangt war. Als Bonvivant pflegte er einen verschwenderischen Lebensstil, sehr zum Missfallen seines Bruders, der als Journalist in eher ärmlichen Verhältnissen lebte.
Doch als Paul dem glücklosen Theodore Dreiser an einem Heiligabend nach vorangegangener Entfremdung der beiden auf dem Broadway begegnete, zeigte er die innigste Anteilnahme am Los des Jüngeren, drang auf ein Beisammensein und bediente sich dabei wiederholt der gefühlsbetonten Anrede "sport", vom Erzähler ausdrücklich kommentiert als "a favorite expression of his", sodann abgewandelt zu "old sport" beim anschließenden Weihnachtsbesuch in der Wohnung der unglückseligen Schwester - dort, wo Paul dann später, nach dem unerwarteten Ende seiner glanzvollen Jahre, verlassen von der großen Schar einstiger Freunde, einen einsamen Tod sterben wird.
Für Fitzgerald und seine Frau Zelda werden Dreisers Charakterskizzen und Romane zu geläufigen Bezugspunkten in ihren üblichen scherzhaften und ernsten Auseinandersetzungen über literarische Fragen und die eigene literarische Arbeit. Noch in ihrer Korrespondenz im Jahre 1934 stellte Zelda den Titelvorschlag "Eight Women" ihres Mannes für eine Sammlung ihrer eigenen Geschichten mit dem Hinweis infrage, dass es sich um einen zu großen Diebstahl ("too big a steal") bei Dreiser handele. Anscheinend ist es die gleiche Frage eines zu offenkundigen Plagiats, die Fitzgerald nach der Lektüre von Dreisers Bericht über Joseph Rabinovitch davon abhielt, den gleichen Stoff unmittelbar selbst in einem Roman zu gestalten, auch wenn ihm nach 1920 die stattlichen Villen in seinen Wohnorten Westport in Connecticut und vor allem auf Long Island sowie seine Begegnungen und Freundschaften mit deren wohlhabenden Besitzern den Reiz des Themas immer wieder vor Augen führen. Dann aber tritt mit Max Gerlach eine Person in das Leben der Fitzgeralds, die im Verlaufe ihrer Begegnung das gesamte Spektrum der mit der Geschichte des Joseph Rabinovitsch verbundenen Motive in weitaus reicherer und detaillierterer Weise bereitstellt und Fitzgerald auch ohne augenfälligen Rückgriff auf Dreiser eine authentische und eigenständige Gestaltung nahelegt und ermöglicht.
Max Gerlach wurde am 12. Oktober 1885 als Sohn eines preußischen Offiziers in Deutschland geboren, kam 1894 nach dem Tod seines Vaters zusammen mit seiner erneut verheirateten Mutter und seinem Stiefvater unter dessen Familiennamen als Max Stork in die Vereinigten Staaten, verlor dort bereits 1902 auch seinen Stiefvater und kehrte danach, unter gelegentlicher Verwendung von "Stork" als Zwischennamen, zu seinem Geburtsnamen Gerlach zurück. Er erlernte den Beruf eines Kraftfahrzeugmechanikers und arbeitete für einige Zeit unter anderem als Marineingenieur in Mittelamerika, diente sodann, unter Vertuschung seiner deutschen Geburt, von 1918 bis 1919 in der amerikanischen Armee, widmete sich schließlich dem Vertrieb sowie der Reparatur von hochklassigen Kraftfahrzeugen und half beim Ausrichten von Autorennen in Amerika und auf Kuba.
Inzwischen erfahren im Manipulieren biographischer Fakten, fügte er seinem Geburtsnamen nunmehr das Adelsprädikat "von" hinzu und unterhielt vielfältige gesellschaftliche Kontakte. Allem Anschein nach überredete er 1920 den durch die Veröffentlichung seines Romans "This Side of Paradise" schlagartig berühmt gewordenen und nunmehr in New York nach seinem ersten Automobil suchenden Fitzgerald zum Kauf eines gebrauchten Marmon, verhalf ihm sodann im Mai 1922 zu einem Rolls-Royce und stellte 1923 einen Nash-Tourenwagen für ein Werbefoto zur Verfügung. Zugleich betätigte er sich bei den Fitzgeralds als Lieferant von illegalem Alkohol, als sogenannter Bootlegger, wie Zelda später erläutert.
Diese sich über mehr als drei Jahre erstreckenden kontinuierlichen Kontakte sprechen dafür, dass sich zwischen ihnen eine engere Beziehung entwickelte. Die Dauer und die sich ergebende Intensität eines Gedankenaustauschs mit Gerlach erklären die Fülle ebenso wie die zunehmend persönliche und vertrauliche Art der Informationen, die Fitzgerald von und über Gerlach erhält und die er schließlich mehr oder weniger direkt in "The Great Gatsby" verarbeitet. Als Ausdruck gegenseitigen Einvernehmens und Vertrauens, so steht zu vermuten, erscheint in ihrem Umgang miteinander nunmehr das durch Dreisers "My Brother Paul" angeregte "old sport", eingeführt von Fitzgerald - oder auch durch die einem spielerischen Umgang mit Literatur stets aufgeschlossene Zelda - und nach Ausweis des zitierten Dokuments in des Autors Scrapbook sodann von Gerlach aufgenommen und offenbar mit Geläufigkeit verwendet.
So wie sich Max Gerlach für Fitzgerald zu einer Art Inspiration für den Protagonisten seines Romanvorhabens entwickelt und für die Zeichnung der Figur vielversprechende biographische Fakten liefert, wird auch im Roman selbst die Entwicklung der Beziehung zwischen dem Erzähler Nick Carraway und Jay Gatsby als Protagonisten dargestellt und auch hier wiederum durch umgangssprachliche Anredeformeln zum Ausdruck gebracht. Gatsbys anfänglichem "old fellow" und seinem sodann häufig gebrauchten "old man" folgt im Manuskript schließlich das von ihm fünfmal verwendete "old sport".
Im nachfolgenden Prozess einer intensiven Revision des Textes, an der sich Fitzgeralds Verlagslektor Maxwell Perkins mit wichtigen Ratschlägen beteiligt, ersetzt das "old sport" durchgehend alle anderen Formeln und wird darüber hinaus an weiteren Stellen eingefügt. Es erscheint nunmehr 43-mal als eine Äußerung Jay Gatsbys und wird vom Autor auf diese Weise direkt und emphatisch als dessen sprachliches Erkennungsmal etabliert. Wie bei Dreiser entwickelt sich das "old sport" im endgültigen Text des Romans von einer geläufigen, unterschiedslos gebrauchten formelhaften Redeweise des Protagonisten zu einem dringenden gefühlsbetonten Appell an das als Erzähler fungierende Gegenüber - von Paul Dresser gerichtet an seinen Bruder Theodore Dreiser, von Jay Gatsby an seinen Nachbarn Nick Carraway.
Bemerkenswert ist, dass bei Fitzgerald das diesen Appell bestimmende "old sport" als allerletzte Erwähnung in der gesamten Sequenz in einem Satz erscheint, der als solcher vom Erzähler lediglich imaginiert, also von ihm selbst formuliert wird: als die an sich selbst gerichtete inständige Bitte des bereits verstorbenen Jay Gatsby, nicht nachzulassen in den Bemühungen, wenigstens einen einzigen Gast aufzuspüren für sein Begräbnis: "Look here, old sport, you've got to get somebody for me. You've got to try hard. I can't go through this alone."
In der dergestalt kunstvoll auf diesen Höhepunkt hin komponierten Sequenz des Vorkommens von "old sport" findet sich als weitere signifikante Abweichung die zitierende Zurückweisung der Anredeformel - als Gatsbys offenbar unberechtigte Aneignung einer aristokratischen Redeweise - durch Tom Buchanan als Antagonisten, der den eigenen Status hierdurch als gefährdet sieht: "Don't you call me 'old sport'!" Für Nick Carraway hingegen entwickelt sich Gatsbys "old sport" von einer Floskel zu einer aufrichtigen Ansprache im Sinne von aktiv bekundeter und passiv ersehnter Zuwendung und Sympathie.
Der Endpunkt dieser Entwicklung steht in Übereinstimmung mit der aus dem Geschehen erwachsenen Bewunderung des Erzählers für Gatsby und für dessen Streben als Verkörperungen der Ideale des American Dream. Auf verschlungenen Wegen ist damit die auf das Weihnachtsfest 1896 oder 1897 datierbare insistierende Verwendung der Anrede "sport" und "old sport" durch Paul Dresser für seinen fünfzehn Jahre jüngeren Bruder Theodore Dreiser zu einem wesentlichen Bestandteil von "The Great Gatsby" gediehen, wo ihm, als bedeutender Endpunkt einer bemerkenswerten Entwicklung, die Funktion zufällt, das Erkennen der Größe Gatsbys durch den Erzähler sowohl zu befördern als auch zu markieren.
Der in diesem Zusammenhang erbrachte Nachweis unmittelbarer und mittelbarer historischer, literarhistorischer und biographischer Bezüge in ihrer teils engen Verflechtung bezeugt ein weiteres Mal die starke Verwobenheit von Fitzgeralds Roman in literatur- und sozialgeschichtliche Zusammenhänge und bekräftigt den Status von "The Great Gatsby" als zentralem Dokument der amerikanischen Literatur ebenso wie des amerikanischen Selbstverständnisses.
Nicht von der Hand zu weisen, doch in der nunmehr hundertjährigen Rezeptionsgeschichte hier als These erstmals formuliert, ist schließlich der Gedanke, dass Fitzgerald - durchaus geübt in der versteckten Formulierung von Dank und Lob im Rahmen seiner Werke - seine Verwendung von "old sport" auch versteht als eine über öffentliche und allgemeine Anerkennungen eines Einflusses von Dreiser auf sein Denken und sein Werk hinausgehende, dazu dem älteren Autor unmittelbar einsichtige und damit jeden möglichen Vorwurf eines Plagiats entkräftende private Dankesbekundung für die aus dessen "Twelve Men" gewonnenen Anregungen. Ein Beleg dafür, dass der auf diese Weise angesprochene Dreiser "The Great Gatsby" gelesen und Fitzgeralds Botschaft ihn somit tatsächlich erreicht hat, ist indessen nicht vorhanden.
Horst H. Kruse war von 1972 bis 1994 Inhaber des Lehrstuhls für Amerikanistik an der Universität Münster.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "The Great Gatsby" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.





















