Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
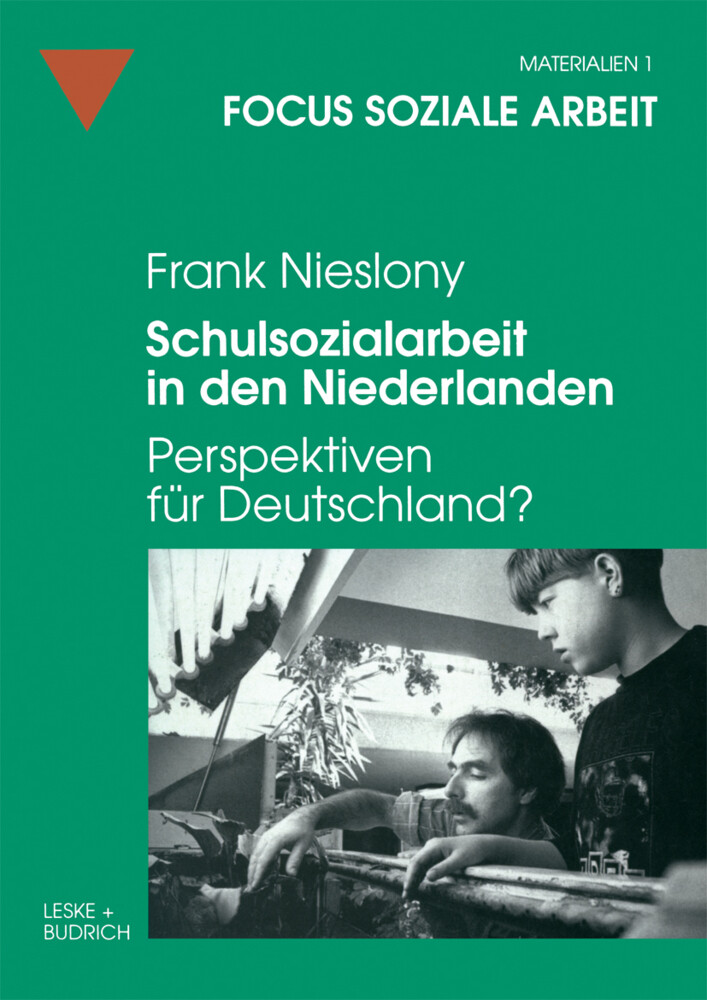
Zustellung: Mo, 10.02. - Mi, 12.02.
Versand in 2 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
(Wilma Aden-Grossmann) Schulen befinden sich seit Jahren bereits in einem Prozefi der Umorientie rung. Sie reagieren, wenn auch oft nur sehr halbherzig und zogemd, auf die sich wandelnden Bedingungen, unter denen Kinder in unserer Gesellschaft heranwachsen. Schlagworte hierzu sind: Medialisierung der Kindheit und Jugend, Verdrangung der Kinder von StraBe und Platzen durch das erhOhte Verkehrsaufkommen, Probleme bei der Gestaltung der Freizeit und Orien tierungslosigkeit besonders in der Phase der Berufswahl. Als Mitte der 70er Jahre bundesweit Modellversuche zu Schulsozialar be it eingerichtet wurden, war dies eine sozialpadagogische MaBnahme, urn den veranderten Bediirfnissen von Kindem und Jugendlichen Rechnung zu tragen. Es verband sich damit auch die Hoffnung, zwischen der Schule und der Jugendhilfe eine engere, produktive Verkniipfung zu schaffen. Schulso zialarbeit wurde vorzugsweise an Gesamtschulen eingerichtet und metho disch fur unterschiedliche Zielgruppen konzipiert. Die freizeitpadagogischen Angebote beispielsweise richteten sich an aIle SchUler, von den berateri schen Konzeptionen profitierten iiberwiegend Schiilerinnen und SchUler aus sozial schwachen Milieus. Trotz der positiven Einschatzungen durch Lehrer und der Akzeptanz durch Schiilerinnen und SchUler wurde Schulsozialarbeit nicht ausgeweitet, sondem im Gegenteil, es wurden Mittel gekiirzt und Pro jekte oft nach 20-jahrigem Bestehen abgeschafft. Aufgrund der Forderungen berufstatiger Miitter nach einer zuverlassi gen Betreuung ihrer Kinder sind seit Anfang der 90er Jahre die sog. "Be treuungsschulen" entstanden. Das sind Grundschulen, an denen Kinder iiber die eigentliche Unterrichtszeit hinaus (meist bis 13 oder 14 Uhr) teils durch Lehrer, teils durch Honorarkrafte - wobei es sich nicht immer urn fachlich qualifizierte Krafte handelt, - , betreut werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Sozialarbeit und Jugendhilfe in den Niederlanden. - 1. 1 Versäulung und Sozialarbeit Zur Segmentierung traditioneller Sozial- und Wohlfahrtsstrukturen. - 1. 2 Sozialpolitik und Sozialarbeit. - 1. 3 Restauration und Wandel der Sozialarbeit. - 2 Die Genese der niederländischen Schulsozialarbeit. - 2. 1 Schoolmaatschappelijk werk : Fragen an die Geschichte. - 2. 2 Traditionelle Strömungen und anglo-amerikanische Einflüsse. - 2. 3 Die erste Entwicklungsphase (1945 bis 1960): Intentionen der Jugendhilfe und Konsolidierung der Schulsozialarbeit. - 3 Entwicklung und Organisation. - 3. 1 Die zweite Entwicklungsphase (1960 bis 1970): Ein Profil gewinnt an Schärfe Beiträge zur Professionalisierung von Schoolmaatschappelijk werk. - 3. 2 Schoolmaatschappelijk werk in Amsterdam Schulbegleitung und Stadtteilorientierung. - 4 Schulbegleitende Einrichtungen. - 4. 1 Zur Versorgungsstruktur des niederländischen Schulwesens. - 4. 2 Die Discussienota Schoolbegeleiding . - 4. 3 Die gesetzliche Grundlage: Wet op de onderwijsverzorging (WOV). - 4. 4 Einrichtungen im System der Versorgungsstruktur . - 4. 5 Im kritischen Blickfeld: Schulsozialarbeit im Rahmen der Schulbegleitungsdienste. - 4. 6 Schoolmaatschappelijk werk: Eine notwendige Brücke zwischen Jugendhilfe und Schule. - 5 Die Landschaft der niederländischen Schulsozialarbeit. - 5. 1 Zur Systematisierung der Arbeitsfelder. - 5. 2 Schulformunabhängige und methodische Grundlagen. - 5. 3 Schulen und Schulsozialarbeit Handlungsrahmen und Praxis. - 6 Probleme und Eckpfeiler. - 6. 1 Ausgesuchte Problemfelder niederländischer Schulsozialarbeit. - 6. 2 Der Berufscodex. - 6. 3 Berufsständische Vereinigung (L. V. M. W.). - 6. 4 Ausblick. - Abkürzungsverzeichnis. - Abbildungsverzeichnis.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
31. Januar 1997
Sprache
deutsch
Auflage
1997
Seitenanzahl
332
Reihe
Focus Soziale Arbeit, 1
Autor/Autorin
Frank Nieslony
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
330 S. 9 Abb.
Gewicht
431 g
Größe (L/B/H)
210/148/19 mm
Sonstiges
Paperback
ISBN
9783810017871
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Schulsozialarbeit in den Niederlanden" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

















