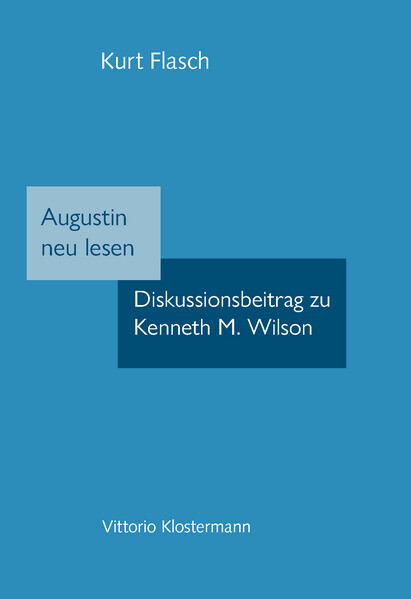
Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Deutung der Ideen Augustins war immer umstritten. 2018 trat sie in eine neue Krise ein mit der Publikation von Kenneth M. Wilsons Buch "Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to 'Non-free Free Will'". Das Buch handelt von Augustins "Bekehrung", aber nicht von der ersten in Mailand 386, sondern von der letzten zu seiner Spätlehre. Der Buchtitel setzt für Augustins letzte Entwicklungsstufe "Freiheit" in Anführungszeichen, weil sie zwar noch "Freiheit" heiße, aber keine mehr sei. Wilson ermittelt das exakt für Augustin Spätphase, es hat Folgen für ein neues Gesamtbild Augustins. Kurt Flasch erprobt die Argumente dieser originellen Studie unpolemisch anhand von Augustins "Bekenntnissen", Buch X. Er untersucht besonders das Verhältnis der "Confessiones" zu Augustins Brief an Simplician und kommt (mit Wilson) zu dem Schluss: Es ist Zeit, Augustin wieder einmal neu zu lesen. The interpretation of Augustine's ideas has always been controversial. In 2018, it entered a new crisis with the publication of Kenneth M. Wilson's book "Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to 'Non-free Free Will'". The book is about Augustine's 'conversion', but not about the first one in Milan in 386, but the last one to his late doctrine. With respect to Augustine's last stage of development, the title of Wilson's book puts 'freedom' in quotation marks for, because although it is still called 'freedom', it is no longer that. Wilson establishes this precisely for Augustine's late phase, and it has consequences for a new overall picture of Augustine. Kurt Flasch tests the arguments of this original study non-polemically on the basis of Augustine's "Confessions", Book X. He examines in particular the relationship between the "Confessiones" and Augustine's letter to Simplician and comes to the conclusion (with Wilson) that it is time to read Augustine anew.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2024
Seitenanzahl
164
Autor/Autorin
Kurt Flasch
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
270 g
Größe (L/B/H)
225/158/17 mm
ISBN
9783465046509
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 04.04.2025
Besprechung vom 04.04.2025
Sündhaft muss der Wille bleiben
Von Augustinus und seiner Logik des Schreckens kann er nicht lassen: Kurt Flasch setzt in zwei Bänden seine Auseinandersetzung mit dem Kirchenvater und dessen Gnadenlehre fort.
Augustinus von Hippo, Kirchenvater und Bischof, rühriger Kirchenpolitiker in der Provinz und heute weltweit anerkannter Denker, hat nur wenige kaltgelassen, die seinen Werken begegnet sind. Denn man kann in seinen Schriften verfolgen, wie er lange nach dem wahren Glauben suchte, um ihn dann mit intellektueller Brillanz und mit zunehmender Härte zu verteidigen. Seine "Confessiones" (Bekenntnisse), letztlich ein langes Gebet mit der Anmutung einer modernen Autobiographie, beschreiben eindringlich die Verwirrungen eines verwöhnten, intelligenten und ehrgeizigen jungen Mannes, bis Gott ihn in wunderbarer Weise auf den rechten Weg führt. Augustins Schrift "De civitate Dei", traditionell mehr schlecht als recht mit "Vom Gottesstaat" übersetzt, entwickelt eine Geschichtsdeutung, die das Christentum aus den politischen Fängen des Römischen Reiches löst. Seine Briefe zeigen ihn als ebenso zugewandten wie fordernden Ratgeber, der zugleich die Interessen seiner Kirche streng wahrt.
Zwei ältere, höchst unterschiedliche Werke zu dem Kirchenvater sind nach wie vor fundamental: Peter Browns plastisch geschriebene Biographie von 1967 lässt den Leser in die Zeit Augustins eintauchen, seine ganz unterschiedlichen Lebenswelten erfassen und verfolgt im Gestus des Mitfühlens das Ringen dieses Mannes mit sich, seinem Umfeld und Gott. Kurt Flasch wählte für sein 1980 zuerst erschienenes Werk den bescheidenen Titel "Augustin. Einführung in sein Denken". Wer aber eine Einführung erwartete, die für eine brave Prüfungsvorbereitung geeignet war, wurde rasch eines Besseren belehrt: Bewusst und für viele provozierend nahm Flasch Abschied vom Orgelton der Ergriffenheit und würdigte Augustins Denken mit nüchternem Engagement - die Lebensgeschichte steht nur am Rande. Immer neue Auflagen bestätigen, wie nötig ein solches Werk weiterhin ist. Flasch sucht in Augustin auch einen intellektuellen Gesprächspartner für die Gegenwart - das ist er für viele geblieben, selbst für einen amerikanischen Vizepräsidenten, der unter Berufung auf Augustin eine rücksichtslose nationale Interessenvertretung rechtfertigen zu können glaubt.
Umso wichtiger ist die historische Auseinandersetzung mit Augustin, die Kurt Flasch mit seinem neuen Werk fortsetzt. Sie steht vor der Schwierigkeit, dass Augustin nicht wie ein moderner Gelehrter einer selbst entworfenen Forschungsagenda folgte, sondern auf aktuelle Herausforderungen reagierte, sei es auf die Eroberung Roms durch die Westgoten 410, mit der die Schwäche des christlichen Roms erwiesen schien, sei es auf Kritik an seinen Schriften. Es ging ihm nicht um eine Theologie als Wissenschaft, sondern um die Grundlegung für eine christliche Lebensführung. Zwischen seinen Schriften bestehen Spannungen und auch inhaltliche Brüche. Wenig überraschend, dass sein Denken immer neuen Deutungen ausgesetzt ist.
Furore machte das Werk eines amerikanischen Seiteneinsteigers in die Theologie, Kenneth M. Wilson, der nach langer medizinischer Tätigkeit mit über fünfzig in Oxford promovierte und derzeit zugleich als Arzt und Theologieprofessor tätig ist. Seine 2018 publizierte Dissertation behandelt ein Schlüsselproblem, die Frage der Willensfreiheit, und überraschte die Forschung mit der These, Augustin habe erst rund fünfzehn Jahre später als bisher angenommen erstmals den Gedanken vertreten, dass für den Menschen die Erlangung des Heils allein bei Gott liege und von ihm vorbestimmt sei, unabhängig vom Willen des Menschen. Dieser sei ohnehin aufgrund der Ursprungssünde (peccatum originale) Adams, die Flasch weiter Erbsünde nennt, sündhaft. Das bezeichnete Flasch einmal als eine "Logik des Schreckens".
Die Reaktionen auf Wilsons Arbeit waren teils skeptisch, teils enthusiastisch zustimmend. Kurt Flasch hat aufgrund der Lektüre Wilsons seine bisherige Auffassung revidiert - und bekennt das freimütig. Welche Konsequenzen sich daraus ergeben, diskutiert er in zwei kurzen, mit pointierten Titeln versehenen Büchern. In "Augustins letztes Wort" widmet Flasch sich späteren Schriften des Kirchenvaters, vor allem jenen zur Prädestination, aus denen er weitere Passagen übersetzt, sowie abendländischen Texten, auf die Augustin einwirkte, namentlich solche von Thomas von Aquino und Johannes Calvin, aus dessen Werk Flasch eine Sammlung einschlägiger lateinischer Zitate zusammenstellt.
Im zweiten, ausdrücklich als Diskussionsbeitrag gekennzeichneten Werk, "Augustin neu lesen", dessen Vorwort nur knapp drei Wochen später datiert ist, erörtert Flasch explizit Wilsons Arbeit, ferner Passagen aus "Ad Simplicianum", einem Werk Augustins, das als grundlegend für die Gnadenlehre gilt und das Wilson in zentralen Teilen umdatiert hat. Zudem behandelt er lange, neu übersetzte Abschnitte aus den "Bekenntnissen", die nach bisheriger Meinung mit jenen Teilen zusammenhingen. In beiden Werken verbinden sich die höchst qualitätsvollen Übersetzungen (hier leider gewöhnlich ohne lateinisches Original) mit eindringlichen Interpretationen, die auf eine systematische Auseinandersetzung mit der verästelten Forschung verzichten, dieser auch nicht bedürfen.
Doch eigenartig bleibt: Zwei inhaltlich eng zusammenhängende Bücher desselben Autors im selben Verlag liegen vor, die kurz nacheinander fertiggestellt wurden und die zu einem großen Einzelwerk zur Willensfreiheit bei Augustin hätten vereint werden können - was leider nicht geschehen ist. Ein zusammenfassendes Schlusswort vermisst man. Überhaupt: Keines der Werke ist wirklich durchgeformt. Beide Bücher zeichnen Denkbewegungen Flaschs nach, durchsetzt mit zugespitzten, bisweilen überspitzten Polemiken gegen andere Forscher, und dann wieder finden sich eindringliche Deutungen von Aussagen Augustins.
Die Bücher kreisen um Augustins Gedanken zu Gnadenlehre und Prädestination und enthalten dazu erhellende Beobachtungen. Übersetzung und Einzelinterpretation verselbständigen sich jedoch öfters gegenüber dem eigentlichen Anliegen Flaschs; gelegentlich stößt der Leser auf unübersetzte lateinische Zitate. Überdies führt Flasch eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit Wilson lediglich am Beginn von "Augustin neu lesen" und an dessen Schluss. Diese Abschnitte wirken so eher wie angestückt, als dass sie das gesamte Buch bestimmen, mag Wilson Flasch auch dazu gebracht haben, die "Bekenntnisse" noch einmal neu zu lesen. Dazwischen finden sich glanzvolle Übersetzungen langer Passagen aus ihnen und höchst anregende Überlegungen zu Augustins Gedanken über Memoria und Zeit. Bei der finalen Gestaltung der Bücher hätte ein Lektorat mehr Verantwortung übernehmen müssen.
Gleichwohl bleiben Flaschs Gedanken für die, die sich auf diese ungefüge Komposition einlassen wollen, eindrücklich und erlauben es, mit Augustin auf hohem Niveau mitzudenken. Dies geschieht auf zweierlei Weise. Zum einen kann man verfolgen, wie Augustin selbst, als ein Theologe mit philosophischen und exegetischen Schwächen um Glaubenswahrheiten ringt. Zum anderen werfen seine Gedanken grundsätzliche Fragen auf, die jeden Denkenden, auch die Gebildeten unter den Verächtern der Religion, umtreiben: Wie frei bin ich in meinem Willen? Was bedeutet richtiges Handeln? Welche Rolle spielen Faktoren, die jenseits meiner Macht liegen? Augustin provoziert viele mit seiner harten Prädestinationslehre und bringt jeden zum Nachdenken, zumal wenn man einen Begleiter hat wie Kurt Flasch, der die sprachlichen Nuancen Augustins würdigt und die Gedanken mit wissender Leidenschaft kritisiert. HARTMUT LEPPIN
Kurt Flasch: "Augustins letztes Wort: Prädestination".
Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2024. 236 S., geb., 34,- Euro.
Kurt Flasch: "Augustin neu lesen". Diskussionsbeitrag zu Kenneth M. Wilson.
Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2024. 164 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Augustin neu lesen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









