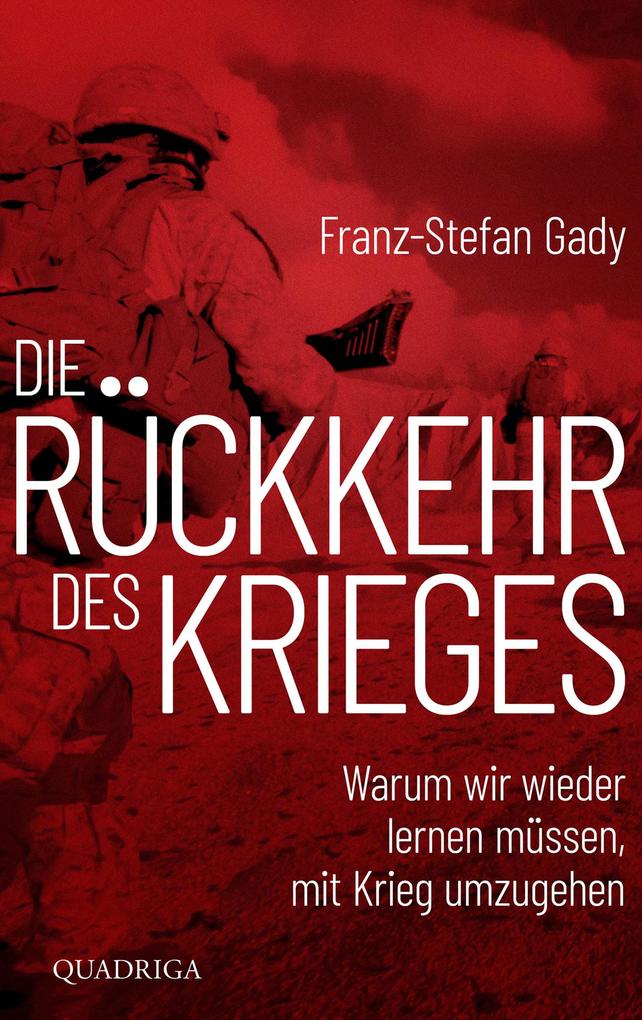
Sofort lieferbar (Download)
»Wer wissen will, warum es zum Krieg kommt, wie er geführt wird und was er mit den Beteiligten macht, der kommt an diesem exzellent geschriebenen Buch von einem der führenden europäischen Militäranalysten und Militärhistorikern nicht vorbei. Ein Standardwerk. «
Prof. Dr. Carlo Masala
Die Kriege in der Ukraine und in Nahost sind Symptom einer sich seit Jahrzehnten anbahnenden Zeitenwende: Militärische Konfrontation wird zunehmend wieder als legitimes Mittel zur Fortsetzung der Politik angesehen. Ausgehend von diesem Moment, aber auch vorangegangene Konflikte mit einbeziehend, analysiert Franz-Stefan Gady die konstante Natur des Krieges sowie den sich wandelnden Charakter der Kriegsführung. Er beschreibt, warum Kriege in naher Zukunft immer wahrscheinlicher sind, warum der Mensch trotz aller technischen Dimensionen immer im Zentrum der Kriegsführung stehen wird und wie wir uns auf kommende Konflikte vorbereiten können - falls wir sie nicht verhindern können.
»Ein Buch für alle, die sich sachlich und unaufgeregt mit einem schweren Thema befassen möchten. Gady gelingt die seltene Kunst, zu erklären und gleichzeitig kurzweilig zu sein. «
Dr. Florence Gaub, Forschungsdirektorin der NATO-Verteidigungsakademie
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. Oktober 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Aufl. 2024
Seitenanzahl
240
Dateigröße
2,16 MB
Autor/Autorin
Franz-Stefan Gady
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
ohne Kopierschutz
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783751760201
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt und Europa ist nicht vorbereitet - weder politisch, noch wirtschaftlich oder militärisch und erst recht nicht mental. Franz-Stefan Gadys fundiertes und lesenswertes Werk, angereichert durch persönliche Erfahrungen, dient nicht nur als nützliches Handbuch für politische Entscheidungsträger, sondern ermöglicht es auch der breiten Öffentlichkeit, ein tieferes Verständnis von Krieg und Kriegsführung zu erlangen. «Dr. Bastian Giegerich, Generaldirektor, International Institute for Strategic Studies (IISS)
»Einer der führenden Militäranalysten in Europa. Eine fantastische Lektüre, die Geschichte, Theorie und Praxis der Kriegsführung kombiniert. «Michael Kofman, Militärexperte, Carnegie Endowment for International Peace
»Der Krieg muss uns in Europa - leider - wieder beschäftigen. Wer dazu nur ein Buch lesen will, sollte unbedingt dieses zur Hand nehmen. Von Thukydides bis zum Terminator: Wie kein anderer erklärt, entzaubert und ordnet Franz-Stefan Gady alles Wichtige kenntnisreich ein. Sein in bewundernswert klarer und zugänglicher Sprache geschriebenes Werk ist nicht nur ein Lesegenuss. Es ist es auch Denkanstoß und in Teilen Anlass zur Sorge. Ein wichtiges Buch. «Dr. Frank Sauer, Professor, Universität der Bundeswehr München
»Über die Rückkehr des Krieges nachzudenken, ist für Deutschland nachvollziehbar schwieriger als für andere Länder. Nötig ist es dennoch, und hierzulande schmerzliche Einsichten kann Gady aus seiner amerikanisch-österreichischen Perspektive offen ansprechen. «Thomas Wiegold, einer der führenden sicherheitspolitischen Journalisten Deutschlands, Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber
»Franz Stefan Gady ist einer der ganz wenigen Militäranalysten, die in der Lage sind, theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen und Vor-Ort Beobachtungen zu verbinden. Gady gelingt es meisterhaft, Geschichte, Wissenschaft und eigene Recherchen zum Krieg zu einem höchst lesbaren Gesamtwerk zu verbinden. Ein wertvoller Beitrag zur deutschsprachigen sicherheitspolitischen Debatte. «Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations
»Einer der führenden Militäranalysten in Europa. Eine fantastische Lektüre, die Geschichte, Theorie und Praxis der Kriegsführung kombiniert. «Michael Kofman, Militärexperte, Carnegie Endowment for International Peace
»Der Krieg muss uns in Europa - leider - wieder beschäftigen. Wer dazu nur ein Buch lesen will, sollte unbedingt dieses zur Hand nehmen. Von Thukydides bis zum Terminator: Wie kein anderer erklärt, entzaubert und ordnet Franz-Stefan Gady alles Wichtige kenntnisreich ein. Sein in bewundernswert klarer und zugänglicher Sprache geschriebenes Werk ist nicht nur ein Lesegenuss. Es ist es auch Denkanstoß und in Teilen Anlass zur Sorge. Ein wichtiges Buch. «Dr. Frank Sauer, Professor, Universität der Bundeswehr München
»Über die Rückkehr des Krieges nachzudenken, ist für Deutschland nachvollziehbar schwieriger als für andere Länder. Nötig ist es dennoch, und hierzulande schmerzliche Einsichten kann Gady aus seiner amerikanisch-österreichischen Perspektive offen ansprechen. «Thomas Wiegold, einer der führenden sicherheitspolitischen Journalisten Deutschlands, Co-Host des Podcasts Sicherheitshalber
»Franz Stefan Gady ist einer der ganz wenigen Militäranalysten, die in der Lage sind, theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen und Vor-Ort Beobachtungen zu verbinden. Gady gelingt es meisterhaft, Geschichte, Wissenschaft und eigene Recherchen zum Krieg zu einem höchst lesbaren Gesamtwerk zu verbinden. Ein wertvoller Beitrag zur deutschsprachigen sicherheitspolitischen Debatte. «Dr. Ulrike Franke, Senior Policy Fellow, European Council on Foreign Relations
 Besprechung vom 04.02.2025
Besprechung vom 04.02.2025
Die Rückkehr der Kabinettskriege
Franz-Stefan Gady sieht eine neue Ära bewaffneter Konflikte heraufziehen - als Folge des Machtverlusts der USA und eines neuen Technologieoptimismus.
Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg? Was zumindest in Europa nach 1945 zwischen Staaten galt, wurde nach dem Ende des alten Kalten Krieges zunächst auf dem Balkan, dann ab 2014 in der Ostukraine und seit 2022 mit der Vollinvasion der Ukraine durch Russland endgültig infrage gestellt. Kehrt damit Clausewitz zurück nach Europa? Wird Krieg erneut zur bloßen Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln?
Franz-Stefan Gady ist diesen Fragen systematisch nachgegangen - und dies nicht nur auf Europa bezogen. Der Associate Fellow am Institute for International Studies in London und Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington rechnet damit, dass das Abschreckungspotential der Vereinigten Staaten, das nicht zuletzt den Europäern lange Zeit Sicherheit geboten habe, schwächer werde, weil es in Zukunft schwieriger sein werde, Amerikas Sicherheitspolitik vorauszusehen - nicht nur die politische Kommunikation, sondern auch das Handeln von Donald Trump seit seiner erneuten Wahl zum amerikanischen Präsidenten scheinen diese These vorerst zu bestätigen. Gady leitet daraus zum einen ab, dass Fehlkalkulationen bei Amerikas und Europas Widersachern zunehmen könnten, was wiederum Konflikte befeuern könne.
Zum anderen sagt er voraus, dass Nachfolgekriege zunehmen werden. Dies führt er auf ein Glaubwürdigkeitsproblem zurück, das entsteht, wenn es Krieg führenden Parteien schwerfällt, einander glaubwürdig zu versichern, dass sie sich an die Bedingungen eines Waffenstillstands oder Friedensvertrags halten werden. Dieses Problem kann nach der Beobachtung von Gady dann gelöst werden, wenn es einen Hegemon wie die USA gibt, der als Garant für die Einhaltung von Vereinbarungen auftritt und Strafmaßnahmen für den Fall androht, dass die Kriegsparteien gegen die Vereinbarungen eines Waffenstillstands oder Friedensabkommens verstoßen.
Gady erinnert daran, dass Washington diese Funktion im Dayton-Abkommen 1995 erfüllte, das den Bosnienkrieg beendete. Der Kosovokrieg 1999 sei unter anderem deshalb zu Ende gegangen, weil die USA und die NATO den Serben mit zusätzlicher militärischer Gewalt gedroht hätten. Und schon im Koreakrieg hätten die Amerikaner, obwohl sie selbst Kriegspartei gewesen seien, die Rolle des Sicherheitsgaranten eingenommen, der bereit war, den Waffenstillstand notfalls mit Gewalt durchzusetzen. In beiden Fällen habe dies bedeutet, amerikanische Bodentruppen als Garanten für ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen im Land zu stationieren.
Nach der Analyse von Gady genügt oft ein einzelner Krieg nicht, um das von ihm beschriebene Glaubwürdigkeitsproblem zwischen den Kriegsparteien zu lösen. Den aktuellen Krieg in der Ukraine bezeichnet er als einen Nachfolgekrieg eines Konflikts, der bereits 2014 ausbrach. Sollte dieser in naher Zukunft beendet werden, hält er die Wahrscheinlichkeit für hoch, dass ein weiterer Krieg folgen wird. In seinen Augen dürfte es den Amerikanern schwerfallen, als glaubwürdiger Sicherheitsgarant aufzutreten, es sei denn, sie stationierten Truppen in der Ukraine, womit er angesichts des inzwischen fehlenden sicherheitspolitischen Konsenses in den USA kaum rechnet.
Hinzu kommt für Gady, dass eine größer werdende Skepsis gegenüber bislang existierenden Sicherheitsstrukturen wie der NATO zukünftig häufiger unilaterale Handlungen mit einer "Koalition der Willigen" zur Folge haben könnte, selbst unter "transatlantischen" Präsidenten im Weißen Haus. Potentielle Aggressoren könnten dann den fehlenden Konsens in Washington und die entsprechend fehlende Nachhaltigkeit in der amerikanischen Sicherheitspolitik als Chance sehen, ihre revisionistische Politik durchzusetzen, sei es in Europa, dem Nahen Osten oder Asien - nach dem Motto: "Die Amerikaner und der Westen mögen die Uhren haben, wir aber haben Zeit."
Eine solche Gemengelage erhöht nach der historisch fundierten Untersuchung von Gady unweigerlich das Risiko von gravierenden Fehleinschätzungen und damit die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Kriege, die wegen eines fehlenden Hegemons zugleich schwieriger beendet werden können. Welche Art von Krieg würde daraus folgen? Gady kann sich ein neues Zeitalter der Kabinettskriege vorstellen. Hierfür sprechen in seinem Epochenvergleich ein sich neu etablierendes globales System, der Verlust der Hegemonialstellung der USA und der Zeitgeist des Technologieoptimismus, der suggeriere, dass Konflikte schnell und ohne große Verluste entschieden werden könnten.
Das ursprüngliche Zeitalter der Kabinettskriege vom Ende des Dreißigjährigen Krieges bis zum Beginn der Volkskriege der Napoleonischen Zeit sieht Gady gekennzeichnet durch Kriege überwiegend für begrenzte politische Ziele, hauptsächlich um Territorium. Kriege seien meist aus dynastischen Interessen geführt worden und nicht zum Zwecke der Verbreitung von Ideologien oder Religionen. Dabei hätten die Krieg führenden Staaten im Großen und Ganzen über die gleichen Technologien verfügt und die gleichen Taktiken angewandt. Keine der Kriegsparteien habe sich somit auf der technologischen oder taktischen Ebene einen großen Vorteil erhoffen können. Diese Kriege hätten dann sehr oft nicht mit einem entscheidenden Sieg, sondern eher mit De-facto-Waffenstillständen geendet, auf die dann weitere Nachfolgekriege gefolgt seien.
Entlang dieser Merkmale macht Gady für das 21. Jahrhundert einige Parallelen zu den Kabinettskriegen des 17. und 18. Jahrhunderts aus. Wie ihm die Kriege in der Ukraine oder um Bergkarabach zeigen, ist territoriale Eroberung wieder zum festen Bestandteil von Kriegführung geworden. Territoriale Dispute und militärisches Säbelrasseln haben in seiner Wahrnehmung stark zugenommen. Hierfür nennt er zahlreiche Beispiele: etwa die anhaltenden territorialen Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien, die Furcht vor einer serbischen Mobilmachung im Herbst 2023, die territorialen Streitigkeiten zwischen China und Japan um die im Ostchinesischen Meer liegenden Senkaku-Inseln oder territoriale Dispute zwischen China und Indien.
Zwar haben derlei Dispute für Gady das Potential, früher oder später zu einer wirklichen militärischen Konfrontation zu führen. Aber schnelle und entscheidende Feldzüge von Staaten wie zum Beispiel im Krieg um Bergkarabach stellen für ihn weiterhin die Ausnahme und nicht die Regel dar. Hinzu komme, dass, sobald ein Krieg ein oder zwei Nuklearmächte involviere, die Wahrscheinlichkeit steige, dass der Konflikt in einem Abnutzungskrieg ende, weil eine Militärkampagne, die das Ziel habe, den Gegner rapide und entscheidend zu besiegen, enormes Eskalationspotential berge.
Diese neue Form der Kabinettskriege, die für begrenzte politische Ziele geführt werden, kann sich nach dem Urteil von Gady in einem multipolaren System schneller ausbreiten als in einem bipolaren oder unipolaren. Darüber hinaus begünstigten ein solches System sowie die Abwesenheit eines globalen Hegemons ein neues Zeitalter der Nachfolgekriege, in dem militärische Konflikte nach temporären Waffenstillständen wieder aufgenommen würden. Nie wieder Krieg? Immer wieder Krieg! THOMAS SPECKMANN
Franz-Stefan Gady: Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen.
Quadriga Verlag, Berlin 2024. 240 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








