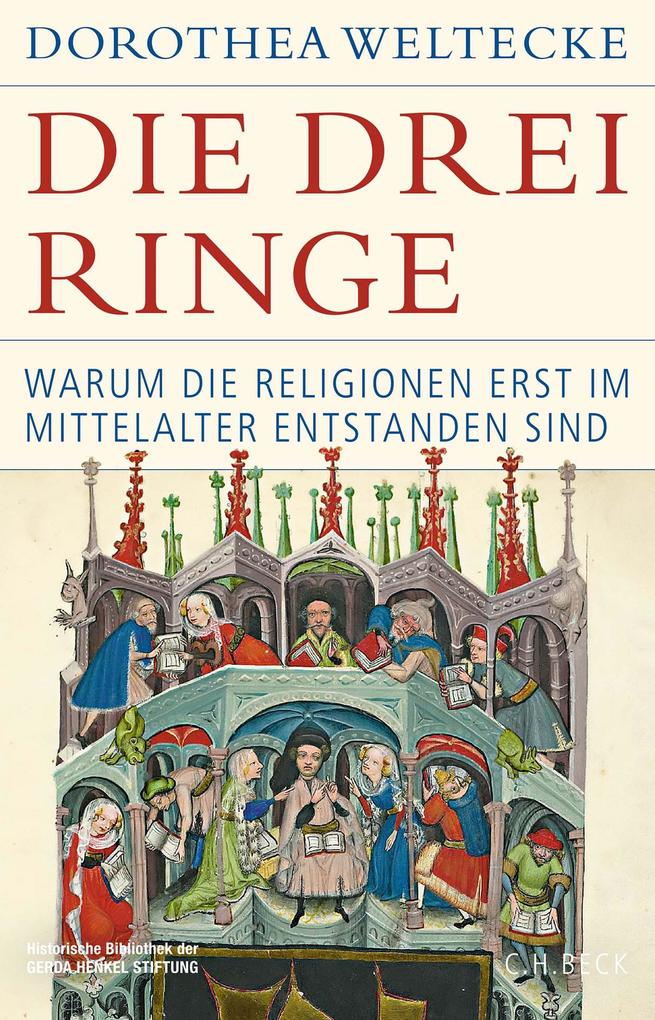
Sofort lieferbar (Download)
In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder über das Erbe, das sie von ihrem Vater bekommen haben. Juden, Christen und Muslime waren sich im Mittelalter sehr bewusst, dass ihre Traditionen miteinander verwandt sind. Die Historikerin Dorothea Weltecke zeigt, dass ihre konfliktreiche und dennoch gemeinsame Geschichte in dem großen Raum zwischen Atlantik, Nil und Indus überhaupt erst die exklusiven «Religionen» hervorgebracht hat.
Das Grab des Propheten Ezechiel in der Nähe von Bagdad war im Mittelalter Ziel von jüdischen, muslimischen und christlichen Pilgern. An diesem und vielen anderen Beispielen zeigt Dorothea Weltecke anschaulich, wie intensiv sich die Glaubensgemeinschaften austauschten. Gemeinsam bauten sie eine neue kulturelle Landschaft. Dass ihre Traditionen miteinander verwandt waren, wussten Juden, Christen und Muslime im Mittelalter. In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder jedoch über das Erbe, das sie von ihrem gemeinsamen Vater bekommen haben. Problematisch für das Verhältnis der Glaubensgemeinschaften zueinander wurden im Mittelalter nicht ihre Wahrheitsansprüche, sondern neue rechtliche Unterscheidungen zwischen Gläubigen, nur Geduldeten und Nichtgeduldeten. Die Theorien und die Gewalt, mit denen diese Ungleichheit fortlaufend begründet und aufrechterhalten wurde, militarisierten die Grenzen zwischen den Glaubenstraditionen. Damit legt das Buch eindrucksvoll eine Schicht der Religionsgeschichte frei, die vom Lavastrom der Polemik verschüttet wurde.
Das Grab des Propheten Ezechiel in der Nähe von Bagdad war im Mittelalter Ziel von jüdischen, muslimischen und christlichen Pilgern. An diesem und vielen anderen Beispielen zeigt Dorothea Weltecke anschaulich, wie intensiv sich die Glaubensgemeinschaften austauschten. Gemeinsam bauten sie eine neue kulturelle Landschaft. Dass ihre Traditionen miteinander verwandt waren, wussten Juden, Christen und Muslime im Mittelalter. In der Parabel von den drei Ringen streiten die Brüder jedoch über das Erbe, das sie von ihrem gemeinsamen Vater bekommen haben. Problematisch für das Verhältnis der Glaubensgemeinschaften zueinander wurden im Mittelalter nicht ihre Wahrheitsansprüche, sondern neue rechtliche Unterscheidungen zwischen Gläubigen, nur Geduldeten und Nichtgeduldeten. Die Theorien und die Gewalt, mit denen diese Ungleichheit fortlaufend begründet und aufrechterhalten wurde, militarisierten die Grenzen zwischen den Glaubenstraditionen. Damit legt das Buch eindrucksvoll eine Schicht der Religionsgeschichte frei, die vom Lavastrom der Polemik verschüttet wurde.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
11. Juli 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
627
Dateigröße
3,24 MB
Reihe
Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung
Autor/Autorin
Dorothea Weltecke
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783406811937
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 31.01.2025
Besprechung vom 31.01.2025
Auf Lehrgebäude kommt es nicht an
Im kaum entwirrbaren Netz von Glaubenstraditionen: Dorothea Weltecke blickt in ihrer beeindruckenden Geschichte der Religionen im Mittelalter weit hinaus über den Sonderfall der lateinisch-christlichen Traditionen.
Juden, Christen und Muslime formten im Mittelalter eine gemeinsame Welt, die vom Indischen Ozean bis zum Atlantik reichte. Soziale Zugehörigkeit war in dieser Welt wichtiger als religiöse Lehrdefinitionen. Angehörige der Religionen begegneten einander zwar nie auf Augenhöhe, fühlten sich aber trotzdem verwandt, folgten ganz ähnlichen Ritualen und pilgerten zu Orten gemeinsamer Verehrung. In dieser Welt gab es für Juden, Christen und Muslime keine zentralen Lehren, die ihnen Orientierung hätten geben können, sondern eine große Vielfalt von jüdischen, christlichen und muslimischen Richtungen, ein unentwirrbares Netz von Glaubenstraditionen.
Dieses Bild zeichnet die Historikerin Dorothea Weltecke in "Die drei Ringe", einer Geschichte der Religionen des Mittelalters. Wobei sie schon im Untertitel ihres Buchs andeutet, dass sie die Bezeichnung "Religionen" für anachronistisch hält: "Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind". Denn erst im ausgehenden Mittelalter und in der frühen Neuzeit, so Welteckes These, wurden die Glaubensgemeinschaften durch soziale, rechtliche und theologische Abgrenzung in ihrem Wesen festgeschrieben. Und erst durch diese Verhärtungsprozesse seien sie zu dem geworden, was wir heute "Religionen" nennen.
Es ist eine Wohltat, dieses Buch zu lesen. Nicht nur weil es verständlich geschrieben ist, sondern auch weil es die Verengung früherer Forschung auf das lateinische Christentum und auf Rom konsequent vermeidet. So lautet der erste Satz des ersten Kapitels: "In den mittelalterlichen Jahrhunderten waren die europäischen Regionen periphere Provinzen." Und dann lässt Weltecke die Leser das Thema ihres Buches anhand von drei Reiseberichten kennenlernen: einem christlichen, einem jüdischen und einem muslimischen. Der christliche beginnt, programmatisch genug, in China. Er stammt von Rabban Sauma, einem uigurischen Mönch, Mitglied der apostolischen Kirche des Ostens, der 1275 aus der Region Peking aufbricht, um nach Westen zu reisen. Sein Ziel ist das Oberhaupt seiner Kirche, der Katholikos, der in Bagdad residiert. Wir nähern uns der gemeinsamen Welt der mittelalterlichen Religionen also von Osten, nicht von Westen, und reisen mit Rabban Sauma weiter bis nach Konstantinopel, Rom, Genua und Paris.
Auf einer zweiten Reise folgen wir dem muslimischen Pilger Ibn Dschubair, der um 1180 von Andalusien über Damaskus nach Mekka und zurück reist, und zuletzt dem jüdischen Kaufmann und Rabbi Petachja auf dessen fast zur selben Zeit unternommenen Reise von Regensburg über Kiew nach Mossul, Bagdad und Jerusalem und wieder zurück nach Regensburg. Die drei Reiseberichte gehorchen vielen gemeinsamen Konventionen: Sie beschreiben die berühmten Institutionen und Repräsentanten ihrer eigenen Gemeinschaft, auf die sie überall zwischen China und dem Atlantik stoßen. Diese religiöse Welt des Mittelalters kennt nichts Exotisches. Gleichzeitig blenden sie die jeweils anderen Glaubensgemeinschaften in ihren Texten aus.
So multiperspektivisch wie das erste Kapitel ist auch der Rest des Buches angelegt. Das zweite Kapitel analysiert mittelalterliche Lehrschriften, in denen zahllose religiöse Gruppierungen aufgelistet werden: etwa 73 schiitische "Gefolgschaften" oder 100 christliche "Abweichungen". Leider liest man hier nur wenig über die Zoroastrier, die eigentlich den Rang eines vierten Ringes verdient hätten, so verbreitet waren sie in Westasien. Das dritte Kapitel behandelt die große Zahl mittelalterlicher Ringparabeln, die heute viel weniger bekannt sind als die späte Version der "drei Ringe", die Lessing in "Nathan der Weise" erzählen lässt. Die letzten beiden Kapitel sind den Quellengruppen der Erbauungsschriften und der Religionsgespräche gewidmet und analysieren Wahrheitsansprüche, Glaubenszweifel, Respekt und Diskriminierung.
Diese Quellen- und Themenauswahl ist sehr ungewöhnlich. Es ist mutig, ein Buch über die Religionen des Mittelalters zu schreiben und dabei auf theologische Quellen und Chroniken fast ganz zu verzichten. Und wo bleiben in diesem Buch die Kreuzzüge, die Päpste, die großen Theologen wie Thomas von Aquin? Sie werden am Rande erwähnt, sind aber eben nur lateinisch-christliche Sonderfälle in der viel größeren Welt der drei Ringe.
Weltecke unternimmt es, die Geschichte dieser Welt in vielen alternativen Erzählungen neu zu schreiben, nicht chronologisch, sondern in Episoden, um der Vielfalt gerecht zu werden. Das ist eine Mammutaufgabe, die auf beeindruckende Weise gelungen ist. Wichtige Thesen können durch diese Erzählweise gut belegt werden. Weltecke zeigt, dass es viel friedliches Miteinander und Gemeinsamkeit im Mittelalter gab, aber immer gepaart mit sozialer Hierarchie, Ungleichheit und Diskriminierung; und auch, dass das Bewusstsein für die doktrinäre Vielfalt und Zweifel an Wahrheitsansprüchen sehr verbreitet waren, ohne jedoch Vorläufer aufgeklärter Positionen zu sein; denn die drei Ringe, anders als in der Aufklärung postuliert, konnten niemals wirklich verwechselt werden.
Der Verzicht auf chronologische Erzählung hat allerdings den Preis, dass Entwicklungen und überhaupt Ursachen und Wirkungen nicht dargestellt werden können. Dem fällt auch die große These des Untertitels zum Opfer, dass die Religionen erst in einer Krise des Zusammenlebens am Ende des Mittelalters entstanden seien. Weltecke argumentiert, dass die religiösen Minderheiten durch immer effizientere Herrschaftsmethoden, Machtkämpfe, Aufstände und gewaltoffene Räume zunehmend an den Rand gedrängt und unterdrückt wurden. Doch das kann sie nicht zeigen. Sie führt zwar theologische "Akteure der Verhärtung" im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert vor. Scharfmacher allerdings hat es schon in früheren Jahrhunderten gegeben, immer wieder.
Das Buch kann nicht belegen, dass die Glaubenstraditionen am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts auseinanderdrifteten und zu modernen Religionen wurden, also zu sozial abgeschlossenen und theologisch ausgrenzenden Formationen. Denn dazu müsste Weltecke zeigen, dass die mittelalterliche Welt, die sie schildert, tatsächlich aufhörte zu existieren. Das ist aber unwahrscheinlich für das größte staatliche Gebilde der frühen Neuzeit in diesem Raum: das Osmanische Reich. Es spricht sehr viel dafür, dass das unentwirrbare Netz von Glaubenstraditionen zumindest in den vielen Ländern des Osmanischen Reiches bis ins zwanzigste Jahrhundert fortbestand - und vielleicht gerade heute in Syrien und Libanon zu überleben versucht. Inquisition, Gewalt gegen Juden und Konfessionskriege in Westeuropa sind keineswegs Teil einer Entwicklung, welche die gesamte Region zwischen Atlantik und Indischem Ozean in der frühen Neuzeit erfasst.
Das Buch startet also mit einer globalen Forschungsperspektive zwischen China und dem Atlantik, endet aber mit einer mittelwesteuropäischen Verengung. Man kann sich auch fragen, ob Religionen als "sozial abgeschlossene und theologisch ausgrenzende Formationen" vielleicht überhaupt nur eine Fiktion mächtiger Akteure sind, aber keine Realität, weder in der Neuzeit noch in der Gegenwart. Den Islam oder das katholische Christentum gibt es nicht wirklich, sondern nur viele "Islame" und viele "katholische Christentümer" mit gewissen Familienähnlichkeiten.
Das Recht spielt eine seltsame Rolle in Welteckes Analyse. "Rechtliche Abgrenzung" ist einer jener Faktoren, die für die negative spätmittelalterliche Entwicklung hin zu abgeschlossenen Formationen verantwortlich sein sollen. "Recht" ist in diesem Buch immer Verhinderungsrecht, nie Ermöglichungsrecht. Es dient zur Erklärung von Inquisition, Kopfsteuer, Bekleidungszwängen und so fort. Doch das deutsche Judenschutz-Recht oder das islamische Schutzbefohlenen-Recht diskriminierten zwar, waren aber gleichzeitig entscheidende Ermöglichungsfaktoren für das friedliche Nebeneinander, das dieses Buch beschreibt. Ohne die "Verrechtlichung" der Beziehungen zwischen den Glaubenstraditionen hätte es diese mittelalterliche Welt nicht geben können. Das Buch räumt also beeindruckend mit Mittelalter-Klischees auf, leidet aber an einer vereinfachenden Vorstellung, die die Darstellung färbt: Nach dem Mittelalter wurde angeblich verrechtlicht, verhärtet, vereindeutigt, abgeschlossen, abgegrenzt. Das ist ein Neuzeit-Klischee, auch für den europäischen Raum.
Es spricht also viel dafür, den Untertitel des Buches über die Entstehung der Religionen einfach zu überlesen. Dann kann man sehr viel aus Welteckes Buch lernen, auch über heutige Religionen: über Formationen, in denen soziale Zugehörigkeit wichtiger ist als Lehrdefinitionen. DAG NIKOLAUS HASSE
Dorothea Weltecke: "Die drei Ringe". Warum die Religionen erst im Mittelalter entstanden sind.
C. H. Beck Verlag, München 2024. Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung. 608 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die drei Ringe" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









