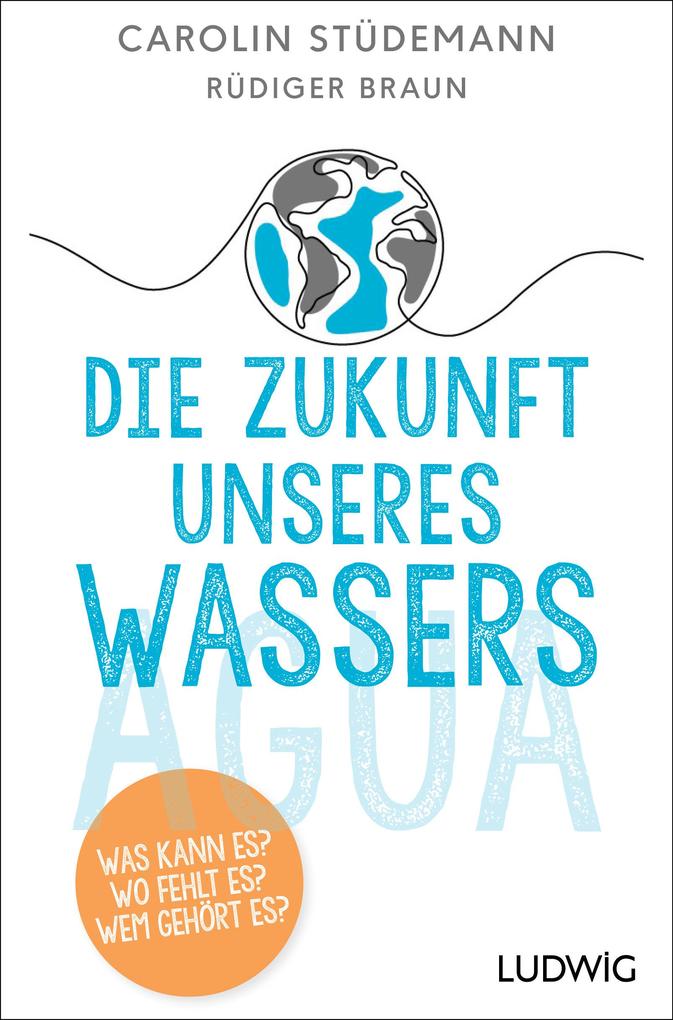
Sofort lieferbar (Download)
Auf das wenige Süßwasser der Welt stürzen sich acht Milliarden Menschen. Landwirtschaft, Industrie, Privathaushalte - alle brauchen Wasser. Das gibt Ärger: Verschmutzung, Vergeudung, Profitstreben. Die Wasserkrise hat viele Gesichter, genau wie die Mission, Wasser für alle Menschen zugänglich zu machen. Nur wenige sind darüber so gut informiert wie Carolin Stüdemann. Sie ist Geschäftsführende Vorständin des gemeinnützigen Vereins Viva con Agua. Die Hamburger NGO setzt sich global und wirksam für den Zugang zu sauberem Wasser ein. Das faszinierende Element Wasser, seine Kraft und seine Gefährdung: Dieses hochaktuelle und sorgfältig recherchierte Buch klärt auf, bringt die Leser*innen zum Staunen, lädt zum Mitreden ein. Zahlreiche Wissenschaftler*innen und engagierte Prominente kommen zu Wort. Die zentrale Botschaft dieser Liebeserklärung an ein gefährdetes Gut: Die Welt hat ein Wasserproblem. Aber Probleme lassen sich bekanntlich lösen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. März 2025
Sprache
deutsch
Dateigröße
9,49 MB
Autor/Autorin
Carolin Stüdemann, Rüdiger Braun
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783641321482
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein Sachbuch, das viel will und zum Glück noch mehr einlöst. « Courage
»Das Buch informiert ausführlich darüber, was Wasser ist, kann und muss, in welchem Zustand sich Wasserressourcen weltweit befinden, wo es leidet, schwindet und fehlt (. . .). « Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ulla Fölsing
»Dicht und gut recherchiert. « Falter, Gerlinde Pölsler
»Das Buch informiert ausführlich darüber, was Wasser ist, kann und muss, in welchem Zustand sich Wasserressourcen weltweit befinden, wo es leidet, schwindet und fehlt (. . .). « Frankfurter Allgemeine Zeitung, Ulla Fölsing
»Dicht und gut recherchiert. « Falter, Gerlinde Pölsler
 Besprechung vom 31.03.2025
Besprechung vom 31.03.2025
Ohne Wasser keine Zukunft
Plädoyer für einen sorgsamen Umgang
Wasser trinke ich saisonal und regional immer aus dem Hahn. Der Wasserhahn ist ja der Unverpacktladen für Getränke", witzelt der Arzt und Kabarettist Eckart von Hirschhausen im Vorwort zu "Die Zukunft unseres Wassers". Verfasst hat das "Sachbuch für die breite Öffentlichkeit" über das konfliktträchtige Thema die Organisationspädagogin Carolin Stüdemann, Chefin des gemeinnützigen Hamburger Vereins "Viva con Agua", gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Rüdiger Braun. Das Buch informiert ausführlich darüber, was Wasser ist, kann und muss, in welchem Zustand sich Wasserressourcen weltweit befinden, wo es leidet, schwindet und fehlt, aber auch darüber, wem es gehört. Damit soll Bewusstsein geweckt werden für einen sorgsameren Umgang mit der vom Klimawandel beeinträchtigten, knappen Ressource Süßwasser sowie für die Notwendigkeit, dass jeder Mensch Zugang dazu bekommt. Denn über 700 Millionen Menschen, speziell in Subsahara-Afrika, können nicht einmal ihre Grundversorgung mit sauberem Wasser decken. Und über die Hälfte der Weltbevölkerung verfügt nicht über Toiletten mit hygienischer Abwasserentsorgung.
Das auch äußerlich ansprechende, umfangreiche Taschenbuch könnte tatsächlich ein breites, vor allem jüngeres Publikum erreichen: seine lockere Schreibweise, die munteren, eingängigen Grafiken, das bunte Layout, dazu transportieren medienbekannte Umweltschutz-Verfechter wie der Rockmusiker Bela B. von der Band "Die Ärzte" und der ARD-Wetterexperte Sven Plöger in ergänzenden Statements zusätzlich Kenntnis, Sympathie und Engagement. Ganz zu schweigen vom Hamburger Kultfußballklub St. Pauli, dessen Mittelstürmer Benjamin Adrion nach einem Trainingslager in Kuba den Verein "Viva con Agua de Sankt Pauli" gründete. An der Spitze dieses Hilfsprojekts agiert seit sechs Jahren die "geschäftsführende Vorständin" Carolin Stüdemann.
Im ersten Kapitel ihres Buches berichtet sie nicht nur über ihren eigenen Weg zu diesem Job, sondern auch über die Entwicklung von "Viva con Agua" (spanisch: "Lebe mit Wasser") zum "social business". Die Non-Profit-Organisation, die sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung auf ihre Fahnen geschrieben hat und inzwischen über ihr Konzept von Spiel, Sport und Spass international präsent ist, generiert heute unabhängig vom Spendenaufkommen erfolgreich eigenen Umsatz über Mineralwasser, Komposttoiletten sowie ihre jährlich stattfindende, viertägige Kunstveranstaltung "Millerntor Gallery" im Hamburger Stadion des Fußballklubs St. Pauli.
Im Mittelpunkt des Buches stehen detailreich Daten, Zahlen und Fakten zum Wasser - zu seinem wachsenden globalen Verbrauch, dem klimabedingten Schwund, der industriellen Verschwendung sowie dem weltweiten Engagement gegen Wasser-Probleme. In Kapitel vier geht es dabei um die Lage in Deutschland, anschließend um die Gletscherschmelze und das Leben zwischen den Extremen Dürre und Überschwemmung. Thematisiert werden auch die Probleme, die entstehen können, wenn die öffentliche Hand die Grundversorgung privatisiert. Kritisch sehen die Autoren den Wettstreit von Unternehmen wie Nestlé und Coca-Cola um die besten Quellen, die bisweilen erbarmungslos ausgebeutet werden. Die Folge: Die Brunnen in der Region versiegen, und die Bewohner leiden unter Wassermangel.
Gegen den Raubbau an Wasser wendet sich die kanadische Publizistin Maude Barlow seit 40 Jahren. Für ihren Einsatz hat sie im Jahr 2005 den alternativen Nobelpreis erhalten. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass das Menschenrecht auf Wasser 2010 von der UN-Vollversammlung anerkannt wurde. Im vorliegenden Buch mahnt sie: "In einer Welt, in der das Süßwasser erschreckend schnell knapp wird, kann es kaum überraschen, dass Trinkwasserversorger, Abfüller, industrialisierte Landwirtschaft und Bergbaukonzerne um das kämpfen, was noch übrig ist . . . Das Wasser gehört der Erde, allen Spezies und allen künftigen Generationen. Wasser darf nicht privatisiert, zur Ware erklärt oder den Marktmechanismen unterworfen werden, wie es bei Öl und Gas der Fall ist."
Wie also künftig mit der kostbaren Ressource besser umgehen? Die Wasserkrise hat viele Gesichter, genau wie die Mission, Wasser für alle Menschen zugänglich zu machen. Neben den Herausforderungen rund um das Wasser bemüht sich das Buch auch um konkrete Lösungsvorschläge und praktische Tipps. Die Ideen reichen von der Nutzung von Regenwasser über Nebelfänger, mit deren Hilfe Feuchtigkeit aus der Luft geholt wird ("Wolken kämmen"), bis hin zum Brauen von Bier aus recycliertem Abwasser. Solches auf breiter Basis ohne Hemmschwelle innovativ wieder zu verwenden, scheint ein wichtiger Schritt. Vermittelbarer für die meisten von uns dürfte allerdings zunächst ein anderer Vorschlag sein, der noch dazu an die Gesundheit appelliert: Angesichts des hohen Wasserfußabdrucks in vielen Produktionsketten hilft auch schon, weniger Fleisch zu essen und mal auf einen Becher Kaffee zu verzichten, für dessen Entstehen 130 Liter Wasser nötig sind. Außerdem häufiger mit simplem Leitungswasser den Durst zu löschen. ULLA FÖLSING
Carolin Stüdemann und Rüdiger Braun: Die Zukunft unseres Wassers. Was kann es? Wo fehlt es? Wem gehört es? Ludwig Verlag, München 2025, 304 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 17.03.2025
Ein echtes Must-Read für jeden, der an positiven Veränderungen interessiert ist und Viva con Agua besser kennenlernen möchte!









