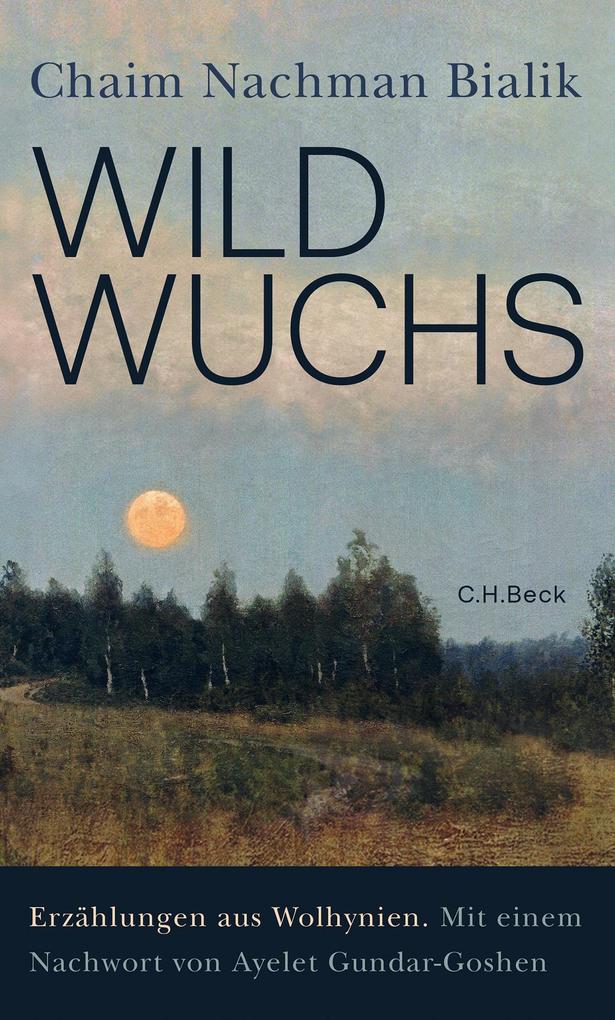
Sofort lieferbar (Download)
Chaim Nachman Bialik gehört zu den bedeutendsten modernen Autoren des Hebräischen, aber seine meisterhaften Erzählungen wurden bisher noch nie ins Deutsche übertragen. Der Band versammelt drei Geschichten vom jüdischen Leben in Wolhynien, das Bialik mit der gleichen Zärtlichkeit beschreibt, die Siegfried Lenz seinem Suleyken entgegenbrachte. Doch die Erzählungen bieten viel mehr als Blicke in eine versunkene Welt, sie handeln in unvergesslichen tragischen und urkomischen Szenen von Feindschaft und verbotener Liebe, Stolz und Scham eines Heranwachsenden, von der Macht der Tradition und dem Traum vom verlorenen Paradies.
Das dörfliche Leben der jüdischen Holzhändlerfamilie ist für die Kinder ein festgefügter Kosmos, doch für die Obrigkeit illegal, und so bahnt sich langsam die Katastrophe an . . . Zwei Nachbarskinder, Noah und Marinka, können sich jahrelang nur durch Löcher im Zaun verständigen. Am Ende siegt die Liebe über den Hass der Eltern, aber nur scheinbar . . . Ein Junge entzieht sich durch Nichtstun dem strengen Vater und erträumt sich eine ganz eigene Welt, in der Dorf, Felder und Wälder zum gelobten Land werden . . . Wie Kafka gelingt es Bialik, Unsicherheiten, Ängste, innere und äußere Konflikte in unvergesslichen, geradezu parabelhaften Geschichten zu bannen. Der Band enthält außerdem Bialiks berühmtes Langgedicht «In der Stadt des Tötens» über die russischen Pogrome in Kischinew: ein hebräisches Klagelied in mittelalterlicher Tradition, das in seinem modernen Duktus auf Paul Celan vorausweist.
Die Übersetzung aus dem Hebräischen wurde gefördert von Litprom e. V. in Kooperation mit dem Goethe-Institut.
Das dörfliche Leben der jüdischen Holzhändlerfamilie ist für die Kinder ein festgefügter Kosmos, doch für die Obrigkeit illegal, und so bahnt sich langsam die Katastrophe an . . . Zwei Nachbarskinder, Noah und Marinka, können sich jahrelang nur durch Löcher im Zaun verständigen. Am Ende siegt die Liebe über den Hass der Eltern, aber nur scheinbar . . . Ein Junge entzieht sich durch Nichtstun dem strengen Vater und erträumt sich eine ganz eigene Welt, in der Dorf, Felder und Wälder zum gelobten Land werden . . . Wie Kafka gelingt es Bialik, Unsicherheiten, Ängste, innere und äußere Konflikte in unvergesslichen, geradezu parabelhaften Geschichten zu bannen. Der Band enthält außerdem Bialiks berühmtes Langgedicht «In der Stadt des Tötens» über die russischen Pogrome in Kischinew: ein hebräisches Klagelied in mittelalterlicher Tradition, das in seinem modernen Duktus auf Paul Celan vorausweist.
Die Übersetzung aus dem Hebräischen wurde gefördert von Litprom e. V. in Kooperation mit dem Goethe-Institut.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
299
Dateigröße
1,06 MB
Autor/Autorin
Chaim Nachman Bialik
Übersetzung
Ruth Achlama
Vorwort
Ayelet Gundar Goshen
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783406826238
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 03.04.2025
Besprechung vom 03.04.2025
Romeo und Julia im Schtetl
Mit "Wildwuchs" liegen erstmals Erzählungen des Lyrikers Chaim Nachman Bialik auf Deutsch vor.
Shakespeare mag der bedeutendste Tragödienschreiber seiner Zeit gewesen sein, die wahre Tragödie von Romeo und Julia haben andere geschrieben. Was in dem berühmten Stück letztlich eine Verkettung unglücklicher Umstände ist, arbeiten spätere Autoren in ihrer Prosa zu unlösbaren Konflikten für die beiden Beteiligten aus. Gottfried Keller treibt in seiner Novelle "Romeo und Julia auf dem Dorfe" die beiden Familien erst in den Ruin und lässt das Paar dann verzweifelt in den gemeinsamen Tod gehen.
Bei Chaim Nachman Bialik stirbt in "Hinter dem Zaun" zwar niemand, doch könnte das Ende bitterer nicht sein. Der Jude Noah und die Goja Marinka kennen einander von klein auf. Ein Zaun hindert die beiden Kinder daran, zueinanderzukommen. Doch nicht nur der. Das verwaiste, ohnehin vaterlose Mädchen lebt bei einer alten Russin, die es praktisch gefangen hält. Noahs Eltern verbieten ihm jeden Kontakt mit Marinka. Der Junge rebelliert. "Er, Noah, tue alles, was er wolle." Irgendwann ist es vorbei mit dem Jungengehabe, er fügt sich in eine arrangierte Ehe mit einer "jüdischen Jungfrau", während Marinka mit ihrer beider "Söhnchen auf dem Arm hinter dem Zaun" steht. Sie wiederholen das Schicksal der Generation vor ihnen, ein Entkommen gibt es nicht.
Das ist brillant erzählt. Bialik gilt als einer der Väter der hebräischen Literatursprache, der neben einigen anderen das Hebräische, bis dahin dem Sakralen vorbehalten, in den Alltag holte. Die religiöse Quelle seiner Literatur ist nach wie vor spürbar. Wenn Noah sich an das Dorf erinnert, in dem er geboren worden ist, sieht er folgendes Bild vor sich: "Er als Kind verborgen in einem Haselstrauch neben einer Dornenhecke. Die Himmelsränder wie ein Feuerbrand. Die ganze Welt rot lodernd. Der väterliche Hof ganz in Rot getaucht."
Sprachlich bringen die drei Erzählungen und das Poem "In der Stadt des Tötens" ungeheuren Genuss mit sich, schwierig wird es bei der Deutung. Der Auftakttext des Bandes, "Die beschämte Trompete", stellt in gewisser Weise das Gegenstück zu "Hinter dem Zaun" dar und beschreibt die Vertreibung einer jüdischen Familie aus dem Dorf, obwohl der älteste Sohn in der Armee des Zaren dient. Der titelgebende "Wildwuchs" ist eine autobiographische Skizze, die zeigt, wie viel vom Autor in die Figur des Noah eingegangen ist. "Die Heiratsvermittler lassen mir keine Ruhe", stöhnt der Icherzähler dort, der immer wieder mit dem Vater aneinandergerät.
Bleibt das Poem, das ein Pogrom in Kischinew, dem heutigen Chisinau, beschreibt, zu dem es 1903 gekommen ist, dem Jahr, in dem auch die antisemitische Hetzschrift "Die Protokolle der Weisen von Zion" erstmals in Russland erschien. Für die Gewalt gegen Juden findet der 1873 geborene Bialik Bilder, die in Erinnerung bleiben. Da verkriechen sich jüdische Männer wie "Mäuse" und sehen tatenlos zu, wie ihre Frauen, Mütter und Töchter vergewaltigt werden. Ayelet Gundar-Goshen geht in ihrem engagierten Nachwort auf diese Stelle ein. "Bialik tadelt und beleidigt die Juden, tut dies jedoch wie der Feldwebel vor seinen Rekruten, der seine Soldaten zugunsten einer größeren Aufgabe demütigt - um sie zu jenen Kämpfern, jenen ganzen Kerlen zu machen, die sie sein müssen, wenn sie jemals eine eigene Heimat haben wollen."
Das legt den Finger auf die Schwierigkeiten bei der Deutung. Wie Karl Emil Franzos und Isaac Bashevis Singer schildert Bialik Alltag im Ostjudentum, fängt ungeschönt und kritisch die derbe, kunstfeindliche und intolerante Lebensweise ein. Abschottung wird großgeschrieben. In "Hinter dem Zaun" vertreibt die frisch eingewanderte jüdische Gemeinschaft die angestammte russische. Nur Marinka bleibt, doch niemand unternimmt etwas gegen die alte Russin, die sie schlägt. Im Gegenteil, auch diese soll noch fortgejagt werden, notfalls mit Gewalt.
Bialik hat mit seiner Spracherneuerung im heutigen Israel enorme Bedeutung, in Tel Aviv erhalten Mütter zur Geburt des ersten Kindes einen Band mit seinen Kinderliedern. Auch das hält Gundar-Goshen fest. Bialik selbst hatte 1924 endgültig ein Zuhause in Tel Aviv gefunden und sich für einen eigenen israelischen Staat starkgemacht. Lassen sich seine Erzählungen damit als Kommentar auf die heutige Situation lesen? Jein. Aus diesen Texten lässt sich keine eindeutige Option für eine der beiden Seiten ableiten. Die Gewalt gegen Juden wird hier ebenso dokumentiert wie die Gewalt, die von Juden ausgeht. Aber, und das hebt diese Texte über den erzählerischen Genuss hinaus, sie bebildern anschaulich ein Dilemma, dem eben nicht mit einem schlichten Entweder-oder beizukommen ist, geschweige denn mit Boykotten. Wenn in Noah einiges vom Autor steckt, dann gibt sich hier ein Mann zu erkennen, der immer noch nach dem Weg sucht, wie Orthodoxie und Erneuerung, Selbstschutz und Offenheit in Einklang zu bringen sind. Darin liegt die eigentliche Tragödie. "Wildwuchs" sperrt sich gegen eine schlichte Deutung. Darin liegt ihr Wert. CHRISTIANE PÖHLMANN
Chaim Nachman Bialik: "Wildwuchs". Erzählungen.
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. Verlag C. H. Beck, München 2025.
299 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








