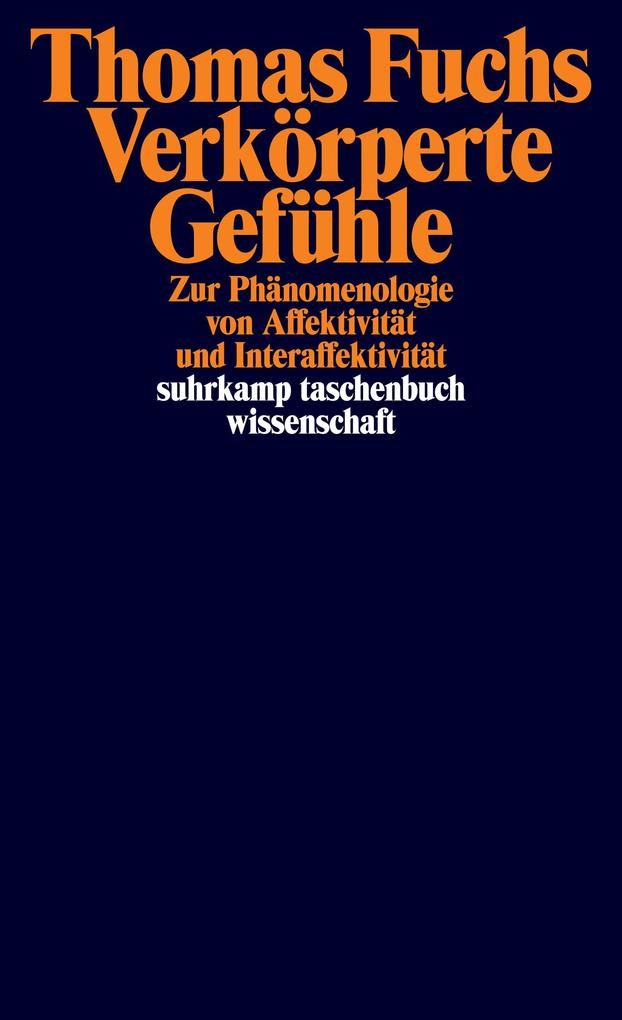
Sofort lieferbar (Download)
Gefühle gelten nach herrschender Auffassung als mentale Zustände, die in einer verborgenen Innenwelt des Subjekts beziehungsweise in dessen Gehirn zu lokalisieren sind. Dem steht eine Konzeption der Verkörperung gegenüber, die Gefühle als Phänomene begreift, welche Selbst und Welt in leiblicher Resonanz miteinander verbinden. Auch Intersubjektivität beginnt aus dieser Perspektive nicht mit einem isolierten Ich, das den Weg zu anderen erst finden muss, sondern mit Interaffektivität. Diese stiftet die primären, zwischenleiblichen Beziehungen ebenso wie die dauerhaften Bindungen zu anderen Menschen. Am Beispiel zahlreicher Gefühle wie Empathie, Vertrauen, Scham, Hass und Trauer entwickelt Thomas Fuchs in seinem Buch eine neue Sicht auf unsere affektive Verbindung mit der Welt.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
18. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
Originalausgabe
Seitenanzahl
412
Dateigröße
2,46 MB
Reihe
suhrkamp taschenbücher wissenschaft
Autor/Autorin
Thomas Fuchs
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783518781029
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Eine eindrückliche, keineswegs irrationale Rehabilitation der Gefühle. « Christoph Türcke, DIE WELT
»Es schimmert durch manche Formulierungen eine beinahe literarische Farbigkeit hindurch. Nicht auszuschließen darum, dass deren Lektüre eine Selbsterkundung des Lesers anregt und einer èducation sentimentale zugutekommt. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Es schimmert durch manche Formulierungen eine beinahe literarische Farbigkeit hindurch. Nicht auszuschließen darum, dass deren Lektüre eine Selbsterkundung des Lesers anregt und einer èducation sentimentale zugutekommt. « Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Besprechung vom 28.02.2025
Besprechung vom 28.02.2025
Aus den Tiefen des Körpers
Wider die Vorstellung von einer privaten mentalen Innenwelt: Thomas Fuchs erkundet den Raum der Gefühle
Thomas Fuchs hat die "Verteidigung des Menschen" zu seiner Sache gemacht. In einem Buch dieses Titels, das vor wenigen Jahren erschienen ist, tritt er nicht als Anwalt eines Angeklagten auf, sondern als Fürsprecher eines Opfers, das freilich in Personalunion zugleich Täter ist. Verteidigt wird der Mensch gegen sich selbst - der Mensch, wie er leibt und lebt, gegen den Menschen, wie ihn ein "szientistisches Menschenbild" vor- und darstellt. Fuchs, Inhaber der Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg, hält den "reduktionistischen Naturalismus", dem Bio- und Neurowissenschaften ebenso wie Spielarten der Kognitionspsychologie frönen, für fatal. In naturalistischer Sicht werde aus dem Menschen ein datenverarbeitendes Gespenst, das in einer biochemischen Maschine haust.
Dieses Menschenbild gewinne durch die allgegenwärtigen Computertechnologien formative Macht und drohe zu einem Selbstbild von uns Alltagsmenschen zu werden. Dagegen bietet der Autor einen "Humanismus des lebendigen, verkörperten Geistes" auf, der von den phänomenologischen Strömungen der jüngeren Philosophiegeschichte inspiriert ist. Die Verteidigung des leibenden und lebenden Menschen findet nun ihre Fortsetzung in dem wohlkomponierten Aufsatzband "Verkörperte Gefühle".
Fuchs möchte, wie er in der Einleitung formuliert, die Gefühle "befreien". Das versteht sich nicht als Ermunterung, die Sau rauszulassen. Befreit werden sollen Emotionen aus der mentalen Innenwelt, in die sie die Emotionspsychologie einsperre. Gefühle, soll das unter anderem heißen, lassen sich nur angemessen beschreiben und begreifen, wenn nicht von ihrer Verkörperung abgesehen wird und von ihrer Ausdehnungsfähigkeit. In dieser Perspektive kommt nicht nur die Sphäre des eigenen Leibs ins Spiel, sondern auch die der "Zwischenleiblichkeit": Affekte und Emotionen, die ich "habe", habe unter Umständen nicht nur ich, auch andere können sie haben oder an ihnen teilhaben, von ihnen in Mitleidenschaft gezogen sein. So gesehen sind sie nichts Privates, nichts ausschließlich Höchstpersönliches. Über zwischenleibliche Resonanzen hinaus dehnt der Gefühlsraum sich aus; subjektive Befindlichkeiten sind verwoben mit Stimmungen und Atmosphären, die nicht "in mir" sind, in denen vielmehr ich mich vorfinde - mit anderen Menschen, mit Dingen, mit Umgebungen.
Die "leibräumliche" ebenso wie "interpersonale" Dimension der Gefühle akzentuierend, schreibt Fuchs gegen einen (in der europäischen Geistesgeschichte vorgeprägten) Dualismus an, der affektive Innenwelt und gefühlsneutrale Außenwelt, Subjektivität und Objektivität, gegeneinander abscheidet. Die Welt ist für ihn in gewissem Sinne Gefühlswelt, gefühlte und erfühlte Welt; Menschen sind fühlend, spürend in dieser Welt, ihr "In-der-Welt-Sein", wie es in Anlehnung an die Terminologie der Philosophie Heideggers heißt, ist stets "affektiv getönt und gestimmt". Ohne solche spürende Welterschließung, die auch das Wahrnehmen und Erkennen trägt, wäre die Welt "ein Ort ohne Sinn, Wert oder Bedeutsamkeit".
Die phänomenologischen Expeditionen beginnen elementar mit dem Selbstempfinden, dem grundierenden Gefühl des Lebendigseins, in dem Leben und Erleben, Vitalität und Subjektivität, ineinander übergehen. Erkundet werden sodann die raumgreifenden Stimmungen und die "intentionalen Emotionen". Als orientierende Unterscheidung erweist sich dabei immer wieder diejenige zwischen Körper und Leib, zwischen "objektiv" beschreibbarem Organismus und "subjektiv" empfindendem, leiblich existierendem Individuum. Die Dimension der "Interaffektivität" wird unter dem Aspekt der Empathie und ihrer Grenzen zum Thema, aber auch unter demjenigen des Vertrauens: ohne Vertrauen in andere Menschen keine "basale Vertrautheit" mit der Lebenswelt, keine Beheimatung in der Welt. Die Erschütterung solchen Weltvertrauens rückt in Form von psychopathologischen Phänomenen in den Blick: posttraumatische Belastungsstörungen, die Neigung zu Verschwörungserzählungen, Schizophrenie.
Psychische Störungen und Krankheiten sind aufschlussreich für die Beschreibung dessen, was "normalerweise" im Hintergrund bleibt und dafür sorgt, dass wir mit anderen in einer gemeinsamen Realität leben. Ähnlich erhellend sind negative Gefühle für die Analyse des affektiven In-der-Welt-Seins im Ganzen. Überwiegend solchen Gefühlen ist der letzte Abschnitt des Bandes gewidmet: der Angst, der Trauer, der Verzweiflung etwa, dem Hass als wirkmächtigster kollektiver Emotion sowie dem Ekel, der wie kaum ein anderer Affekt "aus den Tiefen der Eingeweide" aufsteige und in der Sphäre des Zusammenlebens als Aversion gegen Unverträgliches, Fremdes zu einer "gefährlichen Emotion" werden könne. Nach all den Varianten leibseelischer Negativität erwarten den Leser zum Schluss, als hätte er sich eine Belohnung verdient, Überlegungen zum Thema Glück und Zeit: Der Zeit enthoben, statt mit ihr im Wettlauf zu sein - das kann Glücksgefühle erzeugen. Doch ein tief reichendes, ein "nachhaltiges" Glück, so Fuchs, beschere einem erst eine "erfüllte" Gegenwart, die von der Vergangenheit nicht abgeschnitten sei, die "Gelebtes, Erlittenes und Erreichtes" in sich enthalte und so eine "Bejahung des eigenen Lebens insgesamt" ermögliche.
Marcel Prousts literarische Suche nach der verlorenen Zeit und dem wahren Leben, das im gelebten sich verbirgt, markiert den weiteren Horizont dieser Phänomenologie der Gefühle. Ein Zitat aus Prousts Recherche steht bereits am Anfang der Exkursionen; es schildert das Zu-sich-Kommen aus tiefem Schlaf, in dem der Erwachende zuallererst, ohne sogleich zu wissen, wo er sich befindet oder wer er ist, sich selbst in leiblicher Lebendigkeit spürt. Auch wenn die Texte, die das neue Buch von Thomas Fuchs versammelt, Handbuchartikel teils sind, teils sein könnten, schimmert durch manche ihrer Formulierungen eine beinahe literarische Farbigkeit hindurch. Nicht auszuschließen darum, dass deren Lektüre eine Selbsterkundung des Lesers anregt und einer éducation sentimentale zugutekommt. UWE JUSTUS WENZEL
Thomas Fuchs: "Verkörperte Gefühle". Zur Phänomenologie von Affektivität und Interaffektivität.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2024. 412 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Verkörperte Gefühle" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









