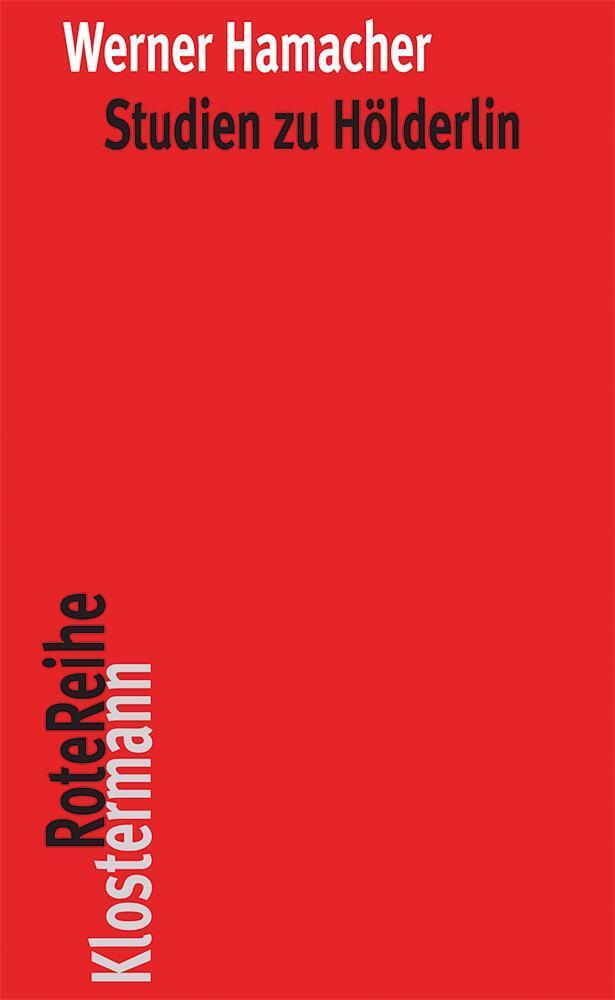
Zustellung: Do, 12.06. - Do, 19.06.
Versand in 6 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Werner Hamachers Hölderlin-Interpretationen seit seiner Berliner Magisterarbeit von 1971, die in diesem Band ebenfalls erstmals abgedruckt wird, sind vielleicht die ersten Dekonstruktionen bedeutender poetischer Texte in deutscher Sprache. Die hier präsentierten, zum Teil fragmentarischen Aufsätze, in denen der 2017 verstorbene Literaturtheoretiker sich auch mit Heideggers Hölderlin-Auslegung beschäftigt, belegen die außerordentliche Fähigkeit, strengste Philologie elegant und geistvoll zu inszenieren. Wer sich in sie versenkt, wird immer wieder davor erstaunen, wie einzigartig Hölderlins Dichtung war und ist.
Following up on his magisterial Berlin master's thesis on Hölderlin s poetry of 1971 (which this volume presents for the first time in print), Werner Hamachers continuing attempts at close-reading Hölderlin represent perhaps the first deconstructions of important poetic texts in the German language. The essays presented here, some of them fragmentary, in which the late literary theorist also deals with Heidegger's interpretation of Hölderlin, are proof of his extraordinary ability to stage the most rigorous philology in an elegant and witty manner. Anyone who immerses himself in them will always be amazed at how unique Hölderlin's poetry was and still is.
Following up on his magisterial Berlin master's thesis on Hölderlin s poetry of 1971 (which this volume presents for the first time in print), Werner Hamachers continuing attempts at close-reading Hölderlin represent perhaps the first deconstructions of important poetic texts in the German language. The essays presented here, some of them fragmentary, in which the late literary theorist also deals with Heidegger's interpretation of Hölderlin, are proof of his extraordinary ability to stage the most rigorous philology in an elegant and witty manner. Anyone who immerses himself in them will always be amazed at how unique Hölderlin's poetry was and still is.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Mai 2020
Sprache
deutsch
Auflage
2020
Seitenanzahl
186
Reihe
Klostermann RoteReihe
Autor/Autorin
Werner Hamacher
Herausgegeben von
Sara Shinu Ottenburger, Peter Trawny, Sara Ottenburger
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
195 g
Größe (L/B/H)
200/123/16 mm
ISBN
9783465044246
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 10.12.2020
Besprechung vom 10.12.2020
Halbgötterdämmerung
Warum bei diesem viel gedeuteten Dichter stabiler Sinn und Logik nicht zu haben sind: Hölderlin-Studien aus dem Nachlass des Komparatisten Werner Hamacher.
Als Werner Hamacher 1971 seine Arbeit zu Hölderlins später Lyrik abschließt, ist der Dichter hoch umstritten. Das jüngst wiederbelebte Bild des schwäbischen Gemütsautors ("Komm ins Offene" oder wenigstens auf den Balkon) wie das des unfreiwilligen Lieferanten von vaterländischen Verszitaten für die Tornisterkultur des Weltkriegs waren zwar schon verblasst. 1961 aber hatte der französische Psychoanalytiker Jean Laplanche seine Studie über die Abwesenheit als Leitmotiv des vaterlos groß gewordenen Poeten veröffentlicht. Theodor W. Adorno hielt 1963 und publizierte 1966 seinen Vortrag "Parataxis", mit dem er Martin Heideggers von "ins Maßlose gesteigerter Ehrfurcht" gegenüber dem Dichter bestimmten Deutungen entgegentrat, die Hölderlins Sprache als eine Ursprache der wahren Deutschen behandelten. Der Germanist Pierre Bertaux wiederum entdeckt 1969 den Jakobiner Hölderlin, und Peter Weiss schreibt im Jahr darauf ein Theaterstück, das Hölderlin sogar als Wegweiser revolutionärer Wege hin zu Marx darstellt. Anfang der Siebziger Jahre wendet sich dann der Buchgraphiker Dietrich E. Sattler dem Dichter zu, was zur Frankfurter Werkausgabe im Verlag "Roter Stern" mit ihren manuskriptgetreuen Umschriften jeglicher Zeile Hölderlins führen wird.
Hamacher ist damals dreiundzwanzig, der Text seine Magisterarbeit, jetzt aus dem Nachlass des 2017 verstorbenen Komparatisten herausgegeben. Er hatte an der Freien Universität Berlin bei Peter Szondi studiert, der sich, während Hamacher schrieb, das Leben nahm. Dessen Schriften zu Hölderlin streift der Student jedoch ohnehin kaum. Vielmehr folgt er ohne viel Absicherung durch fremde Forschungen einzelnen Passagen aus den Gedichten Hölderlins. Stets geht es ihm darum, sie als fortgesetzte Kritik an stabilem Sinn, Logik, eindeutiger Sprache auszulegen.
Nur wenige Beispiele: Der Strom ergreift und stürzt zugleich, sucht "Ruh" im Abgrund, aber eilt zum Meer. Unsterbliche Götter bedürfen der Sterblichen, weil sie von selbst nichts fühlen, so dass in ihrem Namen "ein anderer" teilnehmend fühlt: "Den brauchen sie." Griechische Halbgötter werden um Christus ergänzt, aber die Vervollständigung führt nicht zum Ausgleich: "jezt ist voll / Von Trauern meine Seel / Als eifertet, ihr Himmlischen, selbst / Daß, dien' ich einem, mir / Das andere fehlet." Wer des Halbgotts Bruder ist, lässt sich am Text - "Denn zu sehr / O Christus! häng' ich an dir, / Wiewohl Herakles' Bruder" - nicht entscheiden, aber sicher ist, dass für den Dichter Dionysos und Christus Geschwister sind: von Ost nach West ziehende Weingötter. Christus erfüllt, aber stirbt. Hölderlin habe, heißt es bei Hamacher, die Fremdheit dessen bedeuten wollen, was einander nah sei. So fallen Unterscheidungen ineinander, beim Tier etwa, "das lebend / vom eigenen Hunger schweift". Oder es tritt an Worten wie "fehlen" (ausbleiben oder Falsches tun) und "Geschick" (Schicksal oder Könnerschaft) die paradoxe und "nicht synthetisierbare" Divergenz aller Bezeichnungen hervor. Voilà: Erkennbar steht Hamacher unter dem Einfluss von Jacques Derrida, der erst ganz zum Schluss der Arbeit einmal erwähnt wird. Auf ihrer zweiten Seite findet sich der Begriff "Dekonstruktion", womöglich zum ersten Mal im Deutschen.
Die Lektüre dieser sehr dichten hundert Seiten ist schwierig. Hamacher liest Hölderlin, der mehr als andere Poeten von Worten wie "aber", "fast" und "scheint" Gebrauch machte, wie eine Exemplifikation einer prinzipiellen Vergeblichkeit, etwas auf den Begriff bringen zu können. Dem folgt sein eigener Stil. Einwände macht er sich nicht, jedenfalls nicht vor den Lesern.
Der Band enthält noch zwei weitere, mehr philosophische Stücke zu Hölderlin aus einem größeren Vorhaben, das Hamacher dann aber offenbar zugunsten seiner Dissertation über Hegel abgebrochen hat. Er schließt mit einem Text zu den 1934/35 gehaltenen Vorlesungen Martin Heideggers über die Hymnen "Germanien" und "Der Rhein" sowie der Vorlesung über Hölderlins "Der Ister", was auf den altgriechischen Name (istros) für die Donau zurückgeht. Hamacher hatte diesen Versuch, Hölderlin zum Dichter und Maßstab des nationalsozialistischen Deutschlands zu erklären, fünfzig Jahre danach in Berlin zum Gegenstand eines Seminars gemacht. Das mag die vergleichsweise leichtere Lesbarkeit erklären.
Mit Heidegger weiß er sich hier eins darin, die These, Dichtung sei Ausdruck eines wie immer (sozial, seelisch, biologisch oder kulturell) bestimmten Lebens, als Verirrung des neunzehnten Jahrhunderts zu bezeichnen. "Wenn [Oswald] Spengler", so Heidegger, "die Dichtung als Ausdruck der jeweiligen Kulturseele faßt, dann gilt dies auch von der Herstellung von Automobilen und Fahrrädern."
Hamacher belegt einen solchen Begriff der Dichtung mit verschiedenen Namen: bürgerlich liberalistisch, totalitär, metaphysisch, hegelianisch, "in letzter Instanz faschistisch" (was er wieder durchstreicht), sozial-technisch linguistisch. Was ihn dagegen aufbringt, geht aber besser aus seinem ästhetischen Argument hervor. Dichtung ist für ihn nicht Versinnlichung von etwas anderem, nicht "sinnbildlich", allegorisch oder symbolisch.
Hölderlin räumt in seiner späten Lyrik die Vorstellung ab, Texte riefen Götterbilder an: "Denn wenn es aus ist und der Tag erloschen, / Wohl trifft den Priester erst, doch liebend folgt / Der Tempel und das Bild ihm auch und seine Sitte / Zum dunklen Land, und keines mag noch scheinen." Und wenn keine Götterbilder, so der Schluss, dann auch nicht andere stabile Sagen, die für ihn ein "goldener Rauch" von Grabesflammen sind. Hamacher nimmt die "Sage" für "die Sprache" und schlussfolgert, dass Dichtung "die Sprache der Entfernung der Bilder" ist: Je näher man sie betrachtet, desto stärker lösen sie und ihre Figuren sich auf. Dichtung zeigt, was es mit Sprache an wenig Verlässlichem, Widersprüchlichem, sich selbst Widersprechendem auf sich hat.
Hat dieser Befund wiederum ein geschichtliches Datum, oder ist er eine sprachphilosophische Aussage über die Logik des Bezeichnens? Die dekonstruktive Schule schwankt gegenüber dieser Frage. Hamacher stellt sie so: "Wozu dann aber Dichtung gerade jetzt, 1934-1942?" Heidegger hält Hölderlin tatsächlich für den Sänger "vaterländischer Gesänge", ein Name, der sich auf eine Briefstelle berufen kann, in der Gedichte angekündigt werden, deren Text "unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit". Heideggers "Vaterland" aber ist ein Staat, der einem Volkswillen entsprungen sei. "An die Stelle des Seins zum Tode" in Heideggers Frühwerk, "ist das Sein zum Staate getreten", schreibt Hamacher und macht deutlich, dass es hierfür keinen Anhaltspunkt in Hölderlins Dichtung gibt. Denn wenn für ihn nicht einmal die Sprache regierbar ist, wie sollte es dann ein Regime geben können, das sich auf diesen Dichter berufen könnte?
JÜRGEN KAUBE
Werner Hamacher: "Studien zu Hölderlin".
Hrsg. von Shinu Sara Ottenburger und Peter Trawny. Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt 2020. 186 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Studien zu Hölderlin" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.






























