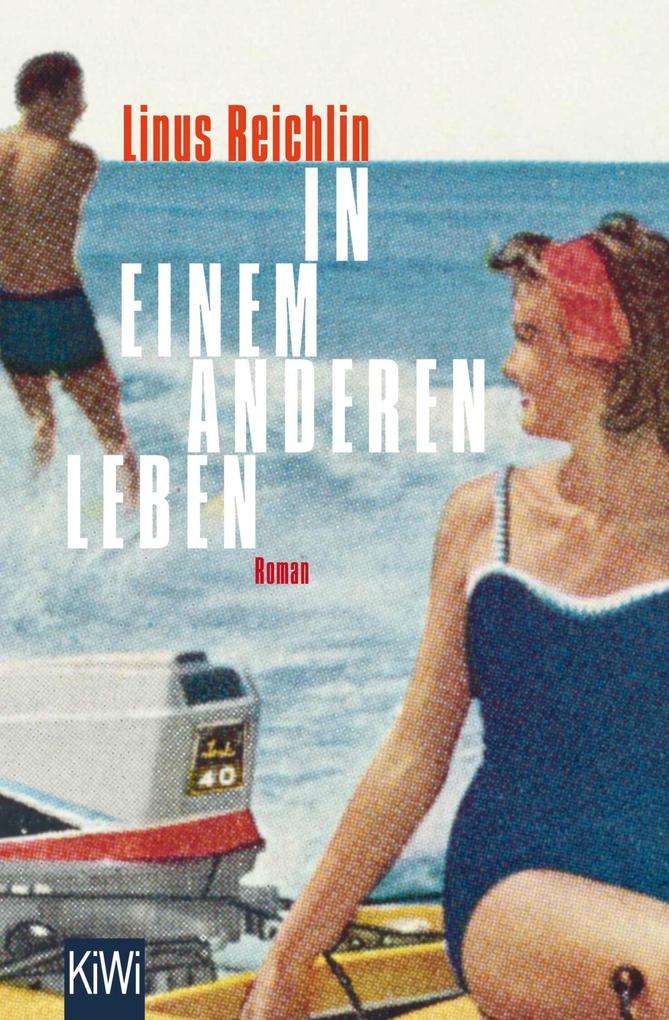
Sofort lieferbar (Download)
Kennen Sie die Sehnsucht danach, aus Ihrer Familiengeschichte auszubrechen völlig anders zu machen?
»Man kann nicht auf dem neuen Schiff die Segel hissen, wenn am Ufer jemand steht und ruft, erinnerst du dich noch, wie du letztes Mal gekentert bist? «
Als er noch ein Kind war, kamen ihm seine Eltern oft wie Richard Burton und Liz Taylor vor. Sie waren das schillernde Paar in einer spießigen Umgebung: schön, erfolgreich, voller Leidenschaft - und ständig f logen die Teller durch die Luft. Der Ehekrieg tobte, bis ein tragischer Unfall ihm ein Ende setzte. Und mittendrin: er, Luis.
Zwanzig Jahre später, Luis lebt schon lange in einem anderen Land und einem anderen Leben, lässt ein Zufall die Erinnerung an seine Jugendjahre wieder auf leben: In einer Berliner Galerie sieht er das von ihm gefälschte Gemälde, das auf fatale Weise mit dem Tod seiner Mutter verknüpft war.
Luis, ein Meister der Verdrängung, hatte damals alle Familienbande radikal gekappt. Sein Vater war eine Enttäuschung, einer, der sich am Whiskyglas festhielt und von der Bärenjagd träumte. Die unerwartete Wiederbegegnung mit dem Gemälde wirkt wie ein Wink des Schicksals, sich endlich der Vergangenheit zu stellen, die ihn, seine Beziehungen und vor allem ihr Scheitern, stärker bestimmt, als er sich eingestehen will. Und so beginnt für Luis eine Erinnerungsreise zu seinen Anfängen, zu seinen drei wichtigen Beziehungen und seinen Versuchen, den richtigen Rhythmus für sich in der Welt zu finden. Eine Reise, an deren Ende er - vielleicht - den richtigen Takt finden wird . . .
»Man kann nicht auf dem neuen Schiff die Segel hissen, wenn am Ufer jemand steht und ruft, erinnerst du dich noch, wie du letztes Mal gekentert bist? «
Als er noch ein Kind war, kamen ihm seine Eltern oft wie Richard Burton und Liz Taylor vor. Sie waren das schillernde Paar in einer spießigen Umgebung: schön, erfolgreich, voller Leidenschaft - und ständig f logen die Teller durch die Luft. Der Ehekrieg tobte, bis ein tragischer Unfall ihm ein Ende setzte. Und mittendrin: er, Luis.
Zwanzig Jahre später, Luis lebt schon lange in einem anderen Land und einem anderen Leben, lässt ein Zufall die Erinnerung an seine Jugendjahre wieder auf leben: In einer Berliner Galerie sieht er das von ihm gefälschte Gemälde, das auf fatale Weise mit dem Tod seiner Mutter verknüpft war.
Luis, ein Meister der Verdrängung, hatte damals alle Familienbande radikal gekappt. Sein Vater war eine Enttäuschung, einer, der sich am Whiskyglas festhielt und von der Bärenjagd träumte. Die unerwartete Wiederbegegnung mit dem Gemälde wirkt wie ein Wink des Schicksals, sich endlich der Vergangenheit zu stellen, die ihn, seine Beziehungen und vor allem ihr Scheitern, stärker bestimmt, als er sich eingestehen will. Und so beginnt für Luis eine Erinnerungsreise zu seinen Anfängen, zu seinen drei wichtigen Beziehungen und seinen Versuchen, den richtigen Rhythmus für sich in der Welt zu finden. Eine Reise, an deren Ende er - vielleicht - den richtigen Takt finden wird . . .
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. Januar 2015
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
384
Dateigröße
2,25 MB
Autor/Autorin
Linus Reichlin
Verlag/Hersteller
Kopierschutz
mit Wasserzeichen versehen
Family Sharing
Ja
Produktart
EBOOK
Dateiformat
EPUB
ISBN
9783462309041
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 11.04.2016
Linus Reichlin hat mit - In einem anderen Leben - eine spannende Lebensgeschichte geschrieben.
LovelyBooks-Bewertung am 31.05.2015
Luis Maiwald wird Zeit seines Lebens von einem Gespenst heimgesucht. Dieses Gespenst hat seinen Ursprung in seiner Kindheit und taucht in Form seines trunksüchtigen Vaters, der sich immer wieder auf¿s Heftigste mit seiner temperamentvollen Mutter streitet, auf. Früher, als Kind, konnte er während dieser Schreckensmomente immer unter die dämpfende Decke huschen, doch im Alter geht das nicht mehr und Luis lernt, zu verdrängen und zu mißtrauen. Er versucht sich in der Musik, die er aber nie beherrschen kann, wird Werbezeichner und findet sich in einigen Liebschaften wieder, die allesamt scheitern. Erst nach seinem Umzug in die deutsche Landeshauptstadt findet er die Frau, bei der er trotz seines seelischen Ungleichgewichts bleibt. Aber gerade hier holt ihn seine Vergangenheit mit voller Wucht ein, als er im Schaufenster eines Berliner Galeristen das Bild der Winterlichen Landschaft des niederländischen Malers Jan van Os sieht. Aber nicht das Original, sondern die einst von ihm für seine seit einem Schlaganfall und dem darauf folgenden Autounfall an einen Rollstuhl gefesselte Mutter nachgemalte Kopie. Eine so perfekte Kopie, daß Luis¿ Vater sie trotz des vehementen Widerspruches ¿ das Bild war für seine gelähmte Mutter quasi die einzige Verbindung zum Leben ¿ kurz nach dem Verkauf des Originals gewinnbringend weitergab. Seine Mutter starb, er kappte alle Verbindungen zu seiner Familie und vergaß den Vater. Aber als Gespenst ist er immer da und Luis droht zunehmend in seine Fußstapfen zu treten. Linus Reichlins vor kurzem bei Galiani (zu Kiepenheuer & Witsch gehörend) neu erschienener Roman trägt den Titel »In einem anderen Leben« und es ist ein Titel, der griffig ist, könnte doch Luis¿ Leben das von einem jeden sein. Vielleicht auch das des Autoren? Parallelen sind jedenfalls erkennbar, Namensähnlichkeit, Alter, Nationalität und Wahlheimat. Und so bekannte sich Reichlin kürzlich dazu, sein Roman habe durchaus autobiographische Züge. Daß das der Erzählung und im Besonderen der Person Luis¿ nicht immer gut tut, zeigt sich aber rasch. Chronologisches, stringentes Erzählen liegt dem Ich-Erzähler Luis nicht, aber er beginnt doch immerhin bei seiner Kindheit. Immer zwischen den Episoden hin- und herspringend erfährt der Leser zunehmend das Ausmaß der Tragödie, an der seine Familie zerbricht. Luis¿ Lebensprotokoll gleicht dabei einer Schilderung, den er so auch dem Zuhörer an einem langen Abend darlegen könnte. Er gibt nur seine Gefühle, Sichtweisen, Schilderungen, Erinnerungen wider und wird so auch immer wieder zu einem sehr unzuverlässigen Erzähler, dem man nicht zur Gänze über den Weg traut. Man fragt sich, ob das Bild, das er meint, gemalt zu haben, wirklich existiert, ob alle Gewalt in der Familie nur vom Vater ausging und inwieweit er tatsächlich so schuldlos an einigen seiner Taten ist. Denn obwohl er immer wieder beteuert, daß »es [¿] meine Schuld [ist]. Es liegt alles in meiner Verantwortung.« (S. 337), scheut er sich vor Verantwortung und seine Schritte in die Richtung sind marginal. Viel mehr ergeht er sich in Ursachenforschungen und Schuldverschiebungen hin zu seinem gespensterhaften Vater, kann nicht von der Musik, die er aus dem auch metaphorisch zu sehenden Bild der Takttaubheit nicht erfolgreich ausübt, lösen und teilt mit erbitterten Klagerufen gegen seine Umwelt aus. Umso erstaunlicher und auch unglaubwürdiger wirkt seine plötzliche Läuterung am Ende der Erzählung, als sich die Geschichte mit dem Schlüsselereignis, das Luis¿ Schicksal schon in der frühen Kindheit prägte, sich auch bei seinem Kind zu wiederholen droht. Luis ist ganz ergriffen von seinen eigenen Gedankengängen, er ist stolz darauf, neue Bedeutungen erschlossen zu haben und zu neuen Erkenntnisse zu gelangen, reagiert aber auf Denkanstöße und Kritik seiner wenigen Bekannten und Liebschaften gereizt und mit großem Unverständnis. »Die ausschließliche Konzentration meiner Mutter auf das Bild: war das am Ende ein Signal? Ihr Versuch, sich mit uns zu verständigen, über die gemeinsame Betrachtung des Bildes? Wie sonst hätte sie noch Gemeinsamkeiten herstellen können? Nur über das Bild war es möglich. Ihre Fixiertheit auf die Winterliche Landschaft diente vielleicht nur diesem einen Zweck: mit uns Gemeinsamkeit herzustellen. Schaut euch mit mir gemeinsam das Bild an! Ich bin jetzt überzeugt: So war es.« (S. 237) Man merkt Luis seinen Heureka-Moment und seine Freude über sein eigenes Erkennen deutlichst an. Fragen, die sich aber notwendigerweise stellen, werden von ihm nur am Rande, wenn überhaupt, formuliert. Warum zum Beispiel mußte es die bestmöglichst kopierte Version von Luis sein, der seine Mutter so lange keine Beachtung schenkte, bis auch die letzte Firnisschicht trocknete? Reichlin arbeitet mit starken, emotionalen Bildern, kann sie aber dem Leser nicht immer plausibel erklären, wenn sich Luis¿ Mutter nach dem Entfernen des Bildes stundenlang, in immer wiederkehrenden Intervallen übergeben muß. Aber wenn Luis eines kann, dann ist es das Erklären seiner Lage und das Sezieren eines Alkoholikerlebens. Dabei bedient er sich bekannter Lebensweisheiten und einfacher Seelenkundlereien, die eingängig und verständlich sind, und dem Leser gerade durch diese Simplizität einleuchtend erscheinen. »Die Angst zu überwinden aus Liebe sei das eine, sage ich. Aber was, wenn man mit Liebe Angst verbinde? Wenn man sich vor jemandem fürchten, den man liebt? [¿] Am Ende verbinde man möglicherweise die Liebe zu allem stets mit Furcht. Alles, was man liebe, jage einem dann möglicherweise Angst ein.« (S. 210) Dabei verfängt er sich aber auch hin und wieder in selbstbemitleidenden, nur im ersten Moment klug wirkenden Aussagen, wie sein Kommentar, es sei Unsinn, daß die Menschen, die er liebt, ihn in Bedrängnis bringen, sondern daß dem Leben dieser Part zukäme. Dafür, daß er hier eine Binsenweisheit mit großen Worten von sich gibt, hält er sich erstaunlich wenig daran und sieht gerade in den Menschen, die er liebt, auch seine ihn einengenden Grenzen. Der Roman beginnt stark und kann den Leser durch seine authentische, lebensnahe Art fesseln; viele werden sich in seinen Schilderungen eines Jugendlebens wiedererkennen. Schon allein der Einstieg ist nachdenklich und trotzdem federleicht. Der hypotaktische Schreibstil fördert den erzählenden Charakter und läßt sich flüssig und einfach lesen. Doch schon nach wenigen Seiten werden signifikante, erzählerische Schwächen sichtbar. Reichlins Hang zu Wiederholungen ist auffällig und auch nicht dramaturgisch erklärbar, wenn auf S. 234 von ihm gesagt wird »Ich stehe noch keine fünf Minuten in der Galerie, und schon hat er diese mir bekannte Bewegung dreimal ausgeführt.«, auf der gegenüberliegenden Seite etwa auf gleicher Höhe zu lesen steht: »Noch keine fünf Minuten stehe ich hier, und schon empfinde ich es als grotesk, dass dieser Mann [¿] der Besitzer meines Bildes sein soll.« (S. 235) Auch sein fast zwanghafter Hang zu Korrekturen, Verbesserungen seiner Aussagen ist im negativen Sinne auffällig, sein »oder besser: [¿]« wird derart häufig bemüht, daß es schon eine unfreiwillige Komik bekommt. Einige Wortbilder, und sei es nur, daß Luis bei strömenden Regen sagt, er »werde aus Eimern begossen« (S. 278), sind so einfach nicht stimmig. Man kann zwar dem Kriminalelement um das gefälschte Gemälde zugute halten, daß es eine gewisse Dynamik in den sonst so schon von vornherein starren Roman bringt, aber es ist eben nicht alles. Reichlins lebensnahe Analysen der zerstörten Seelen sind scharf und treffend, aber es wirkt doch trotz allem zu ausgelutscht, von großmütterlichem Seelengeplauder durchzogen und vorhersehbar. Luis redet viel und gern und lauscht auch mit Vorliebe seinen eigenen Gedanken, aber er bewegt sich nicht. Streitgespräche mit seiner Lebensgefährtin ¿ als Analogie zu den Zankereien seiner Eltern ¿ sind überdramatisiert und kurzfristige Wandlungen seines Zustandes willkürlich gesetzt. »In einem anderen Leben« bleibt so ein Roman, der auf soliden Grundfesten steht, der sich eines heiklen Themas annimmt und es allgemeinverständlich und lebensnah aufarbeitet, aber dem auch der Feinschliff fehlt. Es ist der Roman eines Mannes, der versucht, die Probleme mit seinem Leben aufzuarbeiten, dabei aber von vornherein weiß, daß er festgefahren ist. Weder der Erwerb seines Bildes noch die Geburt seines Kindes können ihn vor dem Gespenst bewahren, das Du sein Leben geistert. Es bleibt ein zahnloser Roman, einer, der zu viel sagt, zu wütend abrechnet und um sich schlägt.









