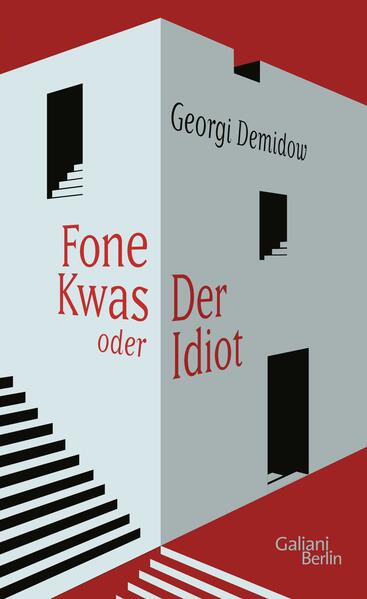
Zustellung: Sa, 26.04. - Di, 29.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Sie war beschlagnahmt, blieb verschwunden und wurde erst ein Jahrzehnt später wiederaufgespürt: eine unglaubliche Geschichte, eines Kafka oder Borges würdig, in der Realität und Wahnsinn auf immer neue Weise die Rollen tauschen.
Ein bedeutender Wissenschaftler wird in einer sowjet-ukrainischen Provinzstadt wegen Zugehörigkeit zu einer ihm unbekannten Organisation verhaftet. Ihm droht Folter, und er ahnt, dass er das nicht durchhalten wird. Er entwickelt die Idee, vor den NKWD-Offizieren den »Fone Kwas« (ein jiddischer Ausdruck für einen Narren oder »Trottel«) vorzutäuschen, wirre und unglaubliche »Geständnisse« zu machen - in der Hoffnung, schnell verurteilt zu werden, dann aber Berufung einzulegen und zu zeigen, dass alles, was er gestanden hat, technisch und wissenschaftlich vollkommen unhaltbar ist, so dass er schlussendlich wegen »irrtümlicher« Verhaftung entlassen werden wird.
Er setzt sein Vorhaben um. Er erzählt von sagenhaften Sabotageakten, malt wirre Diagramme. Je irrer und bizarrer seine Ausführungen werden, desto gebannter hört sein Ermittler zu und desto erfreuter zeigt er sich.
Und am Ende kommt alles ganz anders, als der Angeklagte erwartet hat. Die wahnsinnige Realität des stalinistischen Terrors wird die fabrizierten Phantasmen des »Fone Kwas« bei Weitem übertreffen.
Die Arbeit an der Übersetzung dieses Buches wurde freundlicherweise von der S. Fischer-Stiftung gefördert.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
02. November 2023
Sprache
deutsch
Auflage
5. Auflage
Seitenanzahl
196
Autor/Autorin
Georgi Demidow
Übersetzung
Irina Rastorgueva, Thomas Martin
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
s/w Autorenfoto
Gewicht
332 g
Größe (L/B/H)
206/129/25 mm
Sonstiges
Mit einem Dossier über Leben und Werk Demidows
ISBN
9783869712888
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Wiederentdeckt und publiziert erzählen seine Werke brillant und hellsichtig von der Ohnmacht des Einzelnen im Totalitarismus und weisen so weit über ihre Zeit hinaus Tilman Spreckelsen, FAZ
Dem Galiani-Verlag ist für diese Publikation sehr zu danken in Georgi Demidow ist ein hochinteressanter Autor zu entdecken man liest diesen Roman mit angehaltenem Atem Man sieht diesen Georgi Demidow, der sich mit seinen erfrorenen Fingern an seine Schreibmaschinen setzte, solange er sie noch hatte, um ihr ins Gesicht zu sehen, der, wie es an einer Stelle heißt, Amok laufenden Maschine der Gesetzlosigkeit und Willkür . Man stellt ihn sich als menschenfreundlichen Autor vor, der trotz allem, was er erlebte, an die Kraft der Literatur glaubte, solange es ging. Es ist, auch wenn sie sich nicht durchsetzen können, gut zu wissen, dass es solche Autoren gegeben hat und gibt. Dirk Knipphals, taz am Wochenende
Der Krieg, mit dem Russland seit zwei Jahren die Ukraine überzieht, hat seine Ursachen in derselben Geschichte. Nach der Lektüre von Demidows Buch begreift man besser, worum es im Kampf der Ukrainer letztlich geht und was auf dem Spiel steht. Götz Eisenberg, Der Freitag
Eine echte Entdeckung. Beklemmend, brisant - und sehr empfehlenswert. Christhard Läpple, 3sat Kulturzeit
Eine literarische Sensation. rbb radioeins
Eine Entdeckung zur rechten Zeit: Der russische Autor Georgi Demidow erzählt vom Kampf des Menschen gegen die Staatsmaschine Georgi Demidows Fone Kwas oder Der Idiot ist eine großartige Entdeckung. Sie kommt spät, aber im richtigen Moment. Ulrich Hufen, WDR 5 Bücher
Ein weiteres Werk, das von der Grausamkeit des Bolschewismus erzählt, ein weiterer Roman auf dem Stapel der Gulag-Literatur, könnte man denken. Doch mit Rafail, dem Narren , hat er einen unverwechselbaren, zutiefst menschlichen Helden geschaffen, den man kennen lernen sollte. Stephanie v. Oppen, Deutschlandfunk Kultur
Ein glühender, genialer Roman über die Grausamkeiten des Bolschewismus ( ) Ein zeitloses, wahrhaftes Dokument der Literatur über den echten und zeitlosen Schmerz der Menschen. Anna Prizkau, FAS
Dem Galiani-Verlag ist für diese Publikation sehr zu danken in Georgi Demidow ist ein hochinteressanter Autor zu entdecken man liest diesen Roman mit angehaltenem Atem Man sieht diesen Georgi Demidow, der sich mit seinen erfrorenen Fingern an seine Schreibmaschinen setzte, solange er sie noch hatte, um ihr ins Gesicht zu sehen, der, wie es an einer Stelle heißt, Amok laufenden Maschine der Gesetzlosigkeit und Willkür . Man stellt ihn sich als menschenfreundlichen Autor vor, der trotz allem, was er erlebte, an die Kraft der Literatur glaubte, solange es ging. Es ist, auch wenn sie sich nicht durchsetzen können, gut zu wissen, dass es solche Autoren gegeben hat und gibt. Dirk Knipphals, taz am Wochenende
Der Krieg, mit dem Russland seit zwei Jahren die Ukraine überzieht, hat seine Ursachen in derselben Geschichte. Nach der Lektüre von Demidows Buch begreift man besser, worum es im Kampf der Ukrainer letztlich geht und was auf dem Spiel steht. Götz Eisenberg, Der Freitag
Eine echte Entdeckung. Beklemmend, brisant - und sehr empfehlenswert. Christhard Läpple, 3sat Kulturzeit
Eine literarische Sensation. rbb radioeins
Eine Entdeckung zur rechten Zeit: Der russische Autor Georgi Demidow erzählt vom Kampf des Menschen gegen die Staatsmaschine Georgi Demidows Fone Kwas oder Der Idiot ist eine großartige Entdeckung. Sie kommt spät, aber im richtigen Moment. Ulrich Hufen, WDR 5 Bücher
Ein weiteres Werk, das von der Grausamkeit des Bolschewismus erzählt, ein weiterer Roman auf dem Stapel der Gulag-Literatur, könnte man denken. Doch mit Rafail, dem Narren , hat er einen unverwechselbaren, zutiefst menschlichen Helden geschaffen, den man kennen lernen sollte. Stephanie v. Oppen, Deutschlandfunk Kultur
Ein glühender, genialer Roman über die Grausamkeiten des Bolschewismus ( ) Ein zeitloses, wahrhaftes Dokument der Literatur über den echten und zeitlosen Schmerz der Menschen. Anna Prizkau, FAS
 Besprechung vom 15.10.2023
Besprechung vom 15.10.2023
Der Mann, der drei Mal starb
"Fone Kwas", Georgi Demidows glühender, genialer Roman über die Grausamkeiten des Bolschewismus, erscheint erstmals auf Deutsch.
Von Anna Prizkau
Sie töteten ihn zwei Mal. Zuerst im Winter 1938, als sie ihn holten. "Es war mein Tod als Physiker", sagte er seiner Tochter. Und 1980, an einem Sommertag, töteten sie ihn auch als Schriftsteller. Sie holten diesmal alle seine Manuskripte. Er hörte auf zu schreiben. Und 1987 starb er wirklich - im Glauben, dass alles, was er je geschrieben hat, vernichtet worden sei. Sein Name war Georgi Demidow. Die doppelte berufliche Auslöschung durch die Sowjets hat diesen Namen ganz vergessen lassen. Bis jetzt. Denn jetzt erscheint "Fone Kwas oder Der Idiot" - Demidows glühender, genialer, menschlicher Roman über die absurdesten Unmenschlichkeiten in Zeiten des Bolschewismus - zum ersten Mal auf Deutsch.
Eine Wohnung, ein Ehepaar, eine Nacht. Es klingelt an der Tür. So beginnt "Fone Kwas". Was dann passiert, kennt man aus der Geschichte, wenn man Sowjetgeschichte kennt, denn es ist 1937. Männer stürmen in die Wohnung. Demidows Held heißt Rafail, ist hoher Ingenieur, und er versteht, "dass es sich um diejenigen handelte, deren nächtliche Arbeit sich am Morgen durch leere Arbeitsplätze, verschlossene Büros und das verängstigte Flüstern von Kollegen offenbarte". Georgi Demidow braucht nur einen leisen, scharfen Satz, keine grausamen, großen Adjektive, um zu beschreiben, wie der Alltag im grausamen großen Terror Stalins geht.
Überhaupt die Sprache von Demidow! In "Fone Kwas" hört, riecht und fühlt man alles: Gedanken eines Wissenschaftlers, Schweiß, der aus der Kleidung, mit der sich Menschen abwischen, ausgewrungen wird, Gespräche von Verrücktgewordenen und immer wieder das Bellen der Apparatschiks. Klar, Rafail kommt ins Gefängnis. Kommt in die Zelle 22. Darin sind 23 Männer so eng zusammengestopft, dass keiner sitzen, keiner liegen kann - eine "Ansammlung von Körpern, Köpfen, Armen und Beinen auf dem Zellenboden". Rafail, der Ingenieur, gewohnt, "in präzisen Kategorien zu denken", weiß: "Höchstmöglicher Koeffizient an Stapelung erreicht."
Und jetzt beginnt der Bildungsroman von Georgi Demidow. Beginnt die Bildung seines klugen, dummen Helden Rafail, der in der Nacht, als sie ihn holten, noch geglaubt hat: Der NKWD irrt sich nie. Ja, am Anfang hofft er noch auf ein "Versehen". Deshalb kommt sofort auch die "Sonnenfinsternis" von Arthur Koestler in den Kopf - und die kopflose Wahrheit darüber, dass es in den Sowjetverfahren niemals um Schuld und Unschuld ging, dass sie fiktive, wertlose Begriffe waren. Naiver, armer Rafail!
Wie ein Kleinkind, das Sprechen lernt, muss er jetzt das Gefängnisleben lernen. Und dessen Regeln sind klar und kompliziert zugleich. Zuerst muss Rafail verstehen, dass es eine Rangordnung in der Zelle gibt: Am Kübel für die Exkremente wohnen die Neuen. Je weiter weg vom Kübel einer ist, desto voller ist dessen Bart, brauner das Hemd, zerschlagener das Gesicht - desto länger sitzt er ein. Die, die hinten leben, genauer: immer noch am Leben sind, haben verlernt zu stehen, denn ihre Muskeln sind zu schwach geworden, auch das weiß Rafail nach nur drei Tagen Zelle auswendig, als wäre es ein Gedicht. Das Wichtigste, was er erfahren und begreifen wird, sind "die Methoden der Ermittlungen in konterrevolutionären Fällen". Diese Methoden - also Folter - zählt Demidow dann technisch nüchtern auf. Deshalb wird sein gewaltiger Roman niemals zum Gewaltporno. Und deshalb tut es während des Lesens auch so weh.
Warum man trotzdem weiterliest? Nein, nicht weil man masochistisch ist. Und nein, auch nicht weil Demidow in "Fone Kwas" erzählt, wie bestialisch Russen waren, also noch immer sind. Ja, wegen des neuen Kriegs der Russen gegen die Ukraine wird dieses Deutungsschicksal sehr wahrscheinlich zum Schicksal dieses alten Buches werden müssen. Wahrscheinlich auch, weil Demidows Familie, als er fünf Jahre alt war, in die Ukraine zog. Demidow lebte später im Donbass, danach in Charkiw. Trotzdem: Der Stempel "Aktuell, weil Ukrainekrieg" wäre ein großer Fehler, eine große Fälschung. Denn "Fone Kwas" ist ein zeitloses, wahrhaftes Dokument der Literatur über den echten und zeitlosen Schmerz der Menschen; der Menschen in der Zelle, die mit dem Ingenieur einsitzen und zu Freunden werden.
Da ist der liebenswerte alte armenische Arzt Chatschaturow, der sich von einem Mitgefangenen alles über Armenien erzählen lässt, weil er es überhaupt nicht kennt. Da ist der guterzogene, charmante Staatsanwalt Berman, der früher immer wieder Blanko-Haftbefehle unterschrieb - und so vielleicht auch den für sich selbst. Da ist ein gut gelaunter Tierarzt, er wird beschuldigt, Schafböcke umgebracht zu haben, obwohl es im Betrieb, in dem er angestellt war, nie Schafböcke gegeben hat. Später erzählt er in der Zelle vom Verhör und vom debilen Ermittler, dem er erst widersprechen wollte: "... da dachte ich: Warum? Warum sollte ich mich um den Wahrheitsgehalt meiner Lügen kümmern? (...) Je mehr Unsinn und Ungereimtheiten in meiner Aussage stehen, desto besser!"
Und genau diese Story bringt Rafail auf eine raffinierte, vielleicht auch lebensrettende Idee. Er will - im Angesicht dieser Ermittlung gegen ihn - das ganze NKWD-Drama und seine Apparat-Akteure in einen "Fone Kwas" verwandeln. Was der Begriff bedeutet, erklärt Demidow zu Beginn seiner Geschichte, als es um Rafails Vater Lew geht: Der alte Mann wollte sein Leben lang reich werden. "Wenn es ihm gelang oder zu gelingen schien, einen Geschäftspartner, in der Regel einen Nichtjuden, zu täuschen, empfand Lew Moisejewitsch nicht nur keine Gewissensbisse, sondern war sogar recht zufrieden mit sich selbst." Die Leute, die Lew betrog, nannte er auf Jiddisch "Fone Kwas", das hieß: einfältiger Mensch oder Idiot.
Rafail will jetzt also die Lügner selbst belügen. Er denkt sich angebliche Sabotageaktionen aus, die er gestehen wird, die, wenn man nur ein wenig was von Strom, Elektrizität und von Physik versteht, ein großer Witz sind. Rafail lächelt, als er sich dabei das Lachen "des zukünftigen Sachverständigen vorstellte, sobald der die ersten Zeilen seines Geständnisses gelesen hätte". Der Ingenieur hofft darauf, dass spätestens dann der Irrtum seiner Verhaftung aufgedeckt sein wird.
Warum Rafail überhaupt etwas Erlogenes gestehen will? Er muss. Das hat er auch gelernt. Am Ende gesteht jeder. Die Mitgefangenen erzählen alles, was gewünscht wird. Damit die Folter aufhört. Damit sie in den Gulag kommen. Denn in der Zelle, in der es keine Luft gibt, kaum Essen, keine Möglichkeit sich zu bewegen, in dieser Zelle gilt der Gulag als "das gelobte Land".
Georgi Demidow war selbst in diesem Land, war an der Kolyma, war 14 Jahre lang dort. Er hätte eigentlich sterben müssen, doch auf der unglücklichen, großen Welt gibt es manchmal - sehr selten - kleines Glück: Der Physiker lag also schon im Sterben, kam ins Spital des Lagers, wo man erkannte, was er konnte. Demidow - Schüler des Nobelpreisträgers für Physik, Lew Landau - baute fürs Gulag-Krankenhaus einen Röntgenapparat und durfte deshalb als Assistent arbeiten - und das bedeutete: am Leben bleiben. Er lernte dort den später weltberühmten Schriftsteller Warlam Schalamow kennen.
Schalamow machte wiederum Demidow weltberühmt, doch unter anderen Namen, in den "Erzählungen aus Kolyma". Demidow wurde zum Vorbild der fiktiven Helden von Schalamow, zum Beispiel in "Die Vita des Ingenieurs Kiprejew", der Story über einen Häftling, der im Gulag eine Reparaturstelle für Glühbirnen einrichtet und so das Lagerleben leuchtend macht. Das hatte auch der echte Demidow getan.
Aber zurück zum falschen Helden Rafail in seinem Buch. Er wartet immer noch auf das Verhör. Hat seinen großen "Fone Kwas"-Plan. Muss aber erst einmal erraten, welcher staatsfeindlichen Organisation er selbst angeblich angehört. Denn sie sind auch Erfindungen, NKWD-Erfindungen. "Wie ist das möglich (...), wenn man nicht einmal weiß, welche Organisationen es gibt?", fragt Rafail einen alten, weisen Mitinsassen. "Genau das ist gar nicht so schwer. Alle vom NKWD erfundenen geheimen Organisationen haben keine eigenen Namen", erklärt er, es reiche, wenigstens ein bekanntes Adjektiv zu sagen, "sabotierend, nationalistisch, aufständisch, trotzkistisch-bucharinistisch und so weiter".
Der Ingenieur versteht. Kennt jetzt das Vokabular des Schreckens. Muss nur noch das perfekte Maß für seine fiktiven Verbrechen finden. Er weiß, dass ein Geständnis, wenn es zu umfangreich, zu groß ist, auch zur Erschießung führen kann. Doch Rafail ist vorbereitet. Und die Verhöre fangen an. Wie diese enden, das muss jeder selbst lesen und selbst fühlen. Und ja, man fühlt tatsächlich alles, was in "Fone Kwas" passiert, in diesem großen, schmalen Roman eines Schriftstellers, der zu Lebzeiten nie Schriftsteller werden konnte. Er hat nach seiner Freilassung, nach so vielen Jahren Lager, nur für sich selbst und für den Samisdat geschrieben. Aber sein Schreiben sprach sich herum: Ein General aus Moskau kam. Demidow habe schon Talent, sagte der General, aber er solle lieber über andere Sachen schreiben - die Arbeiterklasse beispielsweise. Georgi Demidow antwortete, dass er über das schreiben werde, worüber er schreiben wolle - und nicht worüber er schreiben dürfe.
Danach und deshalb kam der KGB. An einem Augusttag 1980. Sie nahmen alles mit, was Demidow jemals geschrieben hatte, nahmen auch seine Schreibmaschinen mit. Sie wussten, dass er mit seinen Fingern - nach Jahren an der Kolyma verfroren und verkrüppelt - keinen Stift mehr halten konnte. Demidow war am Ende. Hörte für immer auf zu schreiben. Starb.
Doch seine Tochter kämpfte nach dem Tod des Vaters um dessen Manuskripte. Sie wurden nicht vernichtet. Sie erhielt sie 1989. Und 1990 wurde Demidow zum ersten Mal veröffentlicht. 2010 erschien ein Dokumentarfilm über ihn. Am Ende sieht man seine Tochter - da ist sie eher Großmutter als Tochter - in einer kleinen Buchhandlung. Sie schaut durch die Regale. Sieht dann zwei Bücher ihres Vaters. Greift sie. Sagt: "Papa, wenn du mich hörst: Wir haben es geschafft." In dem Moment möchte man sie umarmen und gleich danach die Welt - das üble, graue Dasein, in dem Menschen Unmenschliches erfahren mussten, erfahren und erfahren werden, in dem das Glück nur die Ausnahme ist. Aber am Tag, an dem man "Fone Kwas" liest - leider liest man das Buch tatsächlich nur an einem Tag -, ist es doch da: greifbares, großes Glück. Und dieser eine Tag beweist, dass die Literatur das Böse doch besiegen kann. Ja, Georgi Demidow hat es geschafft. Er lebt. Obwohl man ihn zweimal getötet hat.
Georgi Demidow: "Fone Kwas oder Der Idiot". Aus dem Russischen von Irina Rastorgueva und Thomas Martin. Erscheint am 2. November bei Galiani (208 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








