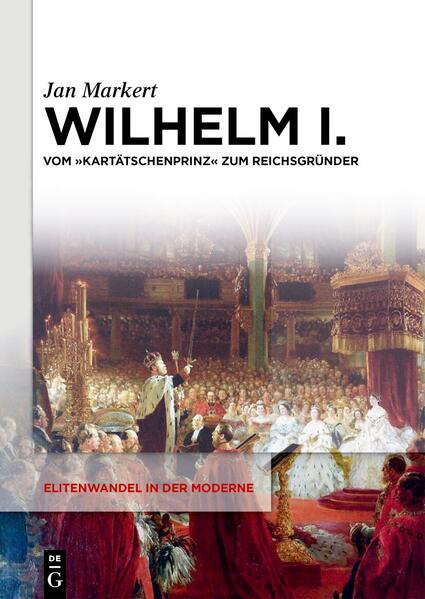
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Wie diese erste wissenschaftliche Biographie Wilhelms I. detailliert rekonstruiert, muss die preußisch-deutsche Politikgeschichte des 19. Jahrhunderts in großen Teilen revidiert werden. Unter Verwendung des umfangreichen, der Forschung bislang unbekannten archivalischen Nachlasses des ersten Deutschen Kaisers und seiner Umgebung bettet diese Studie Leben und Zeit Wilhelms I. in einen europäischen Vergleichskontext ein und gibt neue Antworten auf die Fragen, welche politische Rolle er als Thronfolger und Herrscher am Berliner Hof spielte und welchen Einfluss er auf die Entwicklung der Hohenzollernmonarchie zwischen Vormärz und Reichsgründung ausübte. In der Person Wilhelms I. spiegelt sich beispielhaft die ambivalente Multifunktionalität der Monarchie als institutioneller Motor, aber auch als Hemmfaktor der politischen Modernisierung wider. Während des Vormärz trug er in der Rolle des "Kartätschenprinzen" maßgeblich dazu bei, das preußische Königtum in die Krise der Revolutionen von 1848/49 zu stürzen. Doch in den Folgejahren forcierte er die Nationalisierung von Thron und Staat und führte Preußen auf den Weg ins deutsche Kaiserreich. Letztendlich muss Wilhelm I. die politische Direktive der Reichsgründung zugeschrieben werden.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
02. Dezember 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
XII
Reihe
Elitenwandel in der Moderne / Elites and Modernity
Autor/Autorin
Jan Markert
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1402 g
Größe (L/B/H)
242/176/46 mm
ISBN
9783111323589
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Markerts Forschung darf man getrost als bahnbrechend bezeichnen, denn sie revidiert - wenn sie denn einer Überprüfung standhält - einen der letzten Mythen, die sich aus der alten Geschichtswissenschaft von vor 1945 in die gegenwärtige hinübergerettet haben." Konstantin Johannes Sakkas in: Frankfurter Rundschau, 26. 03. 2025
 Besprechung vom 14.03.2025
Besprechung vom 14.03.2025
Korrekturen am Bild des Patriarchen
Bismarck-Mythos gegen Kaiser-Kult: Drei Neuerscheinungen bemühen sich auf verschiedene Weise, Wilhelm I. aus dem Schatten seines Reichskanzlers zu holen.
Das Lied stammt aus dem Kaiserreich: "Wir wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben! Aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart." Gesungen wurde es auf die Melodie des "Fehrbelliner Reitermarsches"; der Text entstand um 1900 und war zunächst, unschwer zu erkennen, gegen Wilhelm II. gerichtet. Nach 1918, nach Revolution und dem Ende der Monarchie, wuchs seine Popularität mit der Sehnsucht nach besseren Zeiten, der Beschwörung einer vermeintlich guten alten Zeit. Für diese freilich stand wiederum nicht Wilhelm II., der aus seinem Exil gegen Republik und Demokratie agitierte, sondern sein Großvater, dessen Bild bis heute auch in der Geschichtsschreibung klar bestimmt ist. In etwa so, wie Christopher Clark ihn beschrieben hat: "Wilhelm I. war ein ehrbarer und weithin bewunderter Mensch, eine Figur mit der Gravitas und dem Bart eines biblischen Patriarchen." Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr.
Wird dieses Bild der historischen Bedeutung des ersten Hohenzollern-Kaisers gerecht? Drei nahezu gleichzeitig erschienene Studien nähren Zweifel daran, stellen vor allem die politische und - früh schon - historiographische Dominanz Bismarcks infrage. Bismarck gilt als der "Reichsgründer", bis in die Schulbücher ist das 1871 proklamierte Kaiserreich das "Bismarck-Reich", und auch die "Ära Bismarck" ist ein etablierter Begriff. Gegen solchen "Bismarckzentrismus" wendet sich jetzt der Historiker Jan Markert. Biographisch und traditionell politikgeschichtlich verfolgt sein Buch die Absicht, den "Mythos vom Kanzler als Reichsgründer" zu dekonstruieren und Wilhelm I. aus dem Schatten Bismarcks treten zu lassen. Die in ihrer - gekürzten - Druckfassung noch immer fast achthundert Seiten starke, quellensatte Dissertation hat kein geringeres Ziel, als das Urteil über eine der am gründlichsten untersuchten Epochen der deutschen Geschichte nicht nur neu zu akzentuieren, sondern über weite Strecken grundlegend zu revidieren.
Der Autor unternimmt das für die Zeit zwischen der Revolution von 1848, als der spätere König und Kaiser als "Kartätschenprinz" die politische Bühne betrat, bis ins Jahr 1866, als sich nach dem Krieg zwischen Preußen und Österreich der Weg zu einer von Berlin aus orchestrierten kleindeutschen Nationalstaatsbildung abzeichnete. Die Reichsgründung selbst und das Kaiserreich, dessen Krone Wilhelm I. bis 1888 trug, sind gar nicht Gegenstand der Untersuchung.
Es sei nicht leicht, unter Bismarck Kaiser zu sein. Das Wilhelm I. zugeschriebene und von dem Reichstagsabgeordneten Ludwig Bamberger in den 1890er-Jahren kolportierte Diktum steht für den Beginn der posthumen Dominanz Bismarcks über seinen König und Kaiser. Diese Dominanz entwickelte sich aus einer Konkurrenz der Bismarck- und Kaiser-Wilhelm-Mythen, die unmittelbar nach dem Tod des Monarchen und nach Bismarcks Entlassung begann. In ganzen Serien von Denkmälern spiegelte sie sich, erst recht nach Bismarcks Tod 1898.
Hinter dem Wilhelm-Mythos stand nicht zuletzt Wilhelm II., der nur zu genau wusste, dass der Bismarck-Mythos und die Heroisierung des Kanzlers stets eine kritische Wendung gegen ihn selbst hatten. Der junge Kaiser versuchte dem zu begegnen, bis hin zu der nicht sonderlich erfolgreichen Idee, seinen Großvater als Wilhelm den Großen in der öffentlichen Erinnerung zu verankern. Das zeigt der niederländische Historiker Frederik Sterkenburgh, der in seinem Buch die Inszenierung Wilhelms I. als Kaiser untersucht. Kulturalistisch inspiriert, ist es nicht minder politikhistorisch, weil es die Inszenierung des Monarchen und die Repräsentation der Monarchie als genuin politisch und machtbezogen versteht.
Hoch politisch war auch der Bismarck-Mythos. Dieser ging zunächst vor allem auf Bismarck selbst zurück, der nach seinem Sturz 1890 im Sachsenwald an ihm arbeitete, nicht zuletzt in seinen "Gedanken und Erinnerungen". Das verband sich rasch mit der gerade in konservativen, nationalen Kreisen wachsenden Kritik an Wilhelm II., dem aber nicht sein Großvater entgegengestellt wurde, sondern das politische Genie Bismarck als eine Art "Anti-Wilhelm II.". Dazu gehörte die Verklärung des angeblichen "Reichseinigers" in einer zunehmend gespaltenen, fragmentierten, zerklüfteten Gesellschaft - bis hin zu der Vorstellung, ja dem Bestreben nach einem neuen Reichseinigungskrieg, einer neuen Reichsgründung.
Mitten in diesem neuen Reichseinigungskrieg - der Burgfrieden hielt freilich nicht lange - schrieb der Historiker Erich Marcks sein bis in die 1940er-Jahre immer wieder aufgelegtes, enorm populäres "Lebensbild Bismarcks". "Deutschland will heute von Bismarck hören", so lautete der erste Satz. Für Wilhelm I. war da wenig Platz, auch nicht in der Weimarer Republik und auch nicht im Nationalsozialismus, für den der Monarchismus allenfalls - und gut bedient vom letzten Kaiser und seinem Sohn - eine instrumentelle Funktion hatte. 1933 jedenfalls am "Tag von Potsdam" stellte sich Hitler in eine Reihe, die von Friedrich dem Großen über Bismarck - nicht Wilhelm I. oder gar Wilhelm II. - zu ihm selbst führte.
Genau das war der Kern des "Bismarck-Problems", an dem sich deutsche Historiker nach 1945 abarbeiteten. Und noch in der Auseinandersetzung - und durch die Auseinandersetzung - mit diesem Problem behielt Bismarck seine dominierende Position. Ihm wurden die großen Biographien gewidmet, nicht Wilhelm I. Und wichtiger noch: Die Quellen, auf denen die großen Bismarck-Biographien ruhten, waren ganz überwiegend Bismarck-Quellen, direkt oder indirekt auf Bismarck selbst zurückgehend, und von der Absicht geleitet, Bismarck gerade als Reichsgründer in hellem Glanz erstrahlen zu lassen und Wilhelm in seinen Schatten zu stellen.
Auch am Bild der Kaiserin Augusta wirkte Bismarck kräftigt mit. Bis heute wird es reduziert auf die angebliche Rolle der Königin-Kaiserin als politische Widersacherin Bismarcks. Dieses Bild korrigiert und differenziert jetzt Susanne Bauer, die - erstmals - die gesamte Briefkommunikation Augustas, rund 22.000 Briefe, analysiert hat. Sie zeigt aber auch, wie Augusta nicht zuletzt aus dem engsten Umfeld Bismarcks kontinuierlich massiv angegriffen und diskreditiert wurde. Von "Gefühlspolitik" war ebenso die Rede wie - böse und misogyn - von "Politik im Unterrock". Aber die Angriffe, auch öffentlich, bestätigten letztlich nur das politische Gewicht der Kaiserin, die allein dadurch die Geschlechterordnung des Kaiserreichs herausforderte.
"Bismarckquellen erzählen Bismarckgeschichten", betont Jan Markert zu Recht, sie marginalisierten den Monarchen. Das demonstriert er an verschiedenen Beispielen, bis hin zu der berühmten Septemberkrise 1862, dem Höhepunkt des preußischen Verfassungskonflikts, als Bismarck zum Ministerpräsidenten ernannt wurde und sogleich, so die etablierte Lesart, das Heft des Handelns in die Hand nahm. So erzählen es die Bismarck-Biographen von Lothar Gall über Ernst Engelberg und Otto Pflanze bis hin zu Christoph Nonn, von denen keiner den umfangreichen archivalischen Nachlass Wilhelms ausgewertet hat, um womöglich das Bismarck-Narrativ zu überprüfen, das so immer wieder fortgeschrieben und nicht mehr hinterfragt wurde.
Die Gefahr freilich, der Jan Markert nicht ganz entgeht, ist die, nunmehr das Kind mit dem Bade auszuschütten und an die Stelle eines übermächtigen Bismarck einen übermächtigen Wilhelm zu setzen, für dessen politisches Handeln er sogar den ursprünglich auf Wilhelm II. gemünzten Begriff des "persönlichen Regiments" verwendet. Mit diesem überschießenden Revisionismus schadet Markert seinem Anliegen, dem in die Geschichtsschreibung eingegangenen Bismarck-Mythos zu begegnen. Denn natürlich erzählen Wilhelmquellen Wilhelmgeschichten, und es führt kaum weiter, nun die einen gegen die anderen auszuspielen, statt die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzuführen.
Das auf den September 1862 zurückgehende Verhältnis in der Machtausübung der beiden Protagonisten war komplex; es ging aber in einer Konstellation von Über- und Unterordnung nicht auf, sondern war immer wieder - und weit über 1870 hinaus - von einer weitgehenden Übereinstimmung charakterisiert. Sonst wäre Bismarck nicht Ministerpräsident geworden - und geblieben. Man brauchte einander. Und nicht zuletzt die Furcht vor der Revolution und das Bestreben, ein neues 1848 zu verhindern, wirk te verbindend. Da ist Markert dann doch näher an der bisherigen Forschung, als er zuweilen den Eindruck erweckt. Denn am Ende bleibt die Frage: Wenn wir jetzt einen Bismarck-Zentrismus durch einen Wilhelm-Zentrismus ersetzen - was bedeutet das für unser Urteil über das Kaiserreich in der Geschichte des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts? Vermutlich nicht viel. Den Erkenntniswert aller drei Bücher schmälert das keineswegs. ECKART CONZE
Jan Markert: "Wilhelm I." Vom "Kartätschenprinz" zum Reichsgründer.
De Gruyter Verlag,
Berlin/Boston 2025. 768 S., geb., 49,95 Euro.
Frederik Frank Sterkenburgh: "Wilhelm I as German Emperor". Staging the Kaiser.
Palgrave Macmillan, Basingstoke 2024. 357 S., geb., 149,79 Euro.
Susanne Bauer: "Die Briefkommunikation der Kaiserin Augusta (1811- 1890)". Briefpraxis, Briefnetzwerk, Handlungsspielräume.
Duncker & Humblot, Berlin 2024.
448 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Wilhelm I." und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









