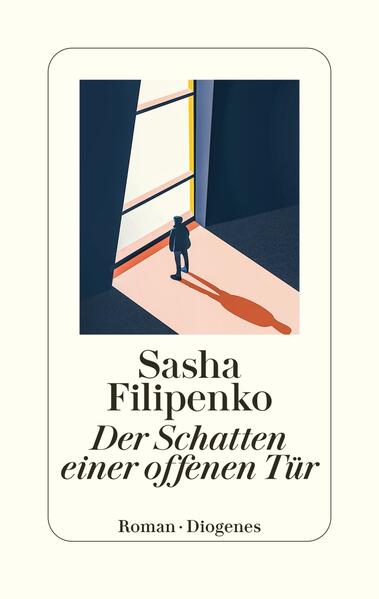
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die gottverlassene Provinzstadt Ostrog wird von einer Suizidserie von Jugendlichen im Waisenhaus erschüttert. Kommissar Alexander Koslow aus Moskau soll die Ermittlungen in die Hand nehmen, doch die örtliche Polizei hat ihre eigenen Theorien. Als Petja, ein Sonderling mit einem Herz für die Natur, verhaftet wird, glaubt Koslow nicht an dessen Schuld. Aber warum geriet Petja damals derart außer sich, als der Bürgermeister von Ostrog den Heimkindern einen Griechenland-Urlaub spendieren wollte?
Produktdetails
Erscheinungsdatum
25. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
272
Autor/Autorin
Sasha Filipenko
Übersetzung
Ruth Altenhofer
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
russisch
Produktart
gebunden
Gewicht
292 g
Größe (L/B/H)
188/124/25 mm
ISBN
9783257071597
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»In seinem neuen Roman zeichnet er ein von pechschwarz-galligem Humor grundiertes Bild der russischen Gegenwart. « NDR Kultur, NDR Kultur
»Sasha Filipenkos fulminanter Thriller Der Schatten einer offenen Tu r blickt in die Abgru nde der russischen Justiz. « News, News
»Sasha Filipenkos fulminanter Thriller Der Schatten einer offenen Tu r blickt in die Abgru nde der russischen Justiz. « News, News
 Besprechung vom 12.10.2024
Besprechung vom 12.10.2024
Wer sich nicht helfen kann, hilft jemand anderem
Sasha Filipenkos Roman "Der Schatten einer offenen Tür" erklärt, warum man erst Glück erfahren muss, um in Verzweiflung zu stürzen.
Von Kerstin Holm
Von Kerstin Holm
Wer in Gefangenschaft aufwächst, dem wird diese oft erst, wenn er mit der Möglichkeit von Freiheit oder Glück in Berührung gekommen ist, unerträglich. Der im Schweizer Exil lebende belarussische Schriftsteller Sasha Filipenko, der viel auf Russisch und über Russland schreibt, hat bei Diogenes die deutsche Übersetzung eines Romans herausgebracht, der im Pandemiejahr 2020 in Moskau im Original erschienen war und als sozial abgründiger Krimi schon damals viel Leserzuspruch fand. Das Buch spielt in einem fiktiven trostlosen nordrussischen Städtchen mit dem sprechenden Namen Ostrog (zu Deutsch Gefängnis oder Bollwerk), wo drei Zöglinge des örtlichen Kinderheims sich das Leben genommen haben. "Der Schatten einer offenen Tür", so der deutsche Titel, versetzt in ein hartes Provinzmilieu, wo man als Polizist, Gefängniswärter oder Heimleiter Karriere macht und sich gegenüber beneideten Abgesandten der Hauptstadt Moskau als Stütze staatlicher Ordnung aufspielt. Weil Filipenko dabei die Überlebenswichtigkeit von Phantasie, Liebe und Kulturverbindungen subtil vor Augen führt, liest sich der von Ruth Althofer nuancenreich übersetzte Text heute, da Russland von seinen Bewohnern aggressive Unterwürfigkeit verlangt und seine Türen zu Europa zumauert, auch als diagnostische Parabel.
Ein Leitmotiv und wichtiger Schreibimpuls für Filipenko ist die Knappheit der Ressource Humanität. Aus dem Kinderheim werden immer wieder Waisen von Pflegeeltern abgeholt, doch überfordert wie diese sind, bringen sie sie auch oft zurück - laut einer Statistik, die er eine Reporterin zitieren lässt, passiert das in Russland dreizehnmal am Tag. Im Roman erleidet Filipenkos gottesnarrengleicher Held Petja Pawlow, der mit seiner radikal-ethischen Achtsamkeit und obsessiven Naturfürsorge für die vernarbten Seelen seiner Mitmenschen eine Zumutung darstellt, dieses Schicksal gleich zweimal. Der ahnungsvolle Pawlow protestiert auch als Einziger gegen das Vorhaben des zum Kleinoligarchen aufgestiegenen Ex-Häftlings Baumann, die Heimkinder zum Strandurlaub nach Griechenland zu verfrachten.
Nach der Rückkehr wählen einige der Heimkinder den letzten Weg der Verzweiflung, was eine Dumaabgeordnete im Fernsehen auf "Provokationen" zurückführt, da Russlands Waisen, wie sie behauptet, unter idealen Bedingungen lebten. Ein Schuldiger muss her. Also schickt Moskau einen kundigen und zugleich literarisch versierten Kriminalinspektor, der für Verbrechen gern einen Prototyp in der griechischen Mythologie findet und seine Erfahrung im Tschetschenienkrieg mit der Odyssee vergleicht (höchst homerisch teilt Filipenko sein mit Liedtexten durchsetztes Prosawerk auch in 24 "Gesänge"). Doch dem Fahnder kam, da seine Frau, eine Richterin, einen schöngeistigeren Anwalt liebgewann, seine Penelope abhanden, weshalb ihm selbst Suizidgedanken wohlvertraut sind. Dass er sich physisch nach seiner Ex verzehrt, macht ihn zur Wunschbeute einer ambitionierten Reporterin, die auf das Erregungspotential der Story setzt.
Russlands Justiz verlangt, dass jemand bestraft wird, was häufig die Schutzlosesten trifft. Der Revierpolizist hat hier schon vorgearbeitet und die Waisenhauspädagogen malträtiert. Die auch dank Sponsorengeld aufgetakelte, vom Polizeichef gedeckte Heimleiterin lenkt den Verdacht auf die Waisen, die sie als übergriffige Schmarotzer hinstellt. Sie bringt den Polizisten dazu, den ihn schon lange nervenden Petja Pawlow als Sündenbock einzusetzen, wozu er genetisches Material von ihm bei den Toten pflanzen und "finden" lässt und aus dem Unglücklichen ein Geständnis herausprügelt.
In kurzen Szenen zwischen Zeiten und Figurenperspektiven springend, zieht Filipenko den Leser in die Intrige hinein. Er malt das Sittenbild einer von Repression und Korruption zusammengehaltenen Provinzgesellschaft, die sich gegen forschende Blicke aus der beneideten Zentrale nach Möglichkeit abschirmt. Wie Heiminsassen, die keine Stimme haben, von ihren Betreuern durchs Abzweigen staatlicher oder privater Unterhaltszahlungen bewirtschaftet werden, ist ein besonders horrendes Kapitel unter den Missständen in Russland. Der Roman spielt in den Jahren nach der Krimannexion, als die Zivilwirtschaft noch brummte und eine unabhängige Berichterstattung möglich war. Seither dürfte die Situation nur schlimmer geworden sein.
So ist der Moskauer Inspektor, der sich für die Protestpoesie der inzwischen emigrierten Vera Poloskowa begeistert, kaum überrascht, als ihm eine schwangere Waise berichtet, die Heiminsassen redeten ständig von Selbstmordabsichten, Selbstverletzungen seien ebenso tägliche Routine wie Abtreibungen. Der Heimleitung weiß das, ist aber keineswegs alarmiert, sondern beschimpft die hartgesottenen Zöglinge deswegen nur.
Denn bevor sie mit ihrem Leben abschließen, müssen Jugendliche ja erst in der Seele getroffen werden. Das geschieht, als der vorbestrafte Geschäftsmann den Kindern ein Griechenlanderlebnis beschert - mit Flugreise über fremde Länder, köstlicher Verpflegung, vor allem aber ständigem Blick aufs Meer (das Postskriptum hält die Ergriffenheit der jungen Russen fest). Schockartig erfahren die Waisen das Glück, von dem sie fortan in Ostrog träumen - und die Einsicht, dass sie künftig davon abgeschnitten bleiben, weil ihr Sponsor im Gefängnis sitzt, bricht einigen das Herz. Da es der Moskauer Inspektor war, der Baumann kriminelle Machenschaften nachwies, erweist er sich, ohne Wissen und Absicht wie in der griechischen Tragödie, an der Selbstmordserie als mitschuldig.
Filipenko schickt seinen Polizeifahnder, der durch Nachdenklichkeit, Liebesfähigkeit und materielle Bescheidenheit ein Sympathieträger ist, zudem gleichsam als Inspektor der russischen Intelligenzia zum misshandelten "Volk". Der Held entlarvt die Machenschaften in Ostrog, beklagt gegenüber seinem Chef auch die Zwangsbehandlung aufsässiger Heimkinder mit dem sedierenden Sowjetmedikament Aminasin, die viele dauerhaft zu Psychiatriehäftlingen macht. Es trifft ihn sogar wie eine Offenbarung, als der vom Stadtpolizisten zusammengeschlagene Pawlow ihm enigmatisch rät: "Wenn du dir nicht helfen kannst, hilf einem anderen!" Doch als ihm bei seiner Abreise die schwangere Waise auflauert und verlangt, sie - um ihres Kindes willen - nach Moskau mitzunehmen, will er von solcher Zumutung nichts wissen.
Sasha Filipenko: "Der Schatten einer offenen Tür". Roman.
Diogenes Verlag, Zürich 2024. 270 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 27.03.2025
Poetischer Schreibstil mit berührendem Inhalt.
LovelyBooks-Bewertung am 09.01.2025
Mein erster Roman des Autors - übersetzt von Ruth Altenhofer. Sprachlich war es eine Wonne, die Story (meiner Meinung nach) etwas mau, wenn auch im Grundgedanken sehr interessant.In der öden Gefängnisstadt Ostrog kommt es zu einer Suizid-Reihe unter Waisenkindern. Der vom Leben enttäuschte Kommissar Alexander Koslow aus Moskau soll nun den Fall untersuchen, da der örtliche Revierinspektor nicht weiterkommt.Gemeinsam mit dem hippen Leutnant der Ermittlungsbehörde, Fortow, macht er sich also in die Provinzstadt auf, in der er vor Jahren bereits den Bürgermeister - einen ehemaligen Häftling des ortsansässigen Gefängnis - entmachtet und hinter Gitter gebracht hat (warum, wird nie klar). Augenscheinlich ein Krimi, in dem etwas aufgeklärt werden soll; doch eher ein Portrait der russischen Gesellschaft. Koslow wird geschickt, um im Sinne Moskaus Klarheit in die Sache zu bringen - und deckt Missstände im Waisenhaus auf, die der Gesellschaft ein Spiegelbild vorhalten; unliebsame Personen werden kategorisiert und weggesperrt. Ab und zu bekommen sie einige Vorteile zu spüren, im Großen und Ganzen ist ihr Leben allerdings eingeschränkt und vorbestimmt.Um einen Schuldigen zu finden, schreckt der Revierinspektor nicht vor Beweismanipulation und (sehr heftiger!) Folter zurück; doch Koslow erkennt die Wahrheit - und in der Folge kommt es gleichzeitig zu Umbrüchen in seinem Leben und den Zuständen der Waisenkinder; man fragt sich nur, für wie lange - denn das, was dort geschieht, sieht letztlich nach Aktionismus aus, der auch schnell wieder abebben kann.Wie gesagt, sprachlich hervorragend und von der Grundidee gut; und trotzdem bin ich nicht überzeugt. Koslow ist recht gut gezeichnet, jedoch belastet mit Problemen, auf welche er nicht immer logisch (wenn vielleicht auch menschlich) reagiert. Warum er jedoch - nach Landung bei Ostrog - zunächst die Flughafentoilette aufsucht, um zu ornanierrn, das erschließt sich mir nicht wirklich.Alle anderen Figuren, insbesondere Fortow, sind sehr dünn gezeichnet, was die Geschichte irgendwie stört, ja unterbricht. Eine löbliche Ausnahme ist da das ehemalige Waisenkind Petja, der Sündenbock des Revierinspektor und mein eigentlicher (tragischer) Held der Geschichte.Ich war nicht gelangweilt aber auch nicht sehr gespannt - sprachlich gesehen war das Buch angenehm zu lesen und hatte einige sehr interessante Ansatzpunkte. Einer meiner Lieblingszitate:"Dass er mit fünf Jahren Eiszapfen von draußen hereingebracht und die Erzieher gebeten hatte, sie in den Gefrierschrank zu legen, um ihnen das Leben zu retten."Von meiner Seite aus 3/5 Sterne und sicher für jeden etwas, der keinen herkömmlichen Krimi, sondern eher eine Gesellschaftskritik lesen mag; und dabei über ein paar "Störer" hinwegsehen kann.









