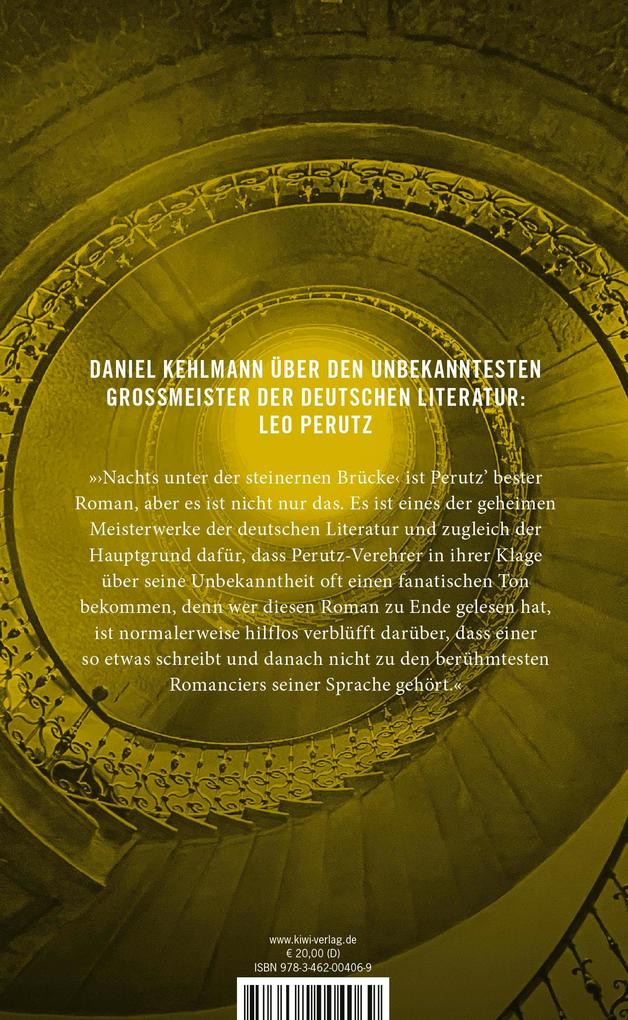Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Es ist eine unglaubliche Entdeckungsreise. Daniel Kehlmann, Autor des Weltbestsellers »Die Vermessung der Welt« und des historischen Zauberromans »Tyll«, führt uns tief hinein in das Werk des unbekanntesten Großmeisters der deutschen Literatur: Leo Perutz.
Voller Verehrung, Begeisterung und mit tiefer Kenntnis stellt uns Kehlmann die Bücher jenes Mannes vor, der 1882 in Prag zur Welt kam, in Wien studierte, in Kaffeehäusern schrieb und in derselben Versicherungsanstalt wie Franz Kafka sein Brot verdiente. Leo Perutz war ein bedeutender Vertreter sowohl der großen osteuropäisch-jüdischen Erzähltradition als auch der Wiener Moderne. Sein Meisterwerk ist der Roman »Nachts unter der steinernen Brücke«.
Kehlmann beschreibt eindrücklich, welch tiefe Spuren Perutz in seinem eigenen Werk hinterlassen hat. Und teilt mit uns seine Verblüffung darüber, dass dieser Mann heute nicht zu den berühmtesten Romanciers seiner Sprache gehört. Mit diesem Buch könnte sich das ändern.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
05. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
105
Reihe
Bücher meines Lebens, 6
Autor/Autorin
Daniel Kehlmann
Herausgegeben von
Volker Weidermann
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
180 g
Größe (L/B/H)
193/119/17 mm
ISBN
9783462004069
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Kehlmanns Nacherzählung entwirrt die Fäden, ohne dem Ganzen etwas vom literarischen Zauber zu nehmen. « Erhard Schütz, Tagesspiegel Online
 Besprechung vom 12.12.2024
Besprechung vom 12.12.2024
Der unglaubliche Sieg
In einem Maler des sechzehnten Jahrhunderts porträtierte Leo Perutz sich selbst. Daniel Kehlmann erklärt, was ihn deshalb an dem Schriftsteller fasziniert.
Daniel Kehlmanns kluges und allzu kurzes Buch über den Schriftsteller Leo Perutz (1882 bis 1957) beginnt leider mit einem stilistisch und gedanklich platten Vorwort von Volker Weidermann. Er gibt die Reihe "Bücher meines Lebens" heraus, in der Autoren sich über die Riesen äußern, auf deren Schultern sie stehen. Kehlmann, so schreibt Weidermann, sei ein "tapferer" Mann, weil er seit Jahren darauf verweise, "was für ein großer, bedeutender Schriftsteller Leo Perutz gewesen ist. Und wie wichtig dessen Werk für ihn und sein Schreiben ist."
Was ist "tapfer" daran, wenn ein Erfolgsautor sich über einen "vergessenen" Kollegen äußert, den er verehrt und von dem er viel gelernt hat? Kehlmann muss ja nicht zur Gestapo, um dort ein Wort für Perutz einzulegen. "Vergessen" ist im deutschen Feuilletondiskurs meist Code für jüdisch, für einen Autor also, den man aus dem Land ekelte und aus der Kultur zu streichen suchte, auch noch nach dem Krieg. Das ist bei Perutz, der sich 1938 aus dem angeschlossenen Wien nach Tel Aviv absetzte, eminent der Fall. Als er 1951 seinem alten Wiener Verlag Zsolnay "Nachts unter der steinernen Brücke" anbot, in dem es um das Schicksal der Prager Juden um 1600 geht, winkte der Verleger ab, weil "durch das Thema oder vielmehr durch das Milieu" dem Buch "Widerstände begegnen" würden. Der Roman, dessen Analyse Kehlmann die Hälfte seines Buchs widmet, erschien 1953 in der Frankfurter Verlagsanstalt.
Für Kehlmann gehört Perutz aus vielen Gründen quasi zur Familie. Schon sein Vater, der Regisseur Michael Kehlmann, war ein glühender Perutz-Verehrer. Auf der Suche nach Ausgaben schrieb der Vater an die Witwe Grete Perutz in Tel Aviv (sie starb 1967) und bemühte sich später um Verfilmungen. Der Sohn konzentriert seine Analyse auf fünf späte Werke: zwei Novellen, die Romane "St. Petri-Schnee" (1933) und "Der schwedische Reiter" (1936) sowie das fulminante vorletzte Werk "Nachts unter der steinernen Brücke", eine Sammlung von Kurzgeschichten, die jedoch einen stringent gebauten Roman ergeben. Kehlmann versuchte sich selbst an dieser Struktur in "Ruhm - Ein Roman in neun Geschichten" (2009).
"Nachts unter der steinernen Brücke" erhellt die literarische Metaphysik von Perutz. Mit ihr beginnt Kehlmann sein Buch. Es sind die wichtigsten anderthalb Seiten, die es über Perutz' Weltanschauung gibt: "Handlung ist das, was in einer Geschichte passiert (. . .), also das in der Literatur, was selbst nicht Literatur ist. (. . .) Aus der Perspektive der Figuren aber ist die Handlung weder zufällig noch beliebig. Figuren werden erschaffen, um ihren Handlungsbogen zu erfüllen. Was im Buch Plot ist, ist im Leben unser Schicksal. Schicksal heißt, dass da ein formendes Bewusstsein ist, das sich uns gegenüber verhält wie ein Autor gegenüber seinen Figuren. Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. (. . .) Für Romanfiguren gibt es immer einen Gott, denn jemand hat sie geschaffen und ihre Geschichte absichtsvoll gestaltet."
Dann macht Kehlmann einen Fehler. Die Biographie von Perutz summierend, der 1938 Publikum und Ruhm verlor, schreibt er: "Der Dichter der Schicksalhaftigkeit war selbst nicht mit einem großen Schicksal gesegnet." Kehlmann vergisst, dass Perutz ein Jude war, der neben der europäischen auch in einer jüdischen Dimension lebte. Im Wertesystem dieser Dimension war Tel Aviv ein unglaublicher Sieg, eine echte Errungenschaft, die Erfüllung eines langen Handlungsbogens. Und genau darum geht es in "Nachts unter der steinernen Brücke". Man muss nur die Anspielungen lesen können.
Es ist nämlich keineswegs ein Roman über die Prager Juden zwischen 1528 und 1601, über den reichen Mordechai Meisl und die Liebe Rudolfs II. für dessen schöne Frau Esther, die der Kabbalist Judah Löw in die Utopie nächtlicher Träume verbannt. Es ist ein Buch über das brutale Ende des Traums der jüdischen Duldung in Europa. Perutz begann das Buch 1924 und blieb stecken. Doch 1943, als in Prag bereits das "Museum einer untergegangenen Rasse" eingerichtet worden war, ging ihm die Arbeit plötzlich von der Hand, denn jetzt war klar, welcher Handlungsbogen sich hier auch für Perutz erfüllte.
Kehlmann sieht, dass Perutz sich mit dem Maler Brabanzio selbst ins Geschehen eingeschrieben hat, bedauert aber, dass Brabanzio, weil er etwas Geld hat, sich dem Kaiser durch Flucht entzieht, obwohl doch in der kaiserlichen Kunstkammer sein Ruhm gesichert gewesen wäre. Aber kritisierte Kehlmann selbst in seinem Roman "Lichtspiel" nicht gerade den Filmregisseur G. W. Pabst für just diese Art der Unterwerfung? Perutz lässt für den reichen Meisl das Wort "Kammerknechtschaft" fallen, die 1286 unter Rudolf I. zur Sklaverei wurde (durch Verlust der Freizügigkeit). Ihr entgeht Brabanzio alias Perutz.
"Nachts unter der steinernen Brücke" erzählt die Geschichte des jahrhundertelangen vermeintlichen Liebestraums zwischen Juden und Europäern, der, wie Kehlmann für Rudolf und die schöne Esther konstatiert, eine Vergewaltigung war, "der die größtmögliche Drohung zugrunde lag: die Vertreibung aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation". Da geht man doch lieber gleich.
Im Epilog des Buchs erhebt sich aus der Prager Judenstadt "eine dichte Wolke von rötlich-grauem Staub". Sie entsteht durch den Abriss der dortigen Häuser zwischen 1893 und 1913, den Perutz als Kind selbst erlebt hatte. Kehlmann liest die Wolke als Ankündigung des Holocausts. Muss man aber nicht. Als die Israeliten vor Pharao fliehen, geht der Ewige ihnen voran, als Wolke bei Tag und Feuersäule bei Nacht, und führt sie sozusagen nach Tel Aviv. Ein großes Schicksal, erstmals beschrieben im Buch Exodus, erfüllt für Leo Perutz im Jahr 1938. SUSANNE KLINGENSTEIN
Daniel Kehlmann: "Über Leo Perutz".
Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2024.
112 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 08.02.2025
Gegen das Vergessen und für einen großen Autor
Eine Schatztruhe! Eine Wunderbox. Eine Entdeckungsreise. All dies ist das kleine Büchlein für mich, dessen Seiten Kehlmann mit so viel Reichtum zu füllen vermag. Denn es ist Leo Perutz , den uns der Bestsellerautor hier vorstellt, dessen Werk für ihn prägend und wegbereitend war. Und der zu den größten Romanciers seiner Zeit gehörte. Gehören sollte.
Weltruhm haben Leo Perutz und seine Erzählungen, Novellen und Romane nicht erlangt. Und nicht nur das: Bekanntheit, Anerkennung und Auseinandersetzung mit seinem umfangreichen Werk haben weder zu Lebzeiten des jüdischen Autors noch nach seinem Tode in dem Maße stattgefunden, wie es verdient, ja folgerichtig gewesen wäre. Davon ist Kehlmann überzeugt und in bester Gesellschaft zahlreicher Perutz-Verehrer. Den Wunsch, dies zu ändern, können wir aus jedem Wort, auf jeder Seite und zwischen den Zeilen seiner intelligenten und unterhaltsam aufbereiteten Betrachtung herauslesen. Und uns von seiner Begeisterungen mitreißen lassen.
Mit Kehlmann entdecken wir Erzählungen wie Herr, erbarme dich meiner, Der Tag ohne Abend und den Roman St. Petri Schnee. Doch Kernstück seiner Zusammenstellung bildet nach Kehlmanns eigener Aussage Perutz bester Roman Nachts unter der steinernen Brücke. Und ja, Kehlmanns Zusammenfassung, Interpretationen und vor allem Verknüpfungen machen sprach- und atemlos, lassen staunen und den Wunsch entstehen, selbst sofort zu diesem Werk ungewöhnlichen Aufbaus und komplexer, raffinierter und hoch durchdachter Struktur zu greifen.
Ich selbst hatte das Glück, im Rahmen meines Studiums Perutz, sein Schreiben und Werk kennenlernen zu dürfen. Und leider auch den Umstand, in wieweit und bis heute die Rezeptionsgeschichte jüdischer Autoren eine Geschichte voller Repressalien, Diskriminierungen und Negierungen war und ist. Großer Dank gebührt daher Kehlmann für dieses Buch gegen das Vergessen und für das Sichtbarmachen eines großen Schriftstellers und seines Werks.
LovelyBooks-Bewertung am 08.02.2025
So großartig, so wichtig
Eine Schatztruhe! Eine Wunderbox. Eine Entdeckungsreise. All dies ist das kleine Büchlein für mich, dessen Seiten Kehlmann mit so viel Reichtum zu füllen vermag. Denn es ist Leo Perutz , den uns der Bestsellerautor hier vorstellt, dessen Werk für ihn prägend und wegbereitend war. Und der zu den größten Romanciers seiner Zeit gehörte. Gehören sollte.Weltruhm haben Leo Perutz und seine Erzählungen, Novellen und Romane nicht erlangt. Und nicht nur das: Bekanntheit, Anerkennung und Auseinandersetzung mit seinem umfangreichen Werk haben weder zu Lebzeiten des jüdischen Autors noch nach seinem Tode in dem Maße stattgefunden, wie es verdient, ja folgerichtig gewesen wäre. Davon ist Kehlmann überzeugt und in bester Gesellschaft zahlreicher Perutz-Verehrer*innen. Den Wunsch, dies zu ändern, können wir aus jedem Wort, auf jeder Seite und zwischen den Zeilen seiner intelligenten und unterhaltsam aufbereiteten Betrachtung herauslesen. Und uns von seiner Begeisterungen mitreißen lassen.Mit Kehlmann entdecken wir Erzählungen wie "Herr, erbarme dich meiner", "Der Tag ohne Abend" und den Roman "St. Petri - Schnee". Doch Kernstück seiner Zusammenstellung bildet nach Kehlmanns eigener Aussage Perutz' bester Roman "Nachts unter der steinernen Brücke". Und ja, Kehlmanns Zusammenfassung, Interpretationen und vor allem Verknüpfungen machen sprach- und atemlos, lassen staunen und den Wunsch entstehen, selbst sofort zu diesem Werk ungewöhnlichen Aufbaus und komplexer, raffinierter und hoch durchdachter Struktur zu greifen.Ich selbst hatte das Glück, im Rahmen meines Studiums Perutz, sein Schreiben und Werk kennenlernen zu dürfen. Und leider auch den Umstand, in wieweit und bis heute die Rezeptionsgeschichte jüdischer Autor*innen eine Geschichte voller Repressalien, Diskriminierungen und Negierungen war und ist. Großer Dank gebührt daher Kehlmann für dieses Buch gegen das Vergessen und für das Sichtbarmachen eines großen Schriftstellers und seines Werks.