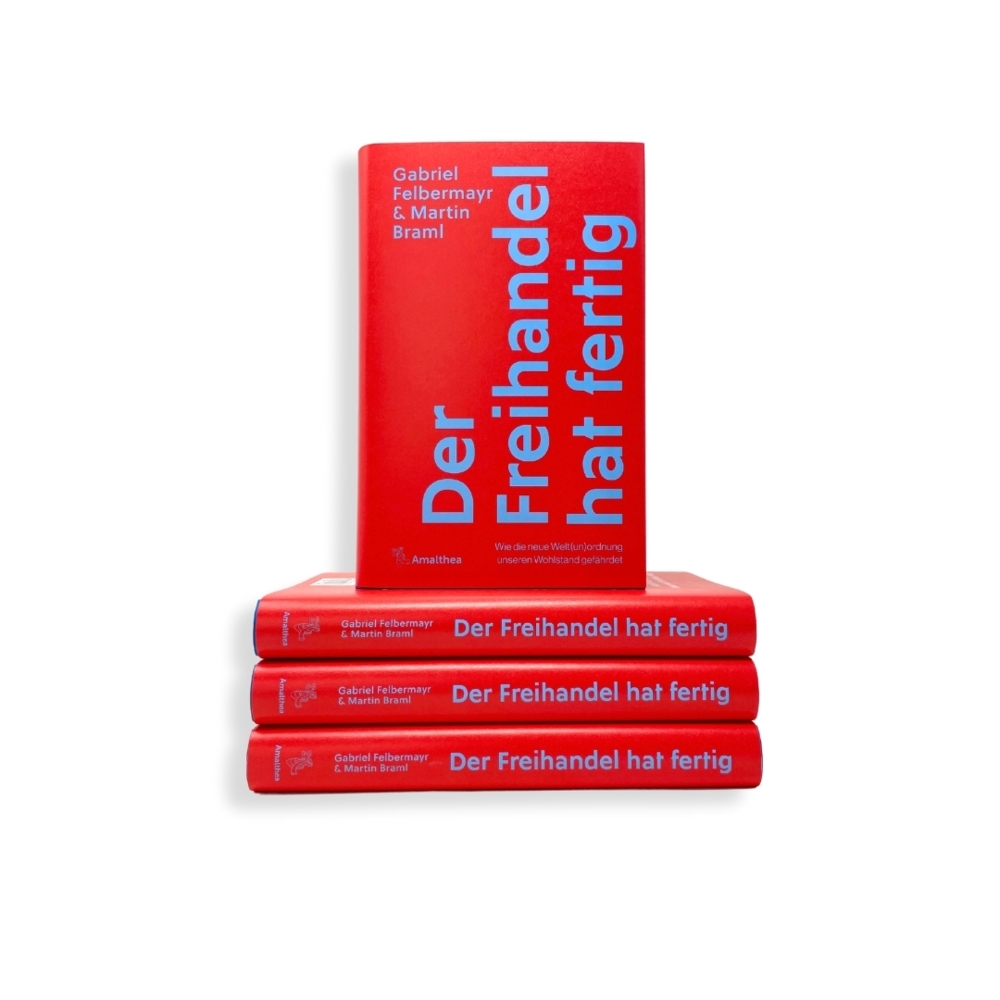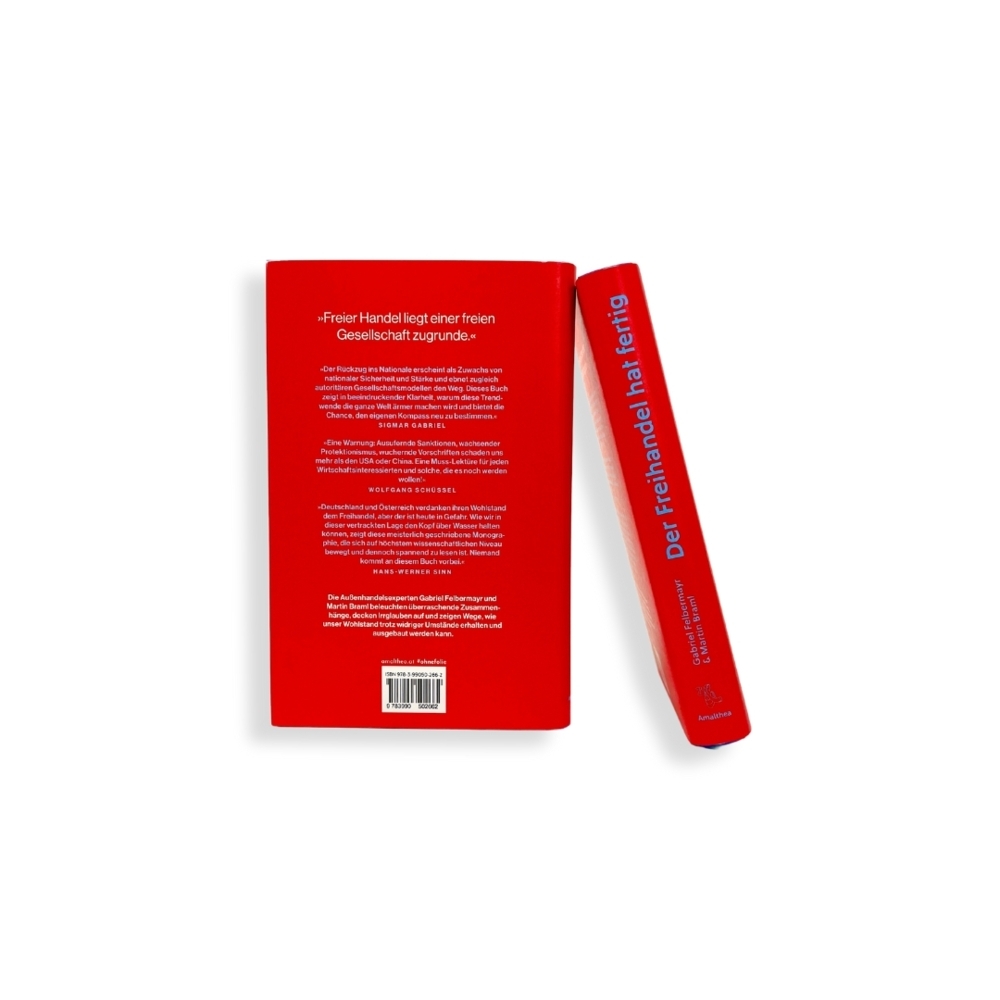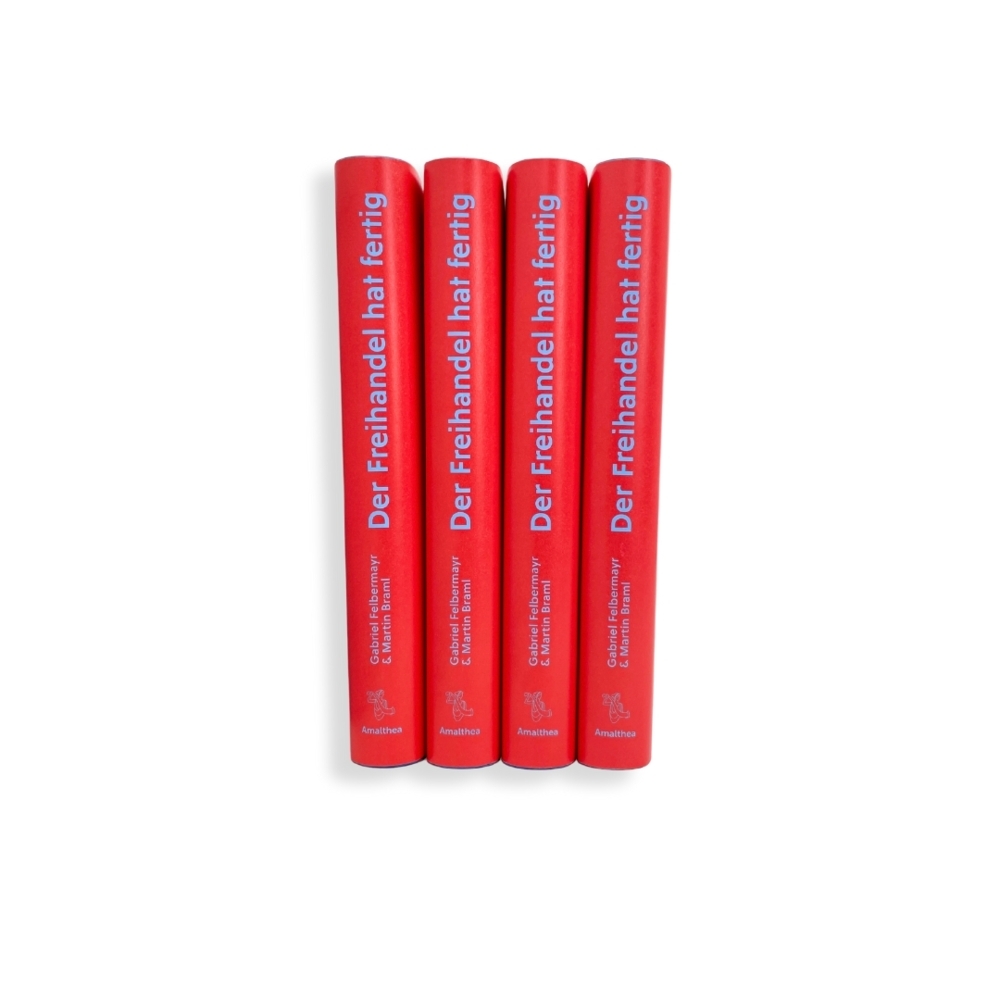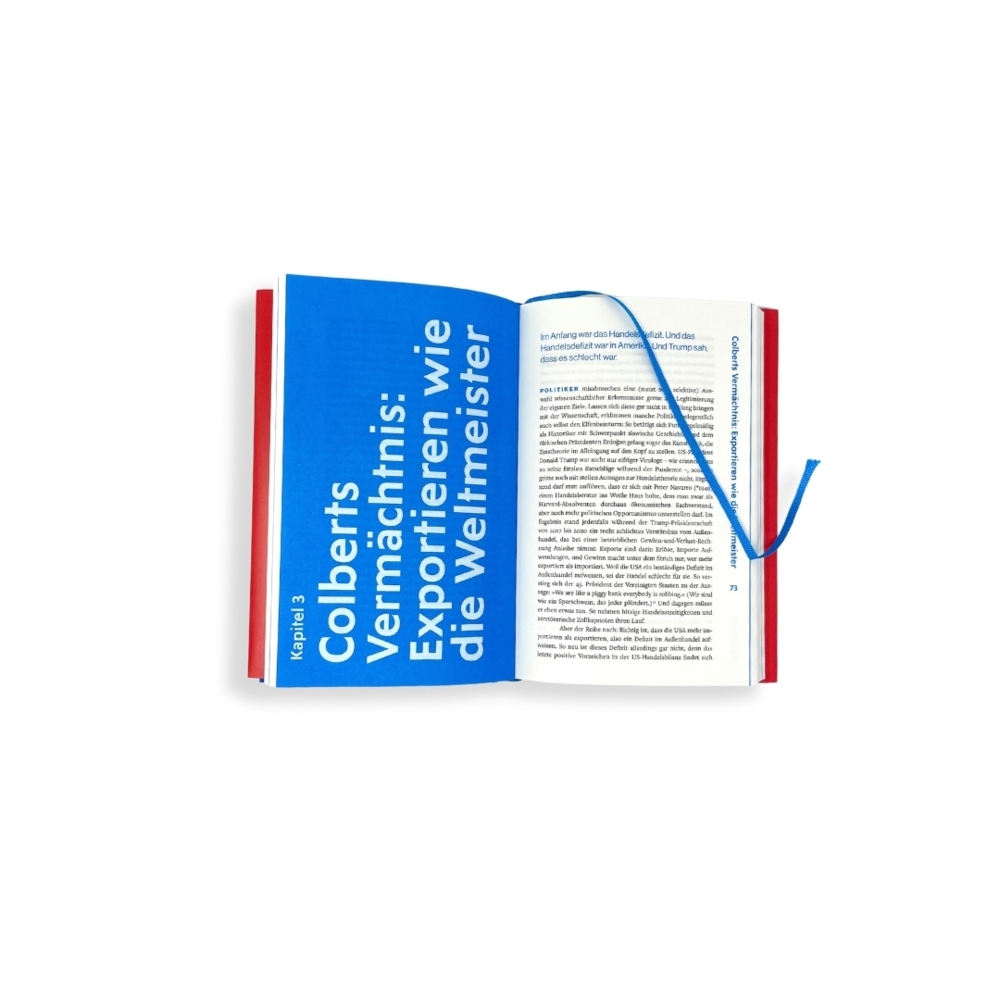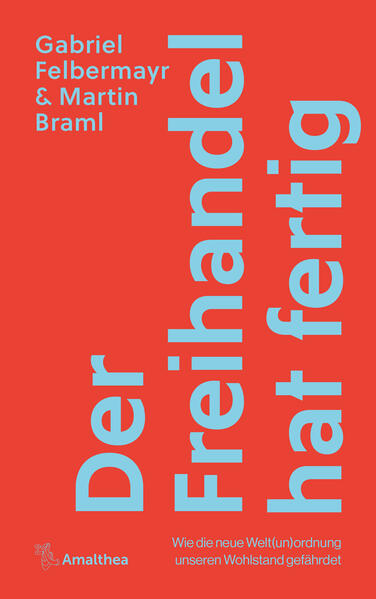
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Während uns die Pandemie außenwirtschaftliche Abhängigkeiten schmerzlich vor Augen geführt hat und Putin Energieexporte als Waffe nutzt, legen Trump & Co. die Axt an genau jene Welthandelsregeln an, die die Welt so reich wie nie gemacht haben. China und die USA entkoppeln sich, die Globalisierung soll zurückgedreht werden. In der EU will man keine Freihandelsabkommen mehr, dafür Sanktionen gegen Schurkenstaaten, Lieferkettengesetze und Klimaprotektionismus zur Rettung der Welt. Der Freihandel weicht zunehmend geopolitischen und ökologischen Erwägungen. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind mittelstandsgeprägt und handelsorientiert - ihr Wohlstand steht auf dem Spiel. Die Außenhandelsexperten Felbermayr und Braml, beide mit langjähriger Erfahrung in der Politik(beratung), beleuchten überraschende Zusammenhänge, decken Irrglauben auf und zeigen Wege, wie unser Wohlstand trotz widriger Umstände erhalten und ausgebaut werden kann.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
272
Autor/Autorin
Gabriel Felbermayr, Martin Braml
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit zahlreichen Abbildungen
Gewicht
480 g
Größe (L/B/H)
214/141/32 mm
ISBN
9783990502662
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 25.11.2024
Besprechung vom 25.11.2024
Entwurf einer Wirtschafts-NATO Ideen für den Freihandel in einer unfreieren Welt
Der Titel des Buches der Außenhandelsökonomen Gabriel Felbermayr und Martin Braml ist eine verkaufsfördernde Provokation: "Der Freihandel hat fertig", steht da in zartem Himmelblau auf rotem Grund. Aber je weiter man sich durch die neun Kapitel auf 254 Textseiten liest, desto klarer wird: Die meinen das ernst. Ihre Analyse ist ernüchternd und womöglich verstörend für Leser aus Ländern, deren Wohlergehen am Außenhandel hängt, wie Deutschland oder Österreich.
Doch Felbermayr, Direktor am Wiener Wirtschaftsforschungsinstitut, und Braml, Dozent an der Uni Passau und Berater des Berliner Bundesfinanzministeriums, sind zu sehr von den Vorzügen des Freihandels durchdrungen, als dass sie das Konzept aufgeben wollten. Erst recht in Zeiten, in denen der Kriegstreiber Wladimir Putin mit Wirtschaftssanktionen von seinem völkerrechtswidrigen Treiben abgebracht werden soll oder in denen der neue US-Präsident Donald Trump die Wirtschaft seines Landes mit Einfuhrzöllen "fixen" will und damit lediglich die Wohlfahrt auch seiner Landsleute beschneiden wird.
Das erfahrene Autorenduo legt in dem flott geschriebenen, mit Anekdoten und witzigen (oder witzig gemeinten) Kommentaren versehenen Buch eine ambitionierte Ideenskizze vor. Die folgt der Frage: Wie viel Freihandel lässt sich in der sich abzeichnenden neuen geopolitischen Ordnung retten? Denn daran, dass die alte Welt eines regelbasierten Handels nach den Prinzipien der Welthandelsorganisation WTO es künftig noch schwerer haben wird, hegen sie keine Zweifel. Zu groß sind die Widerstände in Washington, Moskau und Peking gegen den Multilateralismus, zu groß die Versuchung, machtbasierte Ordnungen auf Kosten anderer durchzusetzen, sei es mit militärischer Gewalt oder ökonomischem Druck. Zu groß ist auch das Bestreben der EU, Handel im Kampf gegen Schurkenstaaten, Menschenrechtsverletzungen ("Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz") oder den Klimawandel zu instrumentalisieren.
Das Buch beginnt mit einer kurzen, prägnanten ideengeschichtlichen Einführung und Einordnung in die wohlfahrtsökonomische Analyse, nach der Handel Mehrwerte schafft, "die weit über bloße Umverteilung hinausreichen". Alsdann wird das WTO-System einer mit vielen Fallbeispielen durchwirkten Kritik unterzogen. Es wird erklärt, warum Merkantilisten wie Jean-Baptiste Colbert, der Finanzminister des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., "schon immer falschlagen".
Das legt die Basis für eine intensive Studie der Handelspolitik der ersten Regierung Donald Trump - und seines alten und wohl neuen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dessen Wirken beschreiben Felbermayr und Braml als widersprüchlich und inkonsistent. Hier hilft die genaue Kenntnis über Trumps erste Amtszeit bei der Vorbereitung auf dessen zweite. Die Analyse des bundesdeutschen Credos "Wandel durch Handel" ist versehen mit einem Fragezeichen. Auch die eigene Souveränität zu erhalten sei ein wirtschaftspolitisches Ziel, handelspolitische Erpressung müsse vermieden werden.
Die Autoren benennen drei Kriterien, die Eingriffe der Politik in den Markt rechtfertigten - der Leser mag dabei an russisches Gas denken: Kurzfristig gibt es keinen Ersatz, das Gut ist unmittelbar konsumrelevant, es drohen Rationierungen. Damit es so weit erst gar nicht kommt, schlagen sie vor, einen speziellen Zoll auf (homogene) Produkte jener Länder zu erheben, von denen der Importeur besonders abhängig ist. Dieser "Konzentrationszoll" würde die Wettbewerbsposition alternativer Anbieter verbessern und strategisch nachteilige Abhängigkeiten reduzieren. Zudem könnten Regierungen für die Bereitstellung von Gütern wie Munition und Waffen mit Herstellern spezielle Kapazitätsverträge schließen, die dann Fertigungskapazitäten für den Ernstfall vorhalten. Das Modell ist der Stromversorgung entlehnt.
Nicht zuletzt müssten die Staaten sicherstellen, dass etwaige Wirtschaftssanktionen nicht umgangen würden, wie es im Falle Russlands aktuell geschieht. Hier greifen die Ökonomen zurück auf ein Instrument des Kalten Krieges. Das Cocom, eine Einrichtung der NATO-Staaten plus Japan, Australien und der Schweiz, kontrollierte die Ausfuhr von Hightechprodukten in die Sowjetunion und ihre Satellitenstaaten. Das war schon damals weniger spannungsfrei, als es heute mit zeitlichem Abstand erscheinen mag. Ob eine solche "Wirtschafts-NATO" der westlichen Demokratien tatsächlich einen "Technologieschild gegenüber den Autokratien bilden" könnte, erscheint deshalb als eine sehr ambitionierte Politikempfehlung. Leichter wäre womöglich, die Empfehlung an die EU umzusetzen, Sanktionsbrechern mit Sekundärsanktionen zu drohen und ihnen nach US-Vorbild den Zugang zum einheitlichen Markt zu versperren.
Felbermayr und Braml haben eine faktenstarke und lesenswerte Abhandlung zu einem Thema rasant wachsender Bedeutung vorgelegt. Deshalb hätte man auch gerne ein paar Absätze mehr zur Dollarisierung des Welthandels und deren Auswirkungen auf die Geopolitik und das Schmieden neuer potentieller Wirtschaftsallianzen wie den BRICS gelesen. Ihr Buch ist dem Titel zum Trotz kein Abgesang auf den Freihandel, wohl aber eine Mahnung, ihn auch in geopolitisch ruppiger werdenden Zeiten möglichst wohlfahrtsstiftend zu nutzen. ANDREAS MIHM
Gabriel Felbermayr und Martin Braml: Der Freihandel hat fertig - Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet. Amalthea Verlag, Wien 2024, 272 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 01.11.2024
Eine unbedingte Leseempfehlung!
Wie die neue Welt(un)ordnung unseren Wohlstand gefährdet
Mit diesem Buch, dessen Titel an den legendären Ausspruch von Giovanni Trappatoni erinnert, beleuchten die beiden Außenhandelsexperten Gabriel Felbermayr und Martin Braml, beide mit langjähriger Erfahrung in der Politik(beratung), wie unser Wohlstand trotz widriger Umstände erhalten und ausgebaut werden kann. Sie erklären kompetent und verständlich die für Laien manchmal überraschenden Zusammenhänge und decken so manchen Irrglauben auf.
Das alles wird den interessierten Lesern in den 9 Kapiteln dieses Buches in anschaulicher Weise nähergebracht, ohne dass hier eine Studium der Wirtschaftswissenschaften notwendig ist. Der, leider nicht mehr erhältliche, Hausverstand sowie kritisches Lesen und Hinterfragen der Medien tut es auch. Gleichzeitig zeigen Felbermayr und Braml auch gangbare Wege auf, die unseren Wohlstand sichern können.
Wohlstandsmotor Freihandel
Ist die WTO hintot?
Colberts Vermächtnis: Exportieren wie die Weltmeister
Trumps Handelskriege und was sie uns lehren
Wandel durch Handel?
Zurück zur Wirtschaftssicherheit
Angriff ist die beste Verteidigung
Auslandsinvestitionen: Ausverkauf von Tech-Juwelen?
Freihandel und Nachhaltigkeit
Wir erinnern uns schmerzlich an die Pandemie, die unsere außenwirtschaftliche Abhängigkeiten von Gütern des täglichen Lebens vor Augen geführt hat. Oder daran, dass inzwischen in den sogenannten DACH-Ländern (Deutschland, Österreich und Schweiz) zahlreiche Medikamente, die einst in den Produktionsstätten dieser Länder entwickelt worden sind, an Länder wie Indien ausgelagert worden sind, kaum mehr erhältlich sind. Auch die Abhängigkeit von Putins Erdgas lässt sich nicht so ohneweiters verringern.
Ob die Abschottung durch hohe Zölle (aktuell gegenüber e-Autos aus China) das wirklich Gelbe vom Ei sind, oder eher kontraproduktiv sind, kann man hier nachlesen. Nationaler Protektionismus wie er zum Beispiel in Ungarn betrieben, wo ausländischen (sprich österreichischen) Unternehmen, neben unzähligen Vorschriften das Wirtschaftsleben schwer gemacht wird und unwillkürlich auferlegte Abgaben auferlegt werden, hilft niemandem, außer den Autokraten. Ausländische Firmen werden das Land verlassen, wenn keine Gewinner mehr erzielt werden können, und mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und Kaufkraft verarmt die beschützte Bevölkerung.
Die DACH-Länder verdanken ihren Wohlstand dem Freihandel. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Immigranten und Zuwanderer, sich für diese Länder entscheiden. Eine Einwanderung nach Afrika, Russland oder China strebt kaum jemand, der aus seiner wirtschaftlichen Trostlosigkeit entfliehen will, an. Die Richtung zeigt immer nach Norden und Westen.
Ich lege allen jenen, die mehr über die wirtschaftlichen Zusammenhänge lernen wollen, dieses meisterlich und dabei verständlich geschriebene Buch wärmstens ans Herz.
Fazit:
Gerne gebe ich diesem Buch, das uns in die faszinierende Welt der Handelsbeziehungen führt, 5 Sterne und eine Leseempfehlung.