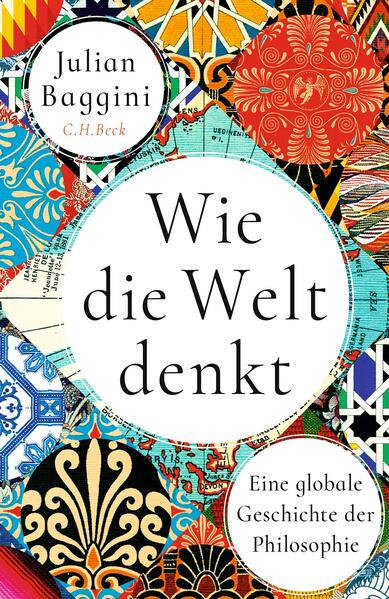
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Globalgeschichte der Philosophie
Überall auf dem Planeten stellen Menschen dieselben grundlegenden Fragen: Woher wissen wir, was wir wissen? Was ist die Welt? Was bedeutet es, ein Individuum zu sein? Und wie sollen wir leben? Aber diese vier Fragen werden nicht überall gleich beantwortet. Baggini erkundet die Geschichte der Philosophen Japans, Indiens, Chinas und der arabischen Welt sowie die weniger bekannten mündlichen Traditionen Afrikas und der indigenen Völker Australiens. Dafür hat er zahllose Gespräche mit lebenden Philosophen und Philosophinnen aus aller Welt geführt. Baggini zeigt uns in seinem beeindruckenden Buch, dass ein tieferes Verständnis der Denkweisen anderer der Schlüssel ist, um auch uns selbst besser zu begreifen.
Eines der großen Wunder der Menschheitsgeschichte besteht darin, dass die schriftliche Philosophie in China, Indien und im antiken Griechenland mehr oder weniger zur gleichen Zeit und völlig unabhängig voneinander entstand. Diese frühen Philosophien hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung unterschiedlicher Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt. Was wir im Westen «Philosophie» nennen, ist nur ein Teil des großen Ganzen. Julian Baggini nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die verschiedenen philosophischen Strömungen der Welt. Sein Buch bietet dabei nicht nur einen Überblick über die globale Philosophie und ihre faszinierenden Geschichten, sondern es öffnet in der Tat ein Fenster auf die vielfältigen Weisen, in denen die Welt denkt.
Überall auf dem Planeten stellen Menschen dieselben grundlegenden Fragen: Woher wissen wir, was wir wissen? Was ist die Welt? Was bedeutet es, ein Individuum zu sein? Und wie sollen wir leben? Aber diese vier Fragen werden nicht überall gleich beantwortet. Baggini erkundet die Geschichte der Philosophen Japans, Indiens, Chinas und der arabischen Welt sowie die weniger bekannten mündlichen Traditionen Afrikas und der indigenen Völker Australiens. Dafür hat er zahllose Gespräche mit lebenden Philosophen und Philosophinnen aus aller Welt geführt. Baggini zeigt uns in seinem beeindruckenden Buch, dass ein tieferes Verständnis der Denkweisen anderer der Schlüssel ist, um auch uns selbst besser zu begreifen.
Eines der großen Wunder der Menschheitsgeschichte besteht darin, dass die schriftliche Philosophie in China, Indien und im antiken Griechenland mehr oder weniger zur gleichen Zeit und völlig unabhängig voneinander entstand. Diese frühen Philosophien hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung unterschiedlicher Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt. Was wir im Westen «Philosophie» nennen, ist nur ein Teil des großen Ganzen. Julian Baggini nimmt uns mit auf eine spannende Reise durch die verschiedenen philosophischen Strömungen der Welt. Sein Buch bietet dabei nicht nur einen Überblick über die globale Philosophie und ihre faszinierenden Geschichten, sondern es öffnet in der Tat ein Fenster auf die vielfältigen Weisen, in denen die Welt denkt.
- "Eine großartige Reise durch die Welt der Philosophien mit einem gelehrten und freundlichen Reiseführer." Sarah Bakewell
- Eine bahnbrechende Einführung in die globale Geschichte der Philosophie
- Eine philosophische Reportagereise durch die Welt nichtwestlicher Philosophien
- Auf der Basis von Interviews mit Philosophen auf dem ganzen Planeten
- Für ein breites Publikum geschrieben, sympathisch und humorvoll
- "Engagiert, weltgewandt und menschlich . . . In unserer umkämpften Zeit weisen Bagginis Scharfsinn und seine Bereitschaft zum Lernen und Zuhören einen wertvollen Ausweg hin zu einem produktiven Dialog." Tim Whitmarsh, The Guardian
Inhaltsverzeichnis
ZUR SCHREIBWEISE VON NAMEN
EINLEITUNG
PROLOG:
Ein historischer Überblick von der Achsenzeit bis zum Informationszeitalter
TEIL EINS
Wie die Welt weiß
1 Die Einsicht
2 Das Unsagbare
3 Theologie oder Philosophie?
4 Logik
5 Säkulare Vernunft
6 Pragmatismus
7 Tradition
8 Schluss
TEIL ZWEI
Wie die Welt ist
9 Zeit
10 Karma
11 Leere
12 Naturalismus
13 Einheit
14 Reduktionismus
15 Schluss
TEIL DREI
Wer wir in der Welt sind
16 Das Nicht-Selbst
17 Das relationale Selbst
18 Das atomisierte Selbst
19 Schluss
TEIL VIER
Wie die Welt lebt
20 Harmonie
21 Tugend
22 Moralische Vorbilder
23 Befreiung
24 Vergänglichkeit
25 Unparteilichkeit
26 Schluss
TEIL FÜNF
Abschließende Gedanken
27 Wie die Welt denkt
28 Ein Sinn für den Ort
Dank
ANHANG
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Register
EINLEITUNG
PROLOG:
Ein historischer Überblick von der Achsenzeit bis zum Informationszeitalter
TEIL EINS
Wie die Welt weiß
1 Die Einsicht
2 Das Unsagbare
3 Theologie oder Philosophie?
4 Logik
5 Säkulare Vernunft
6 Pragmatismus
7 Tradition
8 Schluss
TEIL ZWEI
Wie die Welt ist
9 Zeit
10 Karma
11 Leere
12 Naturalismus
13 Einheit
14 Reduktionismus
15 Schluss
TEIL DREI
Wer wir in der Welt sind
16 Das Nicht-Selbst
17 Das relationale Selbst
18 Das atomisierte Selbst
19 Schluss
TEIL VIER
Wie die Welt lebt
20 Harmonie
21 Tugend
22 Moralische Vorbilder
23 Befreiung
24 Vergänglichkeit
25 Unparteilichkeit
26 Schluss
TEIL FÜNF
Abschließende Gedanken
27 Wie die Welt denkt
28 Ein Sinn für den Ort
Dank
ANHANG
Anmerkungen
Weiterführende Literatur
Register
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
442
Autor/Autorin
Julian Baggini
Übersetzung
Frank Lachmann, Thomas Stauder, Karin Schuler
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 4 Diagrammen
Gewicht
629 g
Größe (L/B/H)
216/149/40 mm
ISBN
9783406830945
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Baggini versteht sich als philosophischer Journalist, der die kanonischen Texte gelesen und viele Gespräche mit Spezialisten geführt hat. Das kommt seiner Darstellung zugute, die er mit Anekdoten, aktuellen Bezügen und Eindrücken von seinen zahlreichen Reisen versieht.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alexander Rösler
Süffig geschriebene Betrachtungen
NZZ am Sonntag, Manfred Papst
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alexander Rösler
Süffig geschriebene Betrachtungen
NZZ am Sonntag, Manfred Papst
 Besprechung vom 28.03.2025
Besprechung vom 28.03.2025
Das ausgeschlossene Dritte hat doch auch seine Vorteile
Ins Gespräch kommen: Julian Baggini macht sich in seiner globalen Geschichte der Philosophie für nichtwestliche Traditionen stark
Die Erkenntnisse der Philosophie, so will es das Fach selbst, erscheinen als unhistorische Wahrheiten. Sie gelten universell und sind unabhängig von Ort und Zeit. Was in Berlin philosophisch wahr ist, kann in Kalkutta nicht falsch sein. Genau das aber wird vom postkolonialen Diskurs der Gegenwart kritisiert. Die westliche Philosophie, so der Vorwurf, hat mit ihren unhinterfragten Konzepten zum Kolonialismus beigetragen. Anstatt anzuerkennen, dass man auch anders denken kann, dass andere Kulturen anders denken, wurden dem Imperialismus nur philosophische Weihen verliehen. Die Gleichsetzung von Philosophie mit westlichem Denken ist etwas, das man "dekolonisieren" müsse. Wir sollten von nichteuropäischen Kulturen lernen, von indigenen Gesellschaften und anderen ethischen Praktiken. Es gibt ein "anderes Denken", das dem westlichen gleichberechtigt ist, ja, vielleicht sogar überlegen. "Epistemischer Ungehorsam" sei zu leisten, andere Begriffe zu verwenden, die anderen Vorstellungen Raum geben.
Doch welche anderen Begriffe? Und wie verhalten sie sich zu den traditionellen philosophischen Begriffen? Wer hier Orientierung suchte, konnte bislang auf keine Gesamtdarstellung zurückgreifen. Das ist nun anders. Julian Baggini ist promovierter Philosoph, Autor, Journalist und Betreiber der Website microphilosophy.net. Seine 2018 im Original erschienene Geschichte der Philosophie liegt nun flüssig und zuverlässig ins Deutsche übersetzt vor. Er unternimmt darin eine Darstellung philosophischen Denkens, welche auch auf nichtwestliche Traditionen eingeht. Seinen Ansatz nennt er "vergleichende Philosophiegeschichte". Und er geht geschickt vor. Anstatt die Geschichte der Philosophie von den alten Griechen bis heute anhand von Personen zu erzählen, greift er sich wesentliche Konzepte heraus - wie etwa "Einsicht", "Logik", "säkulare Vernunft", "Zeit", "Naturalismus", "Reduktionismus", das "Selbst", "Tugend", "Unparteilichkeit" - und trägt zusammen, was in verschiedenen Kulturen dazu gesagt wurde.
Nichtwestliches Denken nimmt dabei den Großteil der Darstellung ein. Baggini versteht sich als philosophischer Journalist, der die kanonischen Texte gelesen und viele Gespräche mit Spezialisten geführt hat. Das kommt seiner Darstellung zugute, die er mit Anekdoten, aktuellen Bezügen und Eindrücken von seinen zahlreichen Reisen versieht. Der Bogen reicht vom chinesischen, indischen, japanischen Denken über die islamische Philosophie, Ideen der Inuit bis zu indigenen afrikanischen Konzepten.
Bagginis Philosophiebegriff ist eher "familienähnlich" orientiert. Die Abgrenzung zur Theologie, zur Weltanschauung oder allgemein zu einer spezifischen "Kultur" ist nicht strikt. Das ist von Vorteil, weil theologisch grundierte Vorstellungen im nichtwestlichen Denken einen großen Raum einnehmen. Baggini urteilt eher zurückhaltend und bemüht sich, die Positionen ins Gespräch zu bringen. Das gelingt ihm mit einer Darstellung, die auch Laien verstehen können. Neben vielen Unterschieden kann er verblüffende Parallelen zeigen. So lässt sich die buddhistische Vorstellung des "anatta", die ein immaterielles und unteilbares Selbst ablehnt, auch bei David Hume finden, der das Selbst als "Bündel oder Ansammlung verschiedener Wahrnehmungen" versteht. Und die Rolle, welche die Tugendethik bei Aristoteles einnimmt, findet ihren Widerhall bei Konfuzius, der in etwa zur gleichen Zeit lebte.
Wie Baggini überhaupt auf dem Feld der Ethik größere Übereinstimmungen feststellt, als man als moralischer Pessimist zuzugeben geneigt ist. Die schwache Abgrenzung von Philosophie und Theologie hat allerdings auch ihren Preis. Baggini entgeht ein ganz zentraler Antrieb der westlichen Philosophie, nämlich Meinung (doxa) von Wissen (episteme) zu unterscheiden. Die westliche Philosophie ist bemüht, durch Verfahren wie Argumentation, Logik und Rechtfertigungspraktiken Standards zu bestimmen, die sicheres Wissen auszeichnen. Das tut sie auch, um Menschen aus Machtbeziehungen zu befreien und zu mündigen Bürgern zu machen. "Sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen" ist das Motto der Aufklärung, das sich explizit gegen den Anspruch der Theologie wendet. Anstatt Autoritäten zu folgen, sollen Menschen selbst denken - überall auf der Welt.
Deutlich wird das besonders im Fall der Logik. Auch das indische Denken hat unabhängig vom griechischen eine Logik entwickelt. Bagginis Kritik an der westlichen Logik richtet sich darauf, dass sie durch den Satz vom ausgeschlossenen Dritten eine Dichotomie des Entweder-oder fördert, im Unterschied zur östlichen Logik, die viele Abstufungen kenne und zulasse. Was Baggini neben der Ausarbeitung einer dreiwertigen oder mehrwertigen Logik im zwanzigsten Jahrhundert allerdings völlig übersieht, ist die Pointe der westlichen Logik, insbesondere seit Frege: Sie zeigt, dass eine Schlussfolgerung allein aus formalen Gründen richtig ist, völlig unabhängig vom Inhalt der Aussagen. Für das Ziel, gesichertes Wissen zu erlangen, ist das kein unbedeutender Schritt. Und gleichzeitig ein Mittel für jeden, Aussagen selbständig zu prüfen und vermeintlichen Autoritäten entgegenzutreten.
Aber Baggini geht es nicht um einen Wettkampf der Denkweisen, sondern um ein vermittelndes Gespräch. Was man dann für überzeugend hält, ist allerdings eine andere Frage - zu deren Klärung die Philosophie beitragen kann, auch die westliche. ALEXANDER ROESLER
Julian Baggini: "Wie die Welt denkt". Eine globale Geschichte der Philosophie.
Aus dem Englischen von F. Lachmann, K. Schuler und Th. Stauder. C. H. Beck Verlag, München 2025. 442 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Wie die Welt denkt" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









