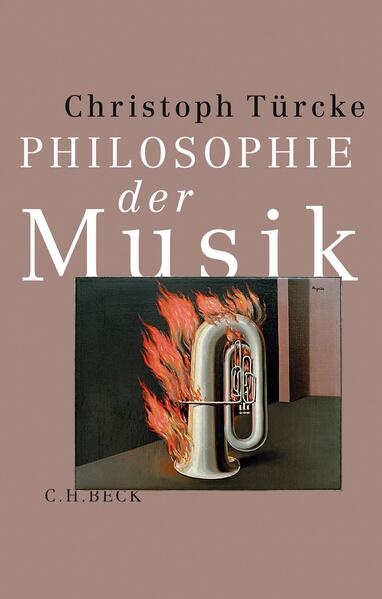
Zustellung: Do, 24.04. - Sa, 26.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die einzigartige Bedeutung der Musik für den Menschen
Ein Buch wie eine große Oper: In fünf Akten mit vorangestellter Ouvertüre und neun Intermezzi bringt der Philosoph Christoph Türcke das in die Vorzeit der Menschheit zurückführende Geheimnis der Musik auf die Bühne der Erkenntnis. Zugleich ist sein meisterlich geschriebenes Werk ein exemplarischer Durchgang durch die Musikgeschichte von Knochenflöten und Dithyrambenchören über mittelalterliche Choräle und die Wiener Klassik, Wagner und Mahler bis zu Zwölftonmusik, Jazz und Rap. Noch die neueste Musik lässt sich nur durch die Vergegenwärtigung ihrer frühesten Anfänge verstehen.
Was ist das für ein merkwürdiges, ebenso penetrantes wie scheues Etwas, welches durch unsere Ohren tief in uns eindringt, im Nu erklingt, im Nu verklingt, uns erschüttert, rührt oder erheitert, jedenfalls bewegt und prägt - und sich doch nicht festhalten läßt? Mit dieser Frage hat es die Philosophie der Musik zu tun: mit einem Geheimnis, das nach erhellenden Worten verlangt. Erhellend heißt nicht auflösend. Wer das Geheimnis der Musik auflösen möchte, wird scheitern. Geheimnislose Musik wäre zudem ohne jeden Zauber. Sie hätte uns nichts mehr zu sagen. Ihr Geheimnis erhellen heißt seine Ausstrahlung maximieren, es in das Wechselspiel von Sensorik und Motorik, Vorstellung und Denken barrierefrei einfügen. Je heller, je aufgeklärter es durch die Worte wird, desto mehr läßt es auch von seinem Innenleben erahnen, an das Worte nicht heranreichen.
Ein Buch wie eine große Oper: In fünf Akten mit vorangestellter Ouvertüre und neun Intermezzi bringt der Philosoph Christoph Türcke das in die Vorzeit der Menschheit zurückführende Geheimnis der Musik auf die Bühne der Erkenntnis. Zugleich ist sein meisterlich geschriebenes Werk ein exemplarischer Durchgang durch die Musikgeschichte von Knochenflöten und Dithyrambenchören über mittelalterliche Choräle und die Wiener Klassik, Wagner und Mahler bis zu Zwölftonmusik, Jazz und Rap. Noch die neueste Musik lässt sich nur durch die Vergegenwärtigung ihrer frühesten Anfänge verstehen.
Was ist das für ein merkwürdiges, ebenso penetrantes wie scheues Etwas, welches durch unsere Ohren tief in uns eindringt, im Nu erklingt, im Nu verklingt, uns erschüttert, rührt oder erheitert, jedenfalls bewegt und prägt - und sich doch nicht festhalten läßt? Mit dieser Frage hat es die Philosophie der Musik zu tun: mit einem Geheimnis, das nach erhellenden Worten verlangt. Erhellend heißt nicht auflösend. Wer das Geheimnis der Musik auflösen möchte, wird scheitern. Geheimnislose Musik wäre zudem ohne jeden Zauber. Sie hätte uns nichts mehr zu sagen. Ihr Geheimnis erhellen heißt seine Ausstrahlung maximieren, es in das Wechselspiel von Sensorik und Motorik, Vorstellung und Denken barrierefrei einfügen. Je heller, je aufgeklärter es durch die Worte wird, desto mehr läßt es auch von seinem Innenleben erahnen, an das Worte nicht heranreichen.
- "Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum." Christoph Türcke
- Das neue Grundlagenwerk
- Eine Natur- und Entstehungsgeschichte der Musik
- Vom "Hmmmmm" der Hominiden bis zum Hip-Hop
- Menschliche Gemeinschaften sind ohne Musik nicht denkbar
Inhaltsverzeichnis
Zueignung
Am Eingang
Einlaß
Ouvertüre: Naturkonzert
Bioakustik ? Evolution ? Nischen ? Anderer Planet ? Just sounds
1. Akt: Hominidenmusik
Vehirnung ? Holistische Lautformen ? Lautzerlegung und Kombination ? Triebumkehrung ? Ritualisierung ? Imago mentaler Raum ? Lautverdichtung ? Name ? Ololygé ? Entklanglichung ? Satzbildung ? Kadenz ? Kontrapunkt ? Exzeß ? Intermezzo 1: Venusbergmusik ? Intermezzo 2: Adornos Fragment über Musik und Sprache
2. Akt: Instrumente und Bühnen
Älteste Musikinstrumente ? Intermezzo 3: Mahlers Knochenflöte ? Tieropfer ? Wettstreit der Instrumente ? Dithyrambos ? Tragödienentstehung
3. Akt: Von der mousike zur Musik
Metrik Rhythmik ? Extreme des Tragischen ? Intermezzo 4: Tragödie à la Nietzsche und Wagner ? Komödie ? Platons Aulos ? Intermezzo 5: Mikrotonalität ? Herauslösung ? Intermezzo 6: Absolute Musik ? Platonischer Reizschutz
4. Akt: Tonalität als christliche Engführung
Parusieverzögerung ? Intermezzo 7: Romantik ? Reinheitsantinomie ? Intermezzo 8: Stockhausens Gesang der Jünglinge ? Jubilatio ? Jubilus Accentus ? Klangantinomie ? Massenandacht ? Musikalisches Pfingstwunder ? Terzdrang ? Motette und Messe ? Kanon und Krebs ? Fuge ? Intermezzo 9: Alphabet und Globalisierung ? Sonate ? Der schreiende Jesus
5. Akt: Revivals
Der Untergrund christlicher Musik ? Oper ? Der Zenit schmelzenden Gesangs ? Gestenmusik ? Jazzursprung ? Adornos Jazzkritik ? Rap
Coda: Die Prinzessin auf der Erbse
Dank
Literatur
Personenregister
Am Eingang
Einlaß
Ouvertüre: Naturkonzert
Bioakustik ? Evolution ? Nischen ? Anderer Planet ? Just sounds
1. Akt: Hominidenmusik
Vehirnung ? Holistische Lautformen ? Lautzerlegung und Kombination ? Triebumkehrung ? Ritualisierung ? Imago mentaler Raum ? Lautverdichtung ? Name ? Ololygé ? Entklanglichung ? Satzbildung ? Kadenz ? Kontrapunkt ? Exzeß ? Intermezzo 1: Venusbergmusik ? Intermezzo 2: Adornos Fragment über Musik und Sprache
2. Akt: Instrumente und Bühnen
Älteste Musikinstrumente ? Intermezzo 3: Mahlers Knochenflöte ? Tieropfer ? Wettstreit der Instrumente ? Dithyrambos ? Tragödienentstehung
3. Akt: Von der mousike zur Musik
Metrik Rhythmik ? Extreme des Tragischen ? Intermezzo 4: Tragödie à la Nietzsche und Wagner ? Komödie ? Platons Aulos ? Intermezzo 5: Mikrotonalität ? Herauslösung ? Intermezzo 6: Absolute Musik ? Platonischer Reizschutz
4. Akt: Tonalität als christliche Engführung
Parusieverzögerung ? Intermezzo 7: Romantik ? Reinheitsantinomie ? Intermezzo 8: Stockhausens Gesang der Jünglinge ? Jubilatio ? Jubilus Accentus ? Klangantinomie ? Massenandacht ? Musikalisches Pfingstwunder ? Terzdrang ? Motette und Messe ? Kanon und Krebs ? Fuge ? Intermezzo 9: Alphabet und Globalisierung ? Sonate ? Der schreiende Jesus
5. Akt: Revivals
Der Untergrund christlicher Musik ? Oper ? Der Zenit schmelzenden Gesangs ? Gestenmusik ? Jazzursprung ? Adornos Jazzkritik ? Rap
Coda: Die Prinzessin auf der Erbse
Dank
Literatur
Personenregister
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
510
Autor/Autorin
Christoph Türcke
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
718 g
Größe (L/B/H)
220/150/49 mm
ISBN
9783406829949
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Ein absoluter Gewinn"
rbb radio3, Andreas Göbel
"Eines der besten Bücher, die über Musik geschrieben wurden."
Süddeutsche Zeitung, Helmut Mauró
rbb radio3, Andreas Göbel
"Eines der besten Bücher, die über Musik geschrieben wurden."
Süddeutsche Zeitung, Helmut Mauró
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Klingender Abbau von Tötungshemmung
Christoph Türckes Nachdenken über Musik bietet manch anregende Überlegung, fällt aber der Blickverengung durch eine Generalthese zum Opfer.
Von Jan Brachmann
Von Jan Brachmann
Zumindest die ersten etwa 130 Seiten der "Philosophie der Musik" von Christoph Türcke sind eine große Verheißung. Dass Musik "bis in die vegetative Dimension des Leibes hinein" reiche, dass sie als "Erschütterungskultur" auch den Gleichgewichtssinn berühre und mit Schwerkraft zu tun habe - das alles sind wichtige Beobachtungen, die ein völlig anderes Reden über Tonalität, Rhythmik und Harmonielehre eröffnen würden.
"In musikalischer Spannung artikuliert sich psychosomatische und soziale Spannung, in musikalischer Bewegung zittert individuelle und kollektive Gefühlsbewegung", schreibt Türcke und arbeitet den Weltbezug des Klingenden heraus: "Musik ist nur Musik, sofern etwas von ihr Unterschiedenes in ihr klingt." Diese Vielfalt des sozialen Zitterns, die ganze Psychosomatik des Stürzens und Schwebens, des Feststehens und Niedergedrückt-Werdens, möchte man begrifflich schärfer gefasst und an exemplarischen Beispielen vorgeführt bekommen.
Lange Zeit sieht es so aus, als könnte Türcke diesen Wunsch erfüllen. Er stellt sich mit großem Ernst die Frage: "Wo kommt die Musik her?" Und seine "musikarchäologische Expedition" führt zunächst in die Bioakustik zu den Untersuchungen von Bernie Krause, der mittels Tonaufnahmen von Biotopen jenseits menschlichen Einflusses tierische Lautäußerungen qualifizierte und in Verlaufsformen brachte. Das Ergebnis: Konzertieren ist die Suche nach einer akustischen Nische, in der jedes Leben sich Geltung und Raum verschafft in Konkurrenz zu anderen Lebewesen, je nach Tages- und Jahreszeit. Auch die akustische Verödung solcher Biotope unter wachsendem menschlichen Einfluss wurde dabei dokumentiert.
Von dort wendet Türcke den Blick auf den Prozess der Menschwerdung und beschreibt eindrücklich die musikalischen Folgen des aufrechten Gangs: Der Kehlkopf senkte sich ab und ermöglichte eine tonlich konsistentere Art der Lautbildung als noch bei Menschenaffen. Das Ausbalancieren des Ganges durch Armbewegungen zog nicht nur eine höhere Empfindlichkeit des Gleichgewichtssinnes nach sich, sondern ebenso ein Gespür für Paarigkeit und Symmetrie im Rhythmus.
Der Prozess der "Verhirnung", also des im Vergleich zur Körpergröße überproportional ausgedehnten Gehirns, führte zu einer gesteigerten psychosomatischen Selbstwahrnehmung und nervlichen Reizbarkeit, was zu den evolutionsbiologischen Grundlagen der Musik gehört. Hier wird "die vegetative Dimension des Leibes" knapp und klar, mit großer Evidenz erschlossen. Man liest es mit Gewinn und Vergnügen.
Türcke gliedert dann seine "Philosophie der Musik" ein in jene psychoanalytische Herleitung menschlicher Kulturleistungen, die er in seinen früheren Werken schon vorgestellt hat. Auch Musik wurzelt für ihn in dem, was Sigmund Freud den "Primärvorgang" genannt hat: der Verschiebung und Verdichtung von Erlebnisinhalten in der Umkehr des Fluchttriebs vor überlebensbedrohender Gefahr durch einen Zwang zur Wiederholung traumatischer Erfahrung. Genau diese Wiederholung rückt die traumatische Erfahrung in Distanz und macht sie bewältigbar.
Das Urereignis dieses komplexen Prozesses ist das Menschenopfer, mit dem unsere frühen Vorfahren lebensfeindliche Mächte zu beschwichtigen suchten. Die Bestimmung des zu opfernden Individuums, dessen Tötung, Bestattung und die anschließende Beruhigung des überlebenden Kollektivs, seien, so Türcke, Urvorgänge, die in jeder Musik mit- und nachklingen, sofern sie uns ergreife. Musik sei grundsätzlich Ausdruck, aber Ausdruck sei nicht Mitteilung, sondern primär unadressierte Erregungsabfuhr. So wurzele das tonale Spannungsgefälle der Kadenz in der Psychodynamik des Loswurfes, dem angstvollen Beobachten des Losfluges und dem sich entladenden Schrei des dergestalt ausgewählten Opfers. Kadenz sei "die rituelle Absenkung des Erregungsgrades". Musik ist ihrem Ursprung nach also verschobener und verdichteter Opferschrei, zugleich dessen Übertönung, mithin klingender Abbau von Tötungshemmung und beruhigende Traumatherapie.
Im erregten Tremolo des heiligen Namens bei der Beschwörung jener schrecklichen und faszinierenden Macht, die es im Opfer zu beschwichtigen gilt, seien Musik und Sprache, Klang und Bedeutung in Konkretion noch eins. Danach trennen sie sich mehr und mehr.
Mit dem Übergang vom Menschen- zum Tieropfer transformiere sich das Entsetzen in erleichterten Jubel. Dabei sind einige Funde von Türckes psychoanalytischer Linguistik verführerisch einleuchtend. Der griechische Opferschrei ololygé sei lautmalerisch verwandt mit dem hebräischen Jubelruf halleluja. Das Wort "Jubel" kommt über das Verb jubilare erst mit der Bibelübersetzung der Vulgata in die lateinische Sprache, nämlich mit der Übertragung des hebräischen Wortes jobel für "Widderhorn" bei der Abwendung der Opferung Isaaks im Alten Testament. Das Tieropfer als Entlastung vom Menschenopfer löst den Jubel aus: Der Mensch stößt dankbar ins Horn dessen, der für ihn starb.
Doch nach diesen - durchaus erregenden - Befunden engt sich Türckes universeller Horizont ein: erst auf die griechische Antike, dann auf das lateinische Europa. Die Herleitung der Tonalität, des Konsonanzprinzips und der Polyphonie aus dem Reinheitsbedürfnis des Christentums und der Akustik der Kathedralen verkennt gleich mehrerlei: erstens, dass es tonale Vokalpolyphonie auch außerhalb Europas gibt, besonders ergreifend bei den Aka-Pygmäen in Zentralafrika. Zweitens, dass sich auch im christlich geprägten Europa, etwa im Balkan, Mehrstimmigkeit nach dem Dissonanz- oder Distanzprinzip und sogar mit mikrotonaler Schwebungsdiaphonie erhalten hat. Drittens, dass der Zeilengesang der altrussischen Orthodoxie vor der Kirchenspaltung im siebzehnten Jahrhundert dissonante Sekundparallelen liebte, die wahrscheinlich mit der Unreinheit des für die russische Frömmigkeit so wichtigen Glockenklangs, dem spezifischen Obertonspektrum von Metallophonen zu tun haben.
Es fehlt Türckes "Philosophie der Musik" vollkommen an Empirie des ethnologischen Vergleichs, obwohl die Literatur dazu seit Jahrzehnten vorliegt. Es fehlt dem Autor auch die Kenntnis musikwissenschaftlicher Arbeit, die nach den Wurzeln menschlicher Musikalität in der tierischen Kommunikation forschte. Georg Knepler hatte in der DDR in seinem Buch "Geschichte als Weg zum Musikverständnis" schon 1977 mit dem Verhaltensbiologen und Bioakustiker Günter Tembrock Untersuchungen zum Tier-Mensch-Übergangsfeld unternommen und dann modellhaft biogene, mimeogene und logogene, also biologische, gestisch-imitative und sprachnahe Codierungsschichten in der Musik beschrieben. Vor allem war es der Musiksoziologe und Sozialhistoriker Christian Kaden, der Lautgestalten "affinen" und "diffugen" Verhaltens, also der Herstellung von Nähe und des Vertreibens oder Fliehens, beschrieb, die sich von tierischer Kommunikation bis in kompositorisches Gestalten durchziehen.
Die ganze erste Seite von Türckes Literaturverzeichnis wird von den Schriften Theodor W. Adornos dominiert, dessen Vorlieben für Mahler und Schönberg, dessen Antipathien gegen Wagner und Strawinsky Türcke mit größter Ergebenheit folgt. Der Hirnforscher und Musikermediziner Eckart Altenmüller kommt hingegen nur mit einem Titel vor. Altenmüller hat Studien zum vorgeburtlichen Hören und der dabei erfolgenden hormonellen Beeinflussung vorgelegt. Türcke aber tut das "embryonale Hören" als nebensächlich ab. Dabei wäre doch nicht nur das Opfer, sondern auch das Wiegenlied ein Ursprung der Musik: die Beruhigung des schreienden Säuglings durch eine Stimme, die ihm vorgeburtlich schon vertraut ist. Das Wiegen selbst ist psychosomatische Erinnerung an das geschützte Schweben im Fruchtwasser. Bis hin zur Harmonik von Skrjabin und Rachmaninow oder den Suspensionsakkorden im Jazz versucht Musik, uns dieses regressive Glück der Erinnerung an unser vorgeburtliches Leben wieder zu schenken.
Von alldem aber will Türcke nichts wissen. Seine psychoanalytische Opfertheorie gerät ihm zu einer neu-metaphysischen Totalphilosophie, die Pluralität nicht gut verträgt und sich gegen Falsifizierung imprägniert. Viele kleine Fehler in der Beschreibung musikalischer und musikhistorischer Details wären verzeihlich gewesen. Aber Türckes Ausfälle gegen "die neuzeitliche Musikwissenschaft" und gegen den "beschränkten Kreis jener ,evidenzbasierten' Wissenschaften, die nur Laborexperiment, Befragung und Statistik als valide Methoden kennen", berühren unangenehm. Ein Buch, das als große Verheißung begann, endet in der Pose eines Philosophen, der auf Empirie pfeift. Das ist geradezu schmerzhaft enttäuschend, weil völlig unnötig.
Christoph Türcke:
"Philosophie der Musik".
C. H. Beck Verlag, München 2025. 510 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Philosophie der Musik" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









