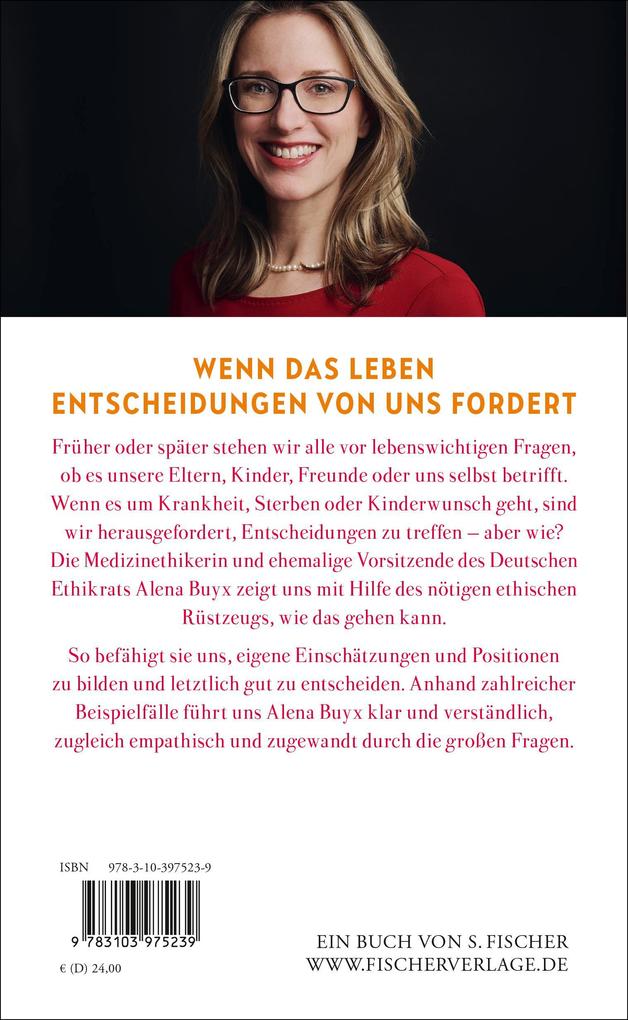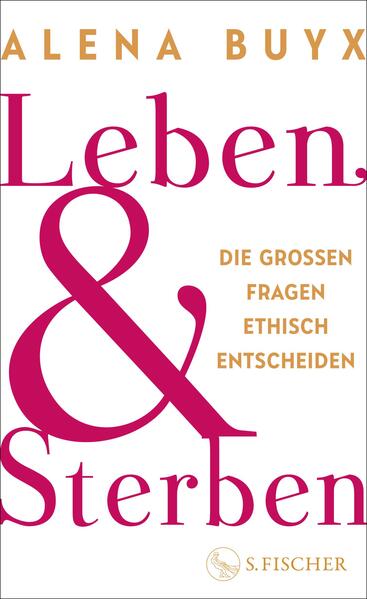
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx über die großen Fragen des Lebens - allgemein verständlich und lebensnah
Wenn es um unsere Gesundheit geht, wir mit Krankheit konfrontiert werden, oder es um Leben und Tod geht, stehen wir vor Entscheidungen, die uns nicht selten überfordern. Die Medizinethikerin Alena Buyx greift die vielen ethischen Fragen auf, vor denen wir früher oder später alle stehen. Sie befähigt uns, eigene Einschätzungen und Positionen zu bilden und letztlich gute Entscheidungen zu treffen.
Die Herausforderungen umfassen die gesamte Lebensspanne: So geht es ebenso um künstliche Befruchtung, pränatale Diagnostik und Frühgeburten wie um Sterbehilfe, assistierten Suizid und Palliativmedizin. Dabei spielen immer auch die neuen Möglichkeiten eine Rolle, die sich aus der aktuellen Forschung ergeben, so etwa der Einsatz von KI und Robotik. Anhand zahlreicher Beispielgeschichten führt uns Alena Buyx klar und verständlich, gleichzeitig zugewandt und empathisch durch die großen Fragen.
Ein Kompass für die existenziellen Fragen, die uns alle angehen - Medizinethik für alle.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
304
Autor/Autorin
Alena Buyx
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
384 g
Größe (L/B/H)
205/132/30 mm
ISBN
9783103975239
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Jeder Interessierte erlebt hier eine hoch engagierte und empathische Autorin, welche auch noch fesselnd zu schreiben versteht. Humanes Leben - Humanes Sterben
Alena Buyx bietet Rüstzeug für Antworten. (. . .) Allgemeinverständlich und lebensnah. Christoph Arens, KNA (Katholische Nachrichten-Agentur)
Ihr didaktisches Gespür erweist sich als bestechend. (. . .) Vielen wird ihr Pragmatismus helfen, sich im Dschungel der ethischen Argumente zu orientieren. (. . .) Die Ethikerin beweist (. . .) Fingerspitzengefühl. Joachim Müller-Jung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Alena Buyx bietet Rüstzeug für Antworten. (. . .) Allgemeinverständlich und lebensnah. Christoph Arens, KNA (Katholische Nachrichten-Agentur)
Ihr didaktisches Gespür erweist sich als bestechend. (. . .) Vielen wird ihr Pragmatismus helfen, sich im Dschungel der ethischen Argumente zu orientieren. (. . .) Die Ethikerin beweist (. . .) Fingerspitzengefühl. Joachim Müller-Jung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Wie halten wir's mit der Sterbehilfe?
Eine gute Orientierung im Dschungel der ethischen Argumente: Alena Buyx befasst sich mit dem Anfang und dem Ende des Lebens, der Beziehung zwischen Arzt und Patient - und dem Einzug der Künstlichen Intelligenz in die Medizin.
Von Joachim Müller-Jung
Von Joachim Müller-Jung
Wer sich erinnert, wie kontrovers und vielschichtig die ethischen Debatten verlaufen sind, die sich allein in den vergangenen zehn, zwanzig Jahren um die Modernisierung der Medizin und eine überlebensfähige Gesundheitsversorgung entwickelt haben, darf sich bei diesem Buch wundern. Wie geht das: einen konzisen, möglichst ausgewogenen "Kompass" für die existenziellen Fragen der Gegenwart und Zukunft auf nicht einmal dreihundert Seiten zu liefern? Die Antwort könnte lauten: Interaktivität und direkte Ansprache verhindern das Abschweifen. Sprich mit dem Leser, beziehe ihn ein, direkt und fragend, immer wieder. Geh auf Augenhöhe und mach deutlich: Auch du wirst dich dieses und jenes bald fragen (müssen), ganz konkret.
Genau das, der Perspektivwechsel von der Expertin zum mitfühlenden Gegenüber, ist Alena Buyx' besonderes Talent, ihr didaktisches Gespür erweist sich als bestechend. Das werden viele, die der Autorin in der Corona-Pandemie mit Skepsis und teils mit Hassgefühlen zugehört haben, weil sie in ihren Analysen und Empfehlungen eine vermeintliche Regierungsnähe zu entdecken glaubten (und ihr diese bis heute fälschlicherweise nachsagen), naturgemäß anzweifeln. Und es ist sicher noch heute so: Alena Buyx, die damalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, hat sich einige Feinde gemacht mit ihrer klaren Haltung pro Gesundheitsschutz. Aber was diese Entschiedenheit wert ist, wenn es um die Kommunikation von kritischen, ja existenziellen Fragen im Medizinbetrieb geht, zeigt sich sehr gut in ihrem schon vor Corona angedachten Buch über das "Leben und Sterben". Sie liefert Argumente, Werturteile und abgewogene Antworten, wo andere lavieren und sich in akademische Kontroversen begeben.
Vor allem ist es ihr zu tun um vier kritische Bereiche der modernen Medizin, in denen sie als Medizinethikerin die wichtigsten Veränderungen beobachtet - und die sie klinisch vielfach selbst begleitet hat: Am Lebensanfang sind es Frühgeburten und die Präimplantationsdiagnostik, am Lebensende die Frage des selbstbestimmten Sterbens, dazwischen das Arzt-Patienten-Verhältnis sowie der Einzug der Künstlichen Intelligenz in einen maschinell ohnehin immer weiter hochgerüsteten Medizinbetrieb.
Buyx beobachtet die Entwicklungen seit vielen Jahren mit dem Blick der Wissenschaftlerin, der Gutachterin, der Anwenderin. Doch in der Sprache, mit der sie ihre Leser in medizinische Grenzregionen einführt, verlässt sie nie den Standpunkt der Fragenden. Das mag hier und da zu vereinfachend wirken, doch vielen wird ihr Pragmatismus helfen, sich im Dschungel der ethischen Argumente zu orientieren.
Methodisch zieht Buyx, um der Anschaulichkeit willen, besonders oft Fallbeispiele heran. Gerade bei so schwierigen Themen wie der Präimplantationsdiagnostik in der künstlichen Befruchtung zeigt sich die Stärke dieses Konzeptes. Es wird nicht breit diskutiert, welche bioethischen Komplikationen sich durch die eingeschränkte Zulassung der Embryonenwahl in der Petrischale aufgetan haben, sondern exemplifiziert.
Was tun? Diese Frage stellt die Autorin nach der Schilderung der oft selbst erlebten medizinischen Fälle. Bei der Präimplantationsdiagnostik betrifft das etwa die Frage, wie die gesetzlichen Regelungen auf vertretbare Weise weiterentwickelt werden könnten. Sollen nach unheilbaren Erbkrankheiten auch tödlich verlaufende und oft mit genetischen Vorbelastungen einhergehende Krebsleiden eine Rolle spielen bei der Embryonenselektion im Reagenzglas? Buyx bleibt hier wie fast immer aufseiten der Betroffenen und Paare, die in die Klinik kommen. Ohne allerdings den Blick für mögliche gesellschaftliche Konsequenzen zu verlieren; zudem markiert sie zuverlässig, wo ihrer Überzeugung nach Grenzen zu ziehen sind.
Das andere ethisch brisante Thema, das sie stark beschäftigt, diesmal am Lebensende, ist die aktive Sterbehilfe. In einigen Nachbarländern und weltweit zunehmend wird die Frage des selbstbestimmten Todeszeitpunkts im Sinne der Sterbewilligen entschieden. Buyx ist hier sehr viel zurückhaltender. Ausführlich erläutert sie den Unterschied zwischen passiver, indirekter und aktiver Sterbehilfe. Doch Buyx thematisiert nicht nur den Sterbewunsch, sondern auch den Sterbeprozess selbst, und zwar mithilfe konkreter Fälle aus dem Medizineralltag. Davon profitieren ihre ethischen Begründungsschleifen; eine bloße, wenn auch von fachlicher Expertise getragene Reflexion hätte gewiss nicht diese Wucht.
Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von vor fünf Jahren, bei dem festgestellt wurde, dass der selbstbestimmte Sterbewunsch - auch von verzweifelten, todkranken Jugendlichen - "Ausdruck persönlicher Autonomie" sei, ist in den Augen der Autorin eine ethische und juristische Transformation verpflichtend geworden, nicht notwendigerweise für jeden Einzelnen, wohl aber für die Ärzte und den Medizinbetrieb insgesamt. Vieles ist noch immer nicht abschließend geregelt; für die aktive Sterbehilfe ist eine gesellschaftlich tragfähige Gesetzesregelung wohlgemerkt längst nicht gefunden.
Die Autorin spricht sich mit überzeugenden Argumenten für eine defensive Auslegung des Verfassungsgerichtsurteils aus. Sie möchte ausschließen, dass der Todeswunsch ungeregelt und liberal bis zum Äußersten verhandelt wird. Juristische Aspekte, etwa zur Frage der "Tatherrschaft", können da nicht unbehandelt bleiben: Welche Rolle dürfen und sollen Ärzte beim persönlichen Ringen einzelner Menschen mit dem Tod spielen dürfen - eine aktive oder doch ihrem medizinischen Eid entsprechend eine zurückhaltende?
In den beiden Kapiteln, die sich um das digital längst schon erweiterte Arzt-Patienten-Verhältnis und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz drehen, nimmt Buyx den Leser in die Welt eines sich rapide verändernden Gesundheitssystems mit. Gespeist mit den eigenen Erfahrungen und den Sorgen etwa um den drohenden Pflegenotstand, angefüttert auch mit der Expertise aus ihrer Arbeit im Ethikrat, kündigt sie nichts weniger als eine Zeitenwende an. Offen bleibt, auch für sie, wie die Menschen die vielen neuen noch unwägbaren Veränderungen im Medizinbetrieb verarbeiten werden.
Ein klares Werturteil verkneift sich Buyx hier, dass jedoch allerlei Umbrüche kommen werden, steht für sie außer Frage. Akzeptanz zu generieren, ist in einer Gesellschaft, die sich gerade in existenziellen Fragen nicht immer risikozugewandt gezeigt hat, ein schwieriges Unterfangen. Die Ethikerin beweist in dieser Hinsicht Fingerspitzengefühl.
Alena Buyx:
"Leben und Sterben".
Die großen Fragen ethisch entscheiden.
S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main 2025.
304 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 17.04.2025
Regt zum Nachdenken an über die existentiellen Fragen des Lebens
Die Medizinethikerin Alena Buyx ist zur Zeit der Corona Pandemie bekannt geworden. Damals war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
In ihrem aktuellen Buch beschreibt Alena Buyx ethische Herausforderungen, die sich am Anfang und am Ende des menschlichen Lebens stellen können sowie in der Zeit dazwischen.
Sie stellt dem Leser und der Leserin direkte Fragen:
Was ist lebenswertes Leben?
Was ist ein guter Tod?
Wann ist ein Leben nicht mehr wert, gelebt zu werden, weil es zu viel unvermeidliches Leid mit sich bringt?
Buyx stellt in jedem Kapitel konkrete Beispiele aus ihrer beruflichen Tätigkeit vor, die zutiefst berühren.
Ausgehend davon bereitet sie ihre Leser darauf vor, sich eine eigene Haltung zur Thematik anzueignen und auf Grund der dann folgenden ethischen Theorien und Prinzipien zu konkretisieren.
Das Buch "Leben & Sterben. Die großen Fragen ethisch entscheiden" ist für mich eine klare Kaufempfehlung! Früher oder später wird jeder und jede von uns vor diese großen Entscheidungen des Lebens gestellt. Alena Buyx gibt uns dazu die notwendige Richtschnur!
am 15.04.2025
informativ und interessant
das cover ist schlicht und passend zur thematik, die fallbeispiele sind interessant und helfen die dazu gehörenden aspekte und fragen zu verdeutlichen. gerade in der medizin ist es sehr wichtig diese ethischen details zum leben und sterben, zu krankheit und allem damit zusammen hängenden zu kennen und zu hinterfragen. schön, dass hier sowohl auf vorgeburtliches, wie auch auf krankheiten und dann auf das sterben und den tod eingegangen wird. über einiges macht man sich wenn es im umfeld thema ist so seine gedanken, hier wird dazu noch etliches nicht ganz so alltägliches aufgegriffen, gerade auch um die diversen seiten zu erklären. mir waren die vielen angaben zu quellen und hinweise auf den anhang etwas zu häufig, das hat mich gebremst und da auf so viele bücher und seiten zurückzugreifen ist, werden das wohl nur fachleute machen, für mich wären ein paar mehr beispiele und erklärungen dazu hilfreicher gewesen. dennoch ein sehr gutes buch mit wertvollen informationen, das zum nachdenken anregt.