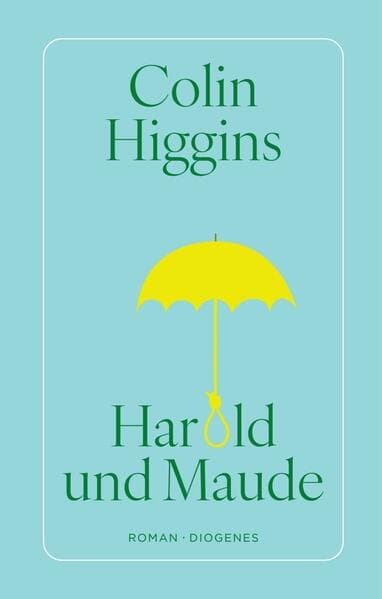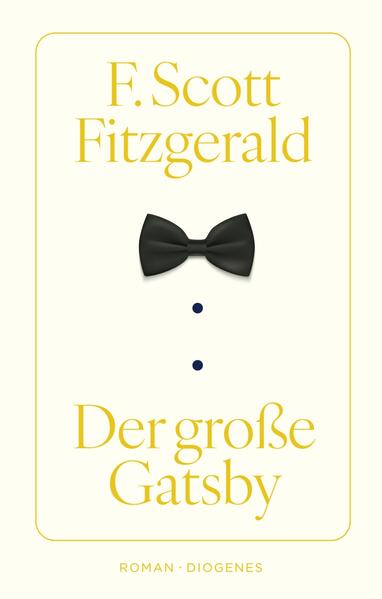
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
New York 1922. Auf seinem Anwesen in Long Island gibt Jay Gatsby sagenhafte Feste. Er hofft, mit seinem neuerworbenen Reichtum, mit Swing und Champagner seine verlorene Liebe zurückzugewinnen. Zu spät merkt er, dass er sich von einer romantischen Illusion hat verführen lassen.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
26. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
256
Reihe
Modern Classics (Diogenes Verlag)
Autor/Autorin
F. Scott Fitzgerald
Übersetzung
Bettina Abarbanell, Susanne Höbel
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
252 g
Größe (L/B/H)
190/123/19 mm
ISBN
9783257073379
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Engel sind die eleganteren Menschen. Aber wer hoch steigt, wird tief fallen. Niemand zeigte beides so schön wie F. Scott Fitzgerald. « Peter Michalzik / Frankfurter Rundschau, Frankfurter Rundschau
»F. Scott Fitzgerald ist ein Schriftsteller, wie er uns heute fehlt. Man kann ihn wieder und wieder lesen. « Sandra Kegel / Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»F. Scott Fitzgerald war der Größte unter uns allen. « Ernest Hemingway
»F. Scott Fitzgerald ist ein Schriftsteller, wie er uns heute fehlt. Man kann ihn wieder und wieder lesen. « Sandra Kegel / Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»F. Scott Fitzgerald war der Größte unter uns allen. « Ernest Hemingway
 Besprechung vom 06.04.2025
Besprechung vom 06.04.2025
Der Text ist meine Party
Vor hundert Jahren erschien "Der große Gatsby" von F. Scott Fitzgerald. Mit jeder neuen Lektüre entdeckt man ein neues Buch.
Von Paul Ingendaay
Jede Wiederbegegnung mit diesem Roman riecht nach Klassenzimmer. Damals, in den Siebzigerjahren, setzte unser Englischlehrer seinem aus sechs Schülern bestehenden Englisch-Leistungskurs F. Scott Fitzgeralds "The Great Gatsby" aus dem Jahr 1925 zur Lektüre vor. Wir waren siebzehn Jahre alt, und unser Lehrer - im Unterricht wurde nur Englisch gesprochen - redete uns mit "Mr." an.
Die meisten Schüler unseres katholischen Jungeninternats am Niederrhein kamen aus der näheren Umgebung. Wenn alles gut ging, würden einige von ihnen später das Priesterseminar in Münster besuchen und den theologischen Nachwuchs des Bistums verstärken. Klingt nach grauer Vorzeit. Was unser Leistungskurs aber jetzt vor sich sah, war ein gelbes Penguin-Buch - Preis: 65 Pence - mit Robert Redford und Mia Farrow auf dem Cover. Die Verfilmung von Jack Clayton nach einem Drehbuch von Francis Ford Coppola (1974) lag erst ein paar Jahre zurück. Schon die erste Unterrichtsstunde enthüllte, dass es in diesem Roman um Geld, Macht, Sex und Frivolität ging, aber auch um eine so berührende Anmutung von Schönheit, dass sich ihr die Natur selbst unterzuordnen schien.
Als der kleine Finanzberater Nick Carraway, der Erzähler, an einem warmen, windigen Sommerabend die steinreichen Buchanans in ihrer prunkvollen Kolonialvilla in Long Island besucht - Daisy Buchanan ist seine Cousine zweiten Grades -, überwältigt ihn schon der unmäßige Platz, den diese Leute vor den Toren New Yorks bewohnen: "Die Grünfläche begann am Strand und lief eine Viertelmeile weit bis zur Haustür" - rechnen Sie es aus, das sind 400 Meter -, "übersprang Sonnenuhren, Ziegelwege und prachtvolle Gärten, bis sie sich schließlich, kaum hatte sie das Haus erreicht, wie vom Schwung ihres Laufs getrieben, in üppigen Ranken an den Hauswänden hochzog." Die Grünfläche, heißt das. So viel Grün! Und gleich am Wasser, an einer Bucht, auf deren gegenüberliegender Seite - in krass unterschiedlichen Häusern - Nick Carraway selbst und der mysteriöse Mr. Gatsby wohnen.
Drinnen aber, im Wohnraum der Buchanans, tanzt das Sonnenlicht, der Wind weht herein und bläst die hellen Vorhänge mal nach innen, dann nach außen, sodass ihre Schatten flüchtige Wellenmuster auf den weinroten Teppich werfen, und dann: "Das einzige, vollends unbewegte Objekt im Zimmer war ein riesiges Sofa, auf dem zwei junge Frauen wie auf einem fest verankerten Ballon schwebten. Sie waren beide ganz in Weiß, und ihre Kleider wehten und flatterten, als wären sie gerade erst nach einem kurzen Flug rund um das Haus wieder hereingeblasen worden." So klingt es in Bernhard Robbens neuer, sorgfältiger Übersetzung, die zum hundertjährigen Jubiläum des Romans im Manesse-Verlag erschienen ist.
Unser Englischlehrer verweilte lange bei dieser Szene. Er wollte uns Fitzgeralds außergewöhnliche Bilder nahebringen, das Berückende seines Stils, die Musik dieser perlenden Sätze, und wenn es im Lauf der Wochen natürlich auch um all die fürchterlichen Dinge ging, die im Roman sonst noch eine Rolle spielen - Hedonismus und Eitelkeit, Gier, Saufen, Grausamkeit, skrupellose Geschäfte, zu schweigen von dem, was man früher "innere Leere" genannt hätte -, verschwand die Schönheit doch nie ganz. Sie ging für uns Klosterschüler eine unlösbare Verbindung mit dem Buchcover ein, auf dem der galante Robert Redford mit blütenweißem Hemd, im hellen Sommeranzug, hinter einer bezaubernden Mia Farrow steht, die ein cremeweißes Sommerkleid trägt und einen gazeartigen, transparenten Sommerhut.
So legte sich die Fotoschicht (Eleganz, schimmernde Haut) auf die Sprachschicht, später kamen die Filmschichten hinzu, dann das zweite und dritte Lesen, noch später die zum Heulen traurige Fitzgerald-Biographie. Wir selbst wurden älter und erkannten, dass jede neue Lesergeneration den Roman auf ihre eigene Weise entdeckt, aber warum "Der große Gatsby" bis heute gelesen wird, ist wohl, dass er hinter der Nichtigkeit eines Traums immer noch die Größe dieses Traums ahnen lässt. Das Persönliche daran, das Eigenwillige. Die Tragik. "Der große Gatsby" ist ein junges Buch. Gegen die brutale Entzauberung, die er vornimmt, setzt er das Rauschhafte der Verführung, ob durch die Liebe, den Luxus oder den Wind in den Haaren in einem dahinrasenden Sportwagen.
Und darin liegt schon eine der Wahrheiten - das Unnachahmliche, Unübertroffene - dieses Romans: dass er die sinnlich wahrnehmbare Schönheit nie bewertet, nicht zerredet und nicht verrät, sondern bis zum Ende feiert, obwohl viele seiner Figuren ziemliche Angeber sind, Party-Fuzzis, wirklich verkommene Subjekte. Nur eben - so behauptet es Nick Carraway, der Erzähler - ein gewisser Jay Gatsby nicht, der Mann mit dem ungeklärten Vermögen und den dubiosen Geschäften, der verblendete Romantiker, der dem Phantasiebild einer Frau nachjagt, die sich ihrerseits, als es zum Schwur kommt, lieber für das alte Ostküsten-Geld entscheidet, nicht für das neue, dessen Herkunft keiner kennt. Und die Gatsby, dem Narren, den moralischen Todesstoß versetzt. Bevor dann er, Opfer einer Verwechslung, im eigenen Swimmingpool einen echten und sehr banalen Tod stirbt.
Fitzgerald hat sein Handwerk, außer in zwei jugendlich autobiographischen Büchern, vor allem durch das Schreiben von Short Storys trainiert. In seinen Briefen klagt er ständig darüber, er sei wie ein Lohnsklave, der einen flüchtigen Markt bedienen müsse, aber das war nun einmal sein Beruf. Seine Frau Zelda wurde krank und brauchte viele teure Sanatoriumsaufenthalte, während er selbst sich zum absoluten Star der Magazine hocharbeitete, die seine Geschichten druckten und sie mit schönen Frauen, schönen Wohnzimmern und schlanken Männern in tadellosen Anzügen illustrierten. Zu seiner besten Zeit, 1929 kurz vor dem Börsencrash, verdiente er 3500 Dollar und mehr pro Story, den vielfachen Jahresverdienst eines Industriearbeiters.
Aber das Geld brauchte er auch bei seinem aufwendigen Lebensstil - Partys, große Häuser, Essen und vor allem: Trinken. Gereicht hat es nie. Und ausgerechnet sein bester Roman, mit dem er sich als Künstler ein zweites Leben verschaffen wollte, trug ihm wirtschaftlich kaum etwas ein. Während Fitzgerald 1929 mit seinen Erzählungen 30.000 Dollar verdiente, schlug "Der große Gatsby" mit 5,10 Dollar zu Buche. Bis zu seinem frühen Tod 1940 sollte sich das nicht wesentlich ändern. Kurz darauf erfolgte die Auferstehung des Romans, die seinem Schöpfer nur nützt, sollte er als stummer Nebenengel von irgendwo dort oben zuschauen.
Was ist der Roman heute? Und für die amerikanischen Studenten, die ihn zu Tausenden an der Uni lesen? "Der große Gatsby" ist so vieles in einem, dass man mit jeder neuen Lektüre ein neues Buch entdeckt, je nachdem wohin man schaut - und wer man selbst geworden ist durch den Abnutzungseffekt der Jahre, den manche Weisheit nennen. Klar, ein Vanitas-Buch: Alles Irdische hat ein Verfallsdatum. Und: Manchmal sind wir zu blöd, es zu erkennen, oder machen kaputt, was uns retten könnte. "Der große Gatsby" ist auch ein Buch über die Beschleunigungskräfte der Moderne, über Style, Moden, tolle Autos, das Rasen - und mangelnde Verkehrstüchtigkeit.
Daneben erzählt das Buch von jemandem, der die Zeit anhalten, ja die Uhr zurückdrehen will - weswegen es einiges zu sagen hat, dass dem nervösen Gatsby, der Daisy gleich sein riesiges Anwesen (und dann auch seine Hemden!) zeigen wird, in den Minuten zuvor fast die klobige Uhr auf Nicks Kaminsims aus den Händen rutscht. Aber sie fällt nicht, dieses Symbol wäre zu viel. Gatsby schafft es also, die Angebetete in seine Privatgemächer zu führen. Und die Hemdenszene - ein Fest für Filmregisseure - zeigt uns Daisy, die vor der Schönheit dieser Stoffe, Farben und Designs in Tränen ausbricht. Nichts anderes im ganzen Roman erschüttert sie so stark wie Gatsbys verdammte Hemden. Aus Daisy spricht schon der Konsumfetischismus der Tiktok-Welt.
Etwas Wunderbares wie diese Jubiläumsausgabe, erdacht und kommentiert von Manesse-Verleger Horst Lauinger, hat es im Deutschen noch nie gegeben (Manesse, 333 Seiten, 30 Euro). Die erste Hälfte besteht aus dem Romantext, die zweite bringt Fitzgeralds Briefwechsel, vor allem mit seinem Lektor Maxwell Perkins, dann zeitgenössische Rezensionen und Essays, ein Personenglossar, eine Zeittafel und ein Fan-Nachwort von Claudius Seidl, was nur positiv gemeint ist. ("Every friend of Gatsby's is a friend of mine", steht bei Murakami.)
Dann Maxwell Perkins: Vermutlich ist sein Beitrag zum "Großen Gatsby" die berühmteste Lektorenleistung der amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Sein Zuspruch, sein Enthusiasmus, aber auch seine scharfsinnige Detailkritik (sowie Fitzgeralds Fähigkeit, die Kritik umzusetzen) haben aus einem ziemlich guten Roman ein Meisterwerk gemacht. Denn einer der Angelpunkte des Buches ist erst im Austausch zwischen Lektor und Autor entstanden: dass wir den Parvenü Jay Gatsby nur schattenhaft wahrnehmen und bis zum Ende wenig über ihn wissen, dass es allenfalls Gemunkel über die dunkle Quelle seines Reichtums gibt. Dass er kaum etwas sagt außer der Anredephrase "old sport" - "Sportsfreund". Und dass der Mann, den wir Gatsby nennen, im Grunde eine Schöpfung des Erzählers Nick Carraway ist.
Sodass der Roman statt "Der große Gatsby" auch "Der kleine Nick" heißen könnte. All die verführerischen, lyrisch trunkenen Sätze, mit denen der Erzähler die kolossale Selbsttäuschung des Helden beschreibt, gehen ja auf Nicks eigene Täuschbarkeit und seine eigenen Sehnsüchte zurück. Wenn Gatsby über Daisy die berühmten Worte sagt: "Ihre Stimme ist voll mit Geld", ist es Nick, der gleich die Deutung dazu mitliefert: "Das war es. Mir war es nur nie zuvor klar geworden. Sie war voller Geld - das machte den unerschöpflichen Charme aus, der in ihr mitschwang, ihr Klimpern, den Zimbelklang ... Des Königs Tochter hoch oben in einem weißen Palast, die goldene Schöne ..." Einige Seiten zuvor hat der Erzähler sie schon einmal beschrieben, diese "schwankende, fieberheiße Stimme, die ihn fesselte, weil kein Traum sie übertreffen konnte - diese Stimme war wie ein unsterbliches Lied."
Am Ende dürfte es eher Nick Carraway sein, den Daisys Stimme verzaubert hat, während der knappe Gatsby-Satz auf die Erkenntnis eines nüchternen Geschäftsmanns schließen lässt: Wenn diese Stimme voller Geld ist, dann deswegen, weil Daisy ein teures Geschöpf ist, das im doppelten Sinn unterhalten werden will. Aber das sind alles nur Andeutungen. Man muss den Roman selbst lesen, wieder und wieder.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der große Gatsby" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.