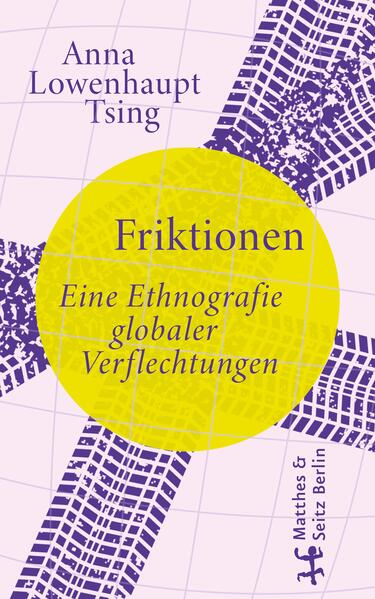
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Der Regenwald im Meratusgebirge auf Borneo verändert seit 1970 grundlegend seine Gestalt: Holz und die natürlichen Ressourcen seiner Böden werden auf dem internationalen Markt verkauft, um Schulden zu begleichen und sich zu bereichern. Nationale und globale, individuelle und universelle Interessen überlagern sich: Korrupte Provinzbehörden machen gemeinsame Sache mit japanischen Investoren, javanesische Einwanderer verdrängen autochthone Waldbewohner. Doch auch zum Schutz des Waldes formieren sich breite Allianzen, Studenten aus der Hauptstadt treffen auf engagierte Dorfbewohner, internationale Aktivisten und Naturliebhaber. In einer atemberaubenden Szenenfolge zwischen Reportage, Feldforschungsbericht und kulturtheoretischen Überlegungen begleitet Anna Lowenhaupt Tsing die Geschehnisse und entwickelt eine einzigartige Ethnografie der Friktionen.
In Borneo, an einem Ort, der beispielhaft ist für eine globalisierte Welt, offenbart sich, dass aus vielfältigen und widersprüchlichen sozialen Interaktionen, die unsere heutigen Lebensrealitäten ausmachen, ebenso zukunftsträchtige wie monströse Kulturformen entstehen können.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Februar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
479
Autor/Autorin
Anna Lowenhaupt Tsing
Übersetzung
Dirk Höfer
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
654 g
Größe (L/B/H)
219/144/36 mm
ISBN
9783751820349
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 22.03.2025
Besprechung vom 22.03.2025
Sand in der Maschine der Globalisierung
Von Kolonisierten zu selbstbewussten Akteuren: Anna Lowenhaupt Tsings Folgerungen aus ihrer Feldforschung bei Indigenen auf Borneo.
Von Karl-Heinz Kohl
Von Karl-Heinz Kohl
Die amerikanisch-chinesische Kulturanthropologin Anna Lowenhaupt Tsing zählt zu den bedeutendsten Ethnologinnen ihrer Generation. Nach Abschluss ihres Studiums verbrachte sie zu Beginn der Achtzigerjahre einen Feldforschungsaufenthalt bei einer indigenen Dorfgemeinschaft in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo. Dessen Ergebnisse veröffentlichte sie 1993 unter dem Titel "In the Realm of the Diamond Queen". Das unter dem Einfluss der experimentellen Schreibformen der Writing-Culture-Bewegung entstandene Werk gilt heute als ein Klassiker des Fachs. Ihr Besuch bei den Meratus Dayak, die im gebirgigen Inneren Südkalimantans leben und traditionellen Wanderfeldbau betreiben, sollte nicht der letzte bleiben. Er war der Auftakt zu einer ethnographischen Langzeitstudie, die sich über Jahrzehnte hin erstreckte.
Die theoretischen Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen, die sie während ihrer Feldstudienaufenthalte auf Borneo ziehen konnte, hat Lowenhaupt Tsing 2005 unter dem Titel "Friction" veröffentlicht. Zwanzig Jahre trennen also die Erstpublikation von der nun erschienenen Übersetzung. Liest man allerdings die provokanten Thesen der Autorin, dann kann man nur feststellen, wie aktuell das Buch auch heute noch ist. Sie gelten insbesondere der um die Jahrhundertwende noch vorherrschenden Vorstellung, dass der Finanzkapitalismus seinen weltweiten Siegeszug weiterhin ungehindert fortsetzen werde.
Forciert vorangetriebene Modernisierungsvorhaben und ein beschleunigter Abbau der natürlichen Ressourcen der Länder des globalen Südens, für die Finanzinvestoren die notwendigen Mittel aufbringen sollten, standen damals vorrangig auf dem Programm der nationalen und internationalen Entwicklungsagenturen. Auf der anderen Seite hatte sich aber auch die ökologische Bewegung bereits zu formieren begonnen, deren Anhänger gegen die rücksichtslose Zerstörung der Waldgebiete der tropischen und subtropischen Zonen Südamerikas, Südostasiens und Afrikas protestierten und sich Gehör verschafften, indem sie internationale Konferenzen und Kongresse organisierten.
Lowenhaupt Tsing analysiert am Beispiel Borneos - der drittgrößten Insel der Welt -, wie sich all diese Maßnahmen und Auseinandersetzungen auf die Bewohner einer der rohstoff- und artenreichsten Regionen des Planeten auswirkten. Mit ihren Beispielen weist sie vor allem die Vorhersagen der Vertreter der Globalisierungsthese zurück, die die Komplexität gerade der lokalen Verhältnisse unterschätzten. Zentral für ihren eigenen Ansatz ist der von ihr als analytisches Konzept verwendete Begriff der Friktion. Er besagt, dass in einer Ära globaler Verflechtungen die unterschiedlichen Intentionen und Praktiken einzelner Akteure zu Reibungsflächen führen, aus denen heraus fortwährend Neues entsteht. Ihr Zusammentreffen kann zu Konflikten, Zusammenbrüchen und unerwarteten Katastrophen führen. Friktionen entlarvten so die Behauptung, dass die globale Macht wie eine gut geölte Maschine funktioniere. Doch könne es genauso gut zu Kollaborationen kommen, von denen beide Seiten profitierten. Allerdings seien solche erfolgreichen Zusammenschlüsse in der Vergangenheit nur allzu oft auf Kosten der natürlichen Umwelt gegangen, wie man es an der Zerstörung der Urwaldlandschaften im Innern Borneos beobachten könne.
Was sich zunächst sehr trocken und theoretisch anhört, demonstriert Lowenhaupt Tsing an zahllosen Beispielen, wie etwa den Impulsen, die zunächst Prospektoren und Finanzinvestoren, in neuerer Zeit aber auch Umweltaktivisten, Abenteuertouristen und Naturfreunde ins Land brachten. Zur ersten großen Welle der Inbesitznahme und Vermarktung lokaler Ressourcen war es schon in den Siebzigerjahren unter dem Schutzmantel der diktatorialen "Neuen Ordnung" gekommen, die Suharto nach dem Sturz des Staatsgründers Sukarno in Indonesien errichtet hatte. Gerüchte über Goldfunde im Innern der Insel veranlassten einen kanadischen Finanzmakler, Prospektoren in die Siedlungsgebiete der Dayak zu schicken. Nach ersten Misserfolgen wurden sie tatsächlich fündig. Die Kurse der für den Abbau eigens gegründeten Aktiengesellschaft schossen in die Höhe und führten Mitte der Neunzigerjahre zu einem regelrechten Goldrausch.
Neben den Beauftragten der Bergbauunternehmen kamen nun auch illegale Goldschürfer auf die Insel, obgleich sich die Vorkommen schon bald als wenig ergiebig erwiesen. Die durch die Grabungen entstandenen Umweltschäden aber blieben und ließen verödete Landschaften zurück. Die waren allerdings nichts im Vergleich zu dem ökologischen Schaden, der durch das systematische Abholzen der Wälder für die Zellstoff- und Papierindustrie verursacht wurde, das ebenfalls schon unter Sukarno einsetzte. Wo sie früher standen, erstrecken sich heute riesige Ölpalmplantagen, deren Produkte mittlerweile zu einem der wichtigsten Exportartikel dieses Teils des Archipels geworden sind. Hier wird nach den Plänen des 2024 zurückgetretenen indonesischen Präsidenten Joko Widodo zurzeit auch die neue Hauptstadt des Landes errichtet, die in Zukunft die von Überschwemmungen bedrohte Metropole Jakarta ersetzen soll.
Wie aber, so fragt Lowenhaupt Tsing, reagierten die indigenen Bevölkerungsgruppen der Insel auf die zahllosen Eingriffe in ihre überlieferten Lebensformen? Weit davon entfernt, klein beizugeben oder sich gar als Opfer zu sehen, nutzten sie ihre Chancen, wo immer sie sich boten. Naturprodukte wie etwa die als Leckerbissen in China begehrten Schwalbennester, exotische Tiererzeugnisse wie Pythonhäute und Bezoarsteine oder seltene Kräuter, die als besonders heilkräftig und potenzfördernd galten, wurden von den Einheimischen gesammelt und in den Niederlassungen der ausländischen Arbeitskräfte verkauft. Gab es Goldvorkommen in der Nähe ihrer Dörfer, forderten sie von den Bergbauunternehmern und Schürfern Gebühren ein. Und auch das in Indonesien geltende Rechtssystem, dem zufolge nicht bewirtschaftete Wälder als Staatsbesitz gelten, wussten sie für ihre Zwecke zu nutzen, indem sie sich in kleinen Familienverbänden in der Nähe der besonders begehrten lokalen Ressourcen niederließen und so ihre Besitzrechte auf die entsprechenden Gebiete anmeldeten.
Stießen sie damit auf den Widerstand der Staatsbeamten, die mit den ausländischen Investoren gemeinsames Spiel machten, dann konnten sie in aller Regel auf die Unterstützung der Umweltschutzverbände rechnen, die sich für den Schutz der tropischen Regenwälder einsetzten. Und bald traten auch Menschenrechtsorganisationen für sie ein. Weitere Bündnispartner fanden sie in den Abenteuertouristen und begeisterten Naturfreunden, die sie in ihren traditionellen Dörfern besuchten und denen sie dort ihre eigenen Artefakte und die archäologischen Fundstücke verkauften, die im Zuge des maritimen Handels nach Borneo gelangt waren, den man im Archipel schon lange vor der Ankunft der ersten Europäer betrieb.
Es ist nicht immer einfach und erfordert einige Geduld, Lowenhaupt Tsing auf all den verschlungenen Pfaden zu folgen, auf die sie ihre Leser führt. Da sind etwa die ausführlichen Schilderungen der Anbautechniken der Dayak, die ganz auf die Bedingungen ihrer natürlichen Umwelt abgestimmt sind. Oder auch die vielen wörtlichen Wiedergaben der Unterhaltungen, die sie mit Entwicklungshelfern, mit ökologischen Aktivisten und mit Touristen geführt hat. Von weit größerem Interesse erscheinen dagegen die Äußerungen ihrer Dayak-Freunde und -Gesprächspartner. Sie zeugen vom großen Selbstvertrauen, mit dem es ihnen gelungen ist, mit all den neuen Herausforderungen fertigzuwerden, und vom Geschick, das sie im Umgang mit den vielen Fremdeinflüssen an den Tag legen. Es zeigt sich auch in ihrem Umgang mit den aus dem Westen stammenden menschenrechtlichen Universalien, auf die sie sich berufen, um aus ihnen ihre eigenen kulturellen Rechte abzuleiten. "Wir sind . . . ein indigenes Volk, das mit seiner traditionellen Kultur die Umwelt schützt", so heißt es in einem selbst verfassten Dokument, das die Merantau-Dayak an die Zentralregierung in Jakarta schickten: "Wir betrachten jeden Angriff auf die Umwelt als einen Angriff auf unsere Menschenrechte." Aus den einst Kolonisierten sind heute selbstbewusste Akteure geworden, die das stereotype Bild, das die Eroberer ihres Landes von ihren Vorfahren entwarfen, heute gegen die wenden, von denen es stammt.
Lowenhaupt Tsings Abhandlung ist immer dann am überzeugendsten und auch unterhaltsamsten, wenn sie sich ihrer eigenen Erzähllust überlässt. Ihr Versuch, im Anschluss an die Überlegungen von Hegel und Marx ein eigenes Theoriegebäude zu errichten, scheint dagegen etwas zu ambitioniert. Lesenswert bleibt das Buch der großen Ethnologin, das auf der kontinuierlichen Forschungsarbeit von drei Jahrzehnten beruht, gleichwohl.
Anna Lowenhaupt Tsing: "Friktionen". Eine Ethnografie globaler Verflechtungen.
Aus dem Englischen von Dirk Höfer. Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2025. 479 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Friktionen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









