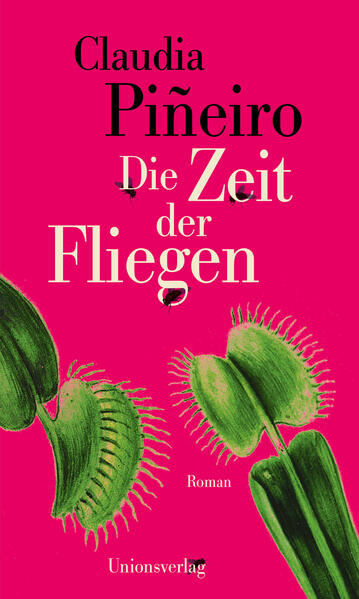
Zustellung: Di, 22.04. - Do, 24.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Frauen, Fliegen, Finale - Inés' Geschäftsidee lockt zweifelhafte Kundinnen an.
Vor fünfzehn Jahren brachte Inés die Geliebte ihres Mannes um, jetzt ist sie frisch aus dem Gefängnis raus und gründet ein Unternehmen: FFF, Frauen, Fliegen, Finale - ökologische Schädlingsbekämpfung und Privatdetektei, von Frauen für Frauen. Doch eine reiche Kundin will mehr loswerden als nur Ungeziefer - denn auch ihr Mann hat eine Geliebte.
Vor fünfzehn Jahren brachte Inés die Geliebte ihres Mannes um, jetzt ist sie frisch aus dem Gefängnis raus und gründet ein Unternehmen: FFF, Frauen, Fliegen, Finale - ökologische Schädlingsbekämpfung und Privatdetektei, von Frauen für Frauen. Doch eine reiche Kundin will mehr loswerden als nur Ungeziefer - denn auch ihr Mann hat eine Geliebte.
Inés ist frisch aus dem Gefängnis raus und bereit für ein neues Leben, fünfzehn Jahre, nachdem sie die Geliebte ihres Mannes umgebracht hat. Gemeinsam mit ihrer Knastkumpanin Manca gründet sie ein Unternehmen: FFF, Frauen, Fliegen, Finale - ökologische Schädlingsbekämpfung und Privatdetektei, von Frauen für Frauen.
Doch Señora Bonar, eine ihrer Kundinnen, will mehr loswerden als nur Ungeziefer - könnte Inés nicht ihre Expertise einbringen, um auch die Geliebte ihres Mannes aus dem Weg zu räumen? Inés will sauber bleiben, aber als Manca eine teure Behandlung benötigt, gerät ihre moralische Standhaftigkeit ins Wanken.
In einer bitterbösen Komödie erzählt Claudia Piñeiro von zwei Freundinnen auf der Suche nach Freiheit, in einer Gesellschaft, die Freiheit für Frauen nicht vorsieht.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. Februar 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
352
Autor/Autorin
Claudia Piñeiro
Übersetzung
Silke Kleemann
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
spanisch
Produktart
gebunden
Gewicht
480 g
Größe (L/B/H)
209/133/35 mm
ISBN
9783293006157
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Indem Claudia Piñeiro die Motive der beiden Frauen Inés und Florencia erzählend analysiert und abwägt, berührt sie intensiv Dilemmate der Frauenbewegung in kriminellem Kontext. Ein literarisches Meisterwerk. « Hans-Dieter Grünefeld, Buchkultur
»Claudia Piñeiro ist es in ihren Büchern stets um mehr gegangen als um eine spannende Handlung. Die Zeit der Fliegen bildet gesellschaftlichen Wandel ab und stellt die Frage nach Schuld und Verantwortung. « SWR Kultur
»Der Kriminalroman ist das ideale Gefäß für Gedankenexperimente. Wer ihnen gegenüber aufgeschlossen bleibt, kommt Piñeiros Protagonistin gedanklich so nah, dass sich die Armhaare aufstellen, sanft kribbelnd, als hätte sich dort eine Fliege niedergelassen. « Katrin Doerksen, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Claudia Piñeiro beherrscht die Kunst, gesellschaftliche Entwicklungen originell zu dokumentieren und dabei eine gute, unterhaltsame Geschichte zu erzählen. « Victoria Eglau, Deutschlandfunk Kultur
»Ein wunderbar tiefsinniger, im besten Sinne skurriler Roman, der auf faszinierende Weise hochaktuelle Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung und Mutterschaft abhandelt. Ein literarisches Leseerlebnis der besonderen Art, das die hellen und dunklen Seiten der Frauen unserer Zeit beleuchtet. Inés und Manca sind mit Sicherheit das coolste weibliche Duo der aktuellen Bücherwelt! « Julia Barisch, Buchhandlung Sedlmair
»Ein feministischer Spannungsroman für turbulente Zeiten. « Juan Carlos Galindo, El País
»Die Zeit der Fliegen ist ein Pageturner, ein Kriminalroman, ein Thriller über Feminismus und darüber, was uns offen steht und was uns verwehrt bleibt. « Julia Alvarez
»Gekonnt verwandelt Claudia Piñeiro gesellschaftliche Themen, die ihr wichtig sind, in gute Literatur. Ihre Romane klettern mit beeindruckender Selbstverständlichkeit an die Spitze der Bestsellerlisten Die Zeit der Fliegen ist da keine Ausnahme. « Adriana Lorusso, Noticias
»Claudia Piñeiro entlässt ihre Protagonistin Inés aus dem Gefängnis in eine Welt, in der vieles anders ist, in der ein brennender Diskurs über Sprache und Geschlechterrollen geführt wird. Geschickt lässt sie in grandiosen Dialogen verschiedene Stimmen zu Wort kommen und stellt erneut ihre Stärke in der Figurenzeichnung unter Beweis. Ein makelloses Werk. « Marta Marne, el Periódico de España
»Die Zeit der Fliegen stellt die Frauen ins Zentrum: mal mächtig, mal machtlos, mal mehr, mal weniger ehrenvoll, aber immer entschlossen, ihr Ziel zu erreichen. « Verónica Boix, La Nacion
»Claudia Piñeiro ist es in ihren Büchern stets um mehr gegangen als um eine spannende Handlung. Die Zeit der Fliegen bildet gesellschaftlichen Wandel ab und stellt die Frage nach Schuld und Verantwortung. « SWR Kultur
»Der Kriminalroman ist das ideale Gefäß für Gedankenexperimente. Wer ihnen gegenüber aufgeschlossen bleibt, kommt Piñeiros Protagonistin gedanklich so nah, dass sich die Armhaare aufstellen, sanft kribbelnd, als hätte sich dort eine Fliege niedergelassen. « Katrin Doerksen, Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Claudia Piñeiro beherrscht die Kunst, gesellschaftliche Entwicklungen originell zu dokumentieren und dabei eine gute, unterhaltsame Geschichte zu erzählen. « Victoria Eglau, Deutschlandfunk Kultur
»Ein wunderbar tiefsinniger, im besten Sinne skurriler Roman, der auf faszinierende Weise hochaktuelle Themen wie Feminismus, Gleichberechtigung und Mutterschaft abhandelt. Ein literarisches Leseerlebnis der besonderen Art, das die hellen und dunklen Seiten der Frauen unserer Zeit beleuchtet. Inés und Manca sind mit Sicherheit das coolste weibliche Duo der aktuellen Bücherwelt! « Julia Barisch, Buchhandlung Sedlmair
»Ein feministischer Spannungsroman für turbulente Zeiten. « Juan Carlos Galindo, El País
»Die Zeit der Fliegen ist ein Pageturner, ein Kriminalroman, ein Thriller über Feminismus und darüber, was uns offen steht und was uns verwehrt bleibt. « Julia Alvarez
»Gekonnt verwandelt Claudia Piñeiro gesellschaftliche Themen, die ihr wichtig sind, in gute Literatur. Ihre Romane klettern mit beeindruckender Selbstverständlichkeit an die Spitze der Bestsellerlisten Die Zeit der Fliegen ist da keine Ausnahme. « Adriana Lorusso, Noticias
»Claudia Piñeiro entlässt ihre Protagonistin Inés aus dem Gefängnis in eine Welt, in der vieles anders ist, in der ein brennender Diskurs über Sprache und Geschlechterrollen geführt wird. Geschickt lässt sie in grandiosen Dialogen verschiedene Stimmen zu Wort kommen und stellt erneut ihre Stärke in der Figurenzeichnung unter Beweis. Ein makelloses Werk. « Marta Marne, el Periódico de España
»Die Zeit der Fliegen stellt die Frauen ins Zentrum: mal mächtig, mal machtlos, mal mehr, mal weniger ehrenvoll, aber immer entschlossen, ihr Ziel zu erreichen. « Verónica Boix, La Nacion
 Besprechung vom 03.03.2025
Besprechung vom 03.03.2025
Manche Wörter sind ansteckender als ein Virus
Claudia Piñeiros Frauenroman "Die Zeit der Fliegen"
Für Fliegen vergeht die Zeit viermal langsamer. Deswegen ist es auch so schwer, sie zu fangen - sie sehen die Hand viel länger kommen. "Wenn wir nur alle die Zeit der Fliegen hätten", seufzt Inés. Vielleicht wäre dann vor fünfzehn Jahren alles ganz anders gekommen. Vielleicht hätte sie dann nicht die Geliebte ihres Ehemannes erschossen (das ist eine andere Geschichte, nachzulesen im 2008 erschienenen Roman "Ganz die Deine"), wäre nicht ins Gefängnis gewandert und anschließend in eine Welt entlassen worden, die in dieser Zeit eine völlig andere wurde.
Jetzt kämpft Inés mit ihrem neuen Smartphone, der ständigen Erreichbarkeit, mit dem angemessenen Sprachgebrauch und der quälenden Frage, ob sich die heutigen Sensibilitäten für genderspezifische Gewalt in der Zwischenzeit anders auf ihr Strafmaß auswirken würden. Alles keine ungewöhnlichen Themen für die argentinische Autorin Claudia Piñeiro, deren Frauenfiguren sich stets an patriarchalen, religiösen, sozialen Zwängen abarbeiten. Auch in "Die Zeit der Fliegen" fährt die Autorin ein nahezu vollständig weibliches Figurenarsenal auf; Frauen beschaffen hier die wichtigsten Informationen und halten sich solidarisch den Rücken frei, manipulieren aber auch meisterhaft und drohen einander in den Abgrund zu reißen.
Mit ihrer Freundin La Manca wagt Inés den Neuanfang und gründet ein unkonventionelles Unternehmen: Fünfzig Prozent Privatdetektei für Frauen, fünfzig Prozent Schädlingsbekämpfung. Die Manca ermittelt, Inés räuchert Wohnungen aus. Doch eine neue Kundin hat etwas anderes im Sinn als die Motten in ihrem Kleiderschrank: Sie will ein tödliches Insektizid, um ihren Ehemann zu vergiften. Denn wer, wenn nicht Inés könnte ihre Lage besser verstehen?
Von vorrangigem Interesse ist in "Die Zeit der Fliegen" aber nicht nur, was wirklich hinter dem Auftrag steckt, sondern vor allem das Widerstreitende im Text selbst, der unaufhörliche Zweifel an der eigenen Position. Ständig unterbricht Piñeiro die Handlung durch Kapitel, in denen Stimmen miteinander streiten, feministische Grundsatzfragen diskutieren und kommentieren. Die Statements von Denkerinnen wie Simone de Beauvoir oder Chimamanda Ngozi Adichie gehen in diesem Chor auf, durch Kursivierung und Fußnoten dem körperlosen Rest enthoben. In anderen Passagen nimmt Piñeiro die Perspektive von Inés ein, schreibt in der ersten Person über ihre Vergangenheit, über die Mutterschaft, die sie als lebenslängliches Urteil empfindet. Immer wieder beendet sie ihre Sätze durch kurze Anmerkungen in Klammern, sarkastische Kommentare, ergänzend, hervorhebend, häufig auch prüfend, als wäre Inés in diesen Momenten eine Erweiterung der Autorin selbst, die ihr eigenes Schreiben hinterfragt. "Es ist sicher schon alles geschrieben worden: über Frauen, über Fliegen und über den Tod. Auch über Mütter und Töchter. Originell wird es nur, indem frau dasselbe auf andere Art erzählt."
Diese andere Art, das sind im Roman auch essayistische Einschübe. Im Gefängnis hat Inés ihre Faszination für Insekten entdeckt, nun schreibt sie geradezu liebevoll über die verschiedenen Unterarten der Fliegen und ihre Eigenschaften, ihre Bedeutung für die forensische Entomologie, ihren Platz in der Weltliteratur. Ganz klar erschließt sich Claudia Piñeiros Intention hinter dem Fliegenmotiv nicht, aber letztlich ist es genau diese Unebenheit im Text, diese Experimentierfreude, die überraschende, oftmals provokative Einsichten hervorbringt. Über die Mutterschaft etwa: "Es ist verräterisch, stigmatisiert ein Leben lang. Manche Wörter sind so, sie sind ansteckender als ein Virus (Knast, Mörderin, Mutter)."
Der Kriminalroman, weil er ohnehin permanent auf den Grenzen des Ausführ-, des Sag- und Denkbaren balanciert, ist für solche Gedankenexperimente das ideale Gefäß. Und so wird, wer aufgeschlossen gegenüber dieser eigenwilligen Erzählwelt und geduldig ob ihrer Abschweifungen bleibt, doch belohnt. Der kommt Piñeiros Protagonistin gedanklich so nah, dass sich die Armhaare aufstellen, sanft kribbelnd, als hätte sich dort eine Fliege niedergelassen. KATRIN DOERKSEN
Claudia Piñeiro: "Die Zeit der Fliegen". Roman.
Aus dem Spanischen von Silke Kleemann.
Unionsverlag, München 2025.
352 S., geb.,
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 10.04.2025
Weibliche Selbstjustiz
Claudia Piñeiro ist eine bekannte, anerkannte argentinische Schriftstellerin, deren Hauptthemen die weiblichen Sichtweisen auf die Welt sind, immer unterfüttert mit der realpolitischen Lage des Landes.
Der Roman spielt in Südamerika mit Inès und Manca als Hauptdarstellerinnen. Sie haben sich im Gefängnis kennengelernt. Inès saß dort 15 Jahre fest als Mörderin der Geliebten ihres ungeliebten Mannes, Manca als Drogistin. Eine enge innige Freundschaft fügte sie zusammen, eine Freundschaft, die auch in der Freiheit ihre Fortsetzung findet, in der Gründung einer gemeinsamen Firma - FFF Frauen. Fliegen. Finale Ökologische Schädlingsbekämpfung und Detektei. Inès ist die Kammerjägerin, da sie in der Haft viel über Insekten gelesen und besonders zu Fliegen eine wertschätzende platonische Beziehung aufgebaut hat, Die Manca ist in die Rolle der einhändigen Detektivin geschlüpft: ihre Hand ist jedoch nur unbrauchbar durch einen unvollständig entfernten Glassplitter.
In direkter Erzählung beschreibt Inès ihr Leben, ihre Gedanken, Ängste, Gefühle; im Erzählton erfahren wir mehr über Manca und die Auftragslage der kleinen Firma mit ihren Verwicklungen; jeweils unterbrochen von einem Chor mit Medea als Leitfigur und feministischen Exkursen, sich in theoretischen Labyrinthen verlaufend.
Immer wieder geht es um Mütter und Töchter, um Mutterliebe bzw. deren Abwesenheit, um Gebärmütter. Männer sind Randerscheinungen in diesem Roman.
All das verwoben zu einem Krimi der ganz besonderen Art. Eine interessante Geschichte, deren Finale überrascht. In dem die Mörderin aus eliminatorischer Eifersucht auf eine Mörderin in spe, die aus eiskalt kalkulierter Rache handelt, trifft.
Für mich ist der Roman zu ausufernd, mit viel zu viel feministischer Theorie und entomologischem Wissen angereichert, zudem in einem irgendwie schnodderigen Sprachstil geschrieben.
Schade. Mit mehr würziger Kürze hätte das Buch mehr Charakter. Erzähl- und Sprachstil finden bei mir keinen Widerhall.
LovelyBooks-Bewertung am 01.04.2025
Leider nichts für mich









