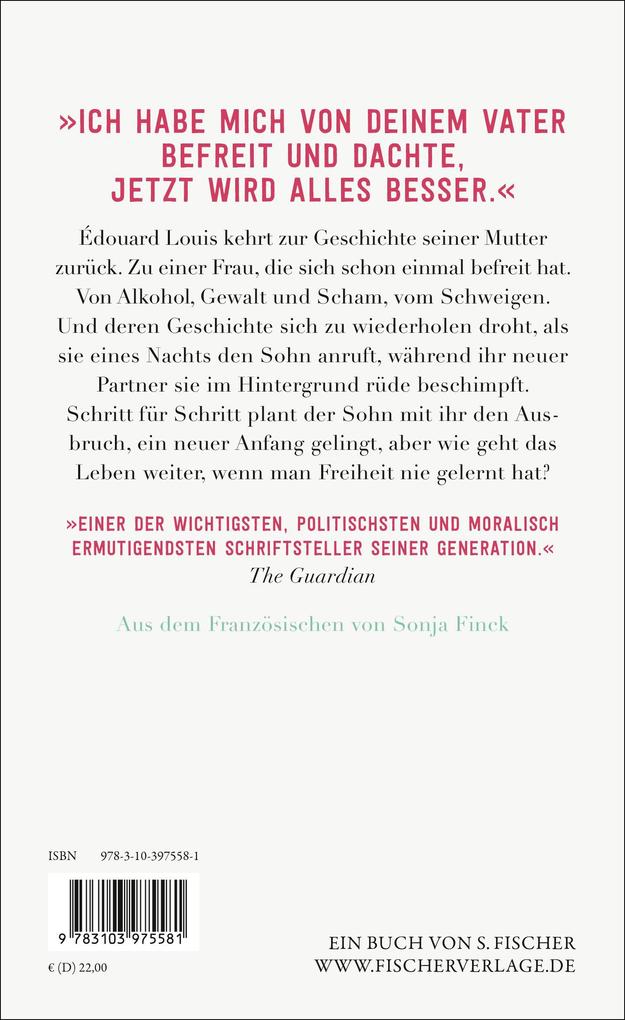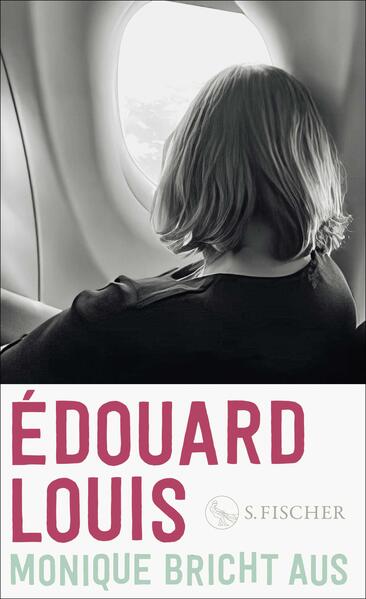
Zustellung: Do, 03.04. - Sa, 05.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Ich habe mich von deinem Vater befreit und dachte, jetzt wird alles besser. « Édouard Louis kehrt zur Geschichte seiner Mutter zurück. Zu einer Frau, die sich schon einmal befreit hat. Von Alkohol, Gewalt und Scham, vom Schweigen. Und deren Geschichte sich zu wiederholen droht, als sie eines Nachts den Sohn anruft, während ihr neuer Partner sie im Hintergrund rüde beschimpft. Schritt für Schritt plant der Sohn mit ihr den Ausbruch, ein neuer Anfang gelingt, aber wie geht das Leben weiter, wenn man Freiheit nie gelernt hat?
»Monique bricht aus« ist ein einfühlsames und zartes Porträt einer Mutter, die für ihre Selbstbestimmung kämpft, und eines Sohnes, der sich mit ihr verbündet. Zweier Menschen, die sich einander annähern und behutsam beginnen, eine gemeinsame neue Geschichte zu schreiben.
»Frankreichs größte literarische Sensation. « The New York Times
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
153
Autor/Autorin
Édouard Louis
Übersetzung
Sonja Finck
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
1 s/w Abbildung
Gewicht
240 g
Größe (L/B/H)
206/126/17 mm
ISBN
9783103975581
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Das alles beschreibt Louis mit der ihm eigenen Schmucklosigkeit, die gerade deshalb anrührend ist und immer wieder in klarsichtige soziologische Erkenntnisse mündet. Christian Bos, Kölner StadtAnzeiger
[. . .] feiert [. . .] das Leben und die Freiheit. Susanne Höggerl, ORF
[. . .] eine Hommage an seine Mutter und von großer Liebe getragen. Sibylle Peine, dpa
[. . .] klagt ohne Unterlass die Ignoranz gegenüber sozialen Fragen an und ist insofern hochaktuell. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
[. . .] auf gute Weise stilistisch einfach geschrieben und von Sonja Finck wunderbar ins Deutsche hinübergeschwungen. Judith Heitkamp, WDR3 Lesestoff
[. . .] bereitet allein durch seinen Stil ein tolles Lesevergnügen. [. . .] Eine stachlige Argumentation im Fleisch unserer auf Individualismus pochenden Zeit. Angelo Algieri, Berliner Zeitung
Dank seiner Nähe durchsucht der Autor die Zone der Scham, des Schweigens und lässt sie hinter sich. Peter Helling, WDR Neue Bücher
Offenbar [lässt sich] aus jeder Szene im Leben dieser Familie eine Erkenntnis ableiten, oft aber ist die dann wirklich global. Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
[. . .] feiert [. . .] das Leben und die Freiheit. Susanne Höggerl, ORF
[. . .] eine Hommage an seine Mutter und von großer Liebe getragen. Sibylle Peine, dpa
[. . .] klagt ohne Unterlass die Ignoranz gegenüber sozialen Fragen an und ist insofern hochaktuell. Judith von Sternburg, Frankfurter Rundschau
[. . .] auf gute Weise stilistisch einfach geschrieben und von Sonja Finck wunderbar ins Deutsche hinübergeschwungen. Judith Heitkamp, WDR3 Lesestoff
[. . .] bereitet allein durch seinen Stil ein tolles Lesevergnügen. [. . .] Eine stachlige Argumentation im Fleisch unserer auf Individualismus pochenden Zeit. Angelo Algieri, Berliner Zeitung
Dank seiner Nähe durchsucht der Autor die Zone der Scham, des Schweigens und lässt sie hinter sich. Peter Helling, WDR Neue Bücher
Offenbar [lässt sich] aus jeder Szene im Leben dieser Familie eine Erkenntnis ableiten, oft aber ist die dann wirklich global. Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
 Besprechung vom 26.01.2025
Besprechung vom 26.01.2025
Was kostet ein Leben in Freiheit?
In seinem neuen Buch erzählt der französische Starautor Édouard Louis vom zweiten Neubeginn seiner Mutter: "Monique bricht aus" beziffert auch die Kosten der Emanzipation einer Frau.
Die Autoren und Freunde Didier Eribon und Édouard Louis bestimmen aus deutscher Perspektive die intellektuelle Szene Frankreichs von heute. Beide haben Bestseller geschrieben, in denen sie ihre arme, bildungsferne Herkunft zum Musterfall sozialer Konflikte erklärten. Beide haben dabei über ihre Mütter geschrieben, Didier Eribon erst im vergangenen Frühjahr ("Eine Arbeiterin") wieder, Édouard Louis 2021 in "Die Freiheit einer Frau" und jetzt in seinem neuen Buch.
"Monique bricht aus" erscheint in einem Moment, da die Welt auf eine andere Frau und Mutter aus Frankreich schaut: Gisèle Pelicot, die auch ausgebrochen ist aus der Gewalt, die ihr eigener Mann und siebzig weitere Männer ihr angetan haben (siehe Seite 35 dieses Feuilletons). Édouards Mutter Monique verlässt zum zweiten Mal in ihrem Leben einen gewalttätigen Mann: Wie Klassenverhältnisse und sexualisierte Gewalt miteinander zusammenhängen, das ist die eine Frage, die sich ihr Sohn stellt.
Die andere Frage lautet: Wird sie es schaffen? Wird Monique, nachdem sie erst ihren brutalen Ehemann und ihr Dorf im französischen Norden verlassen hat, den gewalttätigen Alkoholiker ebenfalls verlassen, mit dem sie ein neues Leben in Paris beginnen wollte? Auch dieser neue Mann hat Monique wieder beschimpft und gedemütigt und herabgewürdigt. Bis sie es nicht mehr aushielt, eines Abends vor vier Jahren.
Das Buch erzählt, was jetzt folgt, minutiös, fast spannend, beginnend mit diesem Anruf der Mutter, "es geht wieder los, es geht wieder von vorne los", sagt sie ihrem Sohn ins Telefon. "Zum Zeitpunkt des Anrufs war ich achtundzwanzig Jahre alt und hatte sie in meinem Leben vielleicht drei- oder viermal weinen hören", schreibt Louis, der gerade mit einem Stipendium in Athen ist und jetzt von dort aus die Flucht seiner Mutter organisiert: Lieferdienste, Wohnungssuche, Möbelkauf. Drei- oder viermal Weinen in all der Zeit: Das bemisst die Distanz und das angespannte Verhältnis zwischen Mutter und Sohn. Eine der wenigen Stellen im Buch, in denen Louis Szenen, die ihm so bedeutsam vorkommen, dass er sie herauspräpariert, nicht selbst ausdeutet.
"Mit über fünfzig Jahren", schreibt er über Monique, da bestellen sie ihr gerade etwas beim Libanesen, "hatte sie manches Essen noch nie probiert, manche Gewürze noch nie geschmeckt, eine Art kulinarische und geschmackliche Entrechtung." Dieser spezielle Mix - erst die szenische Prosa, zu deren stilisierter Einsilbigkeit auch gehört, dass Dialoge selten Anführungsstriche haben, dann eine schlagartig ausformulierte Erkenntnis - prägt das Schreiben Édouard Louis'. Dieser Sound hat ihn weltberühmt gemacht, damit hat er seine eigene Lebens- und Aufstiegsgeschichte zum Fall gemacht, ein schwuler junger Franzose, der als erster seiner Familie auf eine höhere Schule geht und von dort immer weiter nach oben. Wie peinlich genau er von Scham und Armut erzählt, hatte seine Mutter kaum verkraftet, auch das ist ein Leitmotiv dieses Buchs.
Dass dessen Stil so leise ist, verstärkt den Eindruck, dass sich offenbar aus jeder Szene im Leben dieser Familie eine Erkenntnis ableiten lässt, oft aber ist die dann wirklich global: Die Mutter hat den jungen Louis regelmäßig angebrüllt, er solle nicht den Kühlschrank leer fressen. Der empfand das jedes Mal als Angriff - und versteht erst später, dass arme Menschen wirklich nichts mehr haben, wenn sie nichts mehr haben:
"Das ist etwas, was Angehörige der privilegierten Klassen nicht verstehen können, denn wenn sie sagen, dass sie nichts mehr haben, haben sie trotzdem immer noch etwas
sie haben immer noch ihren Uniabschluss
sie haben immer noch ihre Bildung
sie haben immer noch Kleingeld
sie haben immer noch Leute, die ihnen helfen
sie haben immer noch die Willensstärke, die auf Privilegien beruht."
Diese Sätze hat Louis ohne Komma aufgelistet, vielleicht ein Überbleibsel seiner verworfenen Idee, die Geschichte als Rechnung zu formatieren, er zählt die Kosten des Auszugs und Neubeginns seiner Mutter aber doch auf: "Kühlschrank: 500 Euro, Gasherd: 300 Euro, Taxi für die Flucht: 15 Euro, Kaution für die Wohnung: 1100 Euro, Überweisung für die ersten Monate des Neuen Lebens: 2000 Euro". Am Ende zieht Monique in ihre eigenen vier Wände im Dorf ihrer Tochter, und endlich beruft sich Louis hier auf die Formel von Virginia Woolf, dass eine Frau ein eigenes Zimmer und 500 Pfund im Monat bräuchte, um schreiben zu können.
Das war 1928 und ist hundert Jahre später immer noch so, das ist die Rechnung der Emanzipation, die Édouard Louis aufmacht. Moniques Geschichte wird er sicher weiter erzählen, es ist ja erst der Anfang ihres zweiten Neuanfangs. Als er mit seiner Mutter nach Hamburg reist, sie sitzt zum ersten Mal in einem Flugzeug, weil dort "Die Freiheit einer Frau" als Bühnenstück Premiere feiert, bringt Monique ihre eigenen Handtücher mit ins Hotel. TOBIAS RÜTHER
Édouard Louis, "Monique bricht aus". Aus dem Französischen von Sonja Finck. Fischer, 160 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 04.02.2025
¿Ich habe mich von deinem Vater befreit und dachte, jetzt wird alles besser, jetzt fängt ein neues Leben an, aber es geht wieder los, es geht wieder von vorne los, [...], Ich weiß auch nicht, warum mein Leben so scheiße ist, warum ich immer an Männer gerate, die mich nicht glücklich machen, die wollen, dass ich leide, das hab ich doch nicht verdient,bin ich denn so ein schlechter Mensch?' (Seite 10)Nach der Trennung von Édouard Louis' Vater lebt seine Mutter mit einem neuen Partner in einer Hausmeisterwohnung in der Pariser Innenstadt. Der Mann beleidigt sie, beschimpft sie, demütigt sie, wertet sie ab.Als Louis während eines Telefonats mit seiner Mutter den Mann im Hintergrund schreien und wüten hört und die Mutter weint, weint Louis mit ihr und bietet ihr seine Wohnung an, wo sie unterkommen kann, während er selbst gerade im Ausland ist.Seine Mutter nimmt das Angebot an, packt einige wenige Dinge ein und verschwindet aus dem Leben des Mannes.Louis ist einer meiner Lieblingsschriftsteller, und ich habe alles gelesen, was bisher auf Deutsch von ihm veröffentlicht wurde. Thematisch bewegt er sich oft auf dem Terrain seiner Familiengeschichte, und seine Bücher sind inhaltlich oft vergleichbar mit denen seines Freundes Didier Eribon (was durchaus Gründe für Kritik sein könnten, was mich aber nicht stört).Hier erzählt er auf liebevolle, besorgte, stolze und respektvolle Weise von seiner Mutter, von Gewalterfahrungen und von Armut. Er erzählt davon, wie er sich von seiner Familie distanziert hat, wie er öffentlich von seinen Kindheitserfahrungen berichtet hat, wie er seine Mutter dadurch verletzt hat. Er gibt seiner Mutter eine Bühne, die nach schwierigen Beziehungen endlich ihr eigenes Leben lebt, sich frei fühlt, ihr Leben und ihre Freiheit genießt.Auch mit ¿Monique bricht aus' hat mich Louis berührt, und das Buch ist so pointiert geschrieben, wie ich das von ihm kenne und wofür ich ihn schätze.
am 03.02.2025
Wow - Louis zweites Buch über seine Mutter, großartig!
Ich könnte sagen: Kein Leid in meiner Kindheit = keine Bücher = kein Geld = keine Freiheit.
Nur aufgrund seiner Literatur über seine prägenden familiären Erfahrungen ist Édouard Louis in der Lage seiner Mutter helfen zu können, als diese vor einem gewalttätigen Mann flüchtet, um sich ihre eigene Existenz aufzubauen.
Aber erstmal von vorne. Louis Mutter verbrachte den größten Teil ihres Lebens in Nordfrankreich, in einem abgelegenen Dorf mit knapp tausend Einwohnern. Sie lernte dort den Mann kennen, vor dem sie später würde fliehen müssen. Aber auch schon Louis Vater misshandelte sie.
Kurz zuvor hatte sie meinen Vater nach zwanzig Jahren Ehe rausgeworfen, zwanzig Jahre, in denen er von ihr erwartet hatte, dass sie
kochte
putzte
einkaufte
spülte
die Wäsche wusch
dass sie den Mund hielt, wenn er fernsah, sechs oder sieben Stunden am Tag, und wenn sie es nicht tat, rastete er aus,..
Da sie in ihrem Zuhause keine Bestätigung bekam, verfügte seine Mutter über ein geringes Selbstwertgefühl.
Meine Mutter hat sich in ihrem Leben oft an Komplimente geklammert, die andere ihr gemacht haben; sie gaben und geben ihr das Gefühl, gesehen zu werden, in den Augen und in den Worten der anderen zu existieren und die Unsichtbarkeit zu durchbrechen, die eine Folge der Armut war und eines Lebens an der Seite von Männern, die alles daran gesetzt hatten, sie zu erniedrigen.
Heute als erwachsener Mann versteht Louis die Not seiner Mutter, die Freude über - und den Heisch nach Aufmerksamkeit.
Als sie sich endlich von ihrem aktuellen, gewalttätigen Lebensgefährten lossagt, gewährt ihr Sohn Édouard ihr Unterschlupf in seiner Pariser Wohnung. Er spürt ihre Dankbarkeit, aber nimmt auch die Müdigkeit seiner Mutter wahr.
Müdigkeit, das war im Leben meiner Mutter immer das deutlichste Anzeichen dafür gewesen, dass ihr Unrecht geschah. Müdigkeit, weil sie zu einem Hausfrauendasein gezwungen war, Müdigkeit, weil sie gedemütigt wurde, Müdigkeit, weil sie weglaufen musste, Müdigkeit, weil sie sich abrackern musste, Müdigkeit, weil sie immer wieder von vorne anfangen musste.
Manche werden vom Leben getragen, für andere ist das Leben ein ständiger Kampf.
Wer zur zweiten Kategorie gehört, ist müde.
Auch finanzielle Abhängigkeit ist ein großes Thema des Buches - seine Mutter verlor durch den Einzug bei dem Mann, mit dem sie zusammen war, ihre Sozialhilfe, auf die sie nach der Trennung von seinem Vater Anspruch gehabt hatte, sowie auch ihren Halbtagsjob. Vorbei war ihre Unabhängigkeit. Und so kreuzt sie eines Tages unangekündigt bei Édouard auf, ohne einen Cent in der Tasche.
Wenn wir uns streiten, sagt er jedes Mal, er gibt mir zur Strafe keinen Cent mehr. Deshalb habe ich nicht mal zwei Euro, um einen Kaffee zu trinken und aufs Klo gehen zu können. Heute bin ich ein bisschen spazieren gegangen und habe mich zu weit von zu Hause entfernt. Deshalb musste ich zu dir kommen, sonst hätte ich dich in Ruhe gelassen.
Louis sagt über die Szene selbst, Die Scham hat ein Gedächtnis, was ich für eine unglaublich wichtige Erkenntnis halte und auch aus eigener Erfahrung heraus bestätigen würde, denn wer kann sich mich selbst an besonders schambehaftete Situationen oder Erlebnisse erinnern?! Ich kann es.
Mit zunehmender Bildung entfernte sich Louis nicht nur geistig immer mehr von seiner Familie, sondern auch körperlich.
Von dem Tag an, als ich aufs Gymnasium kam, obwohl niemand in meiner Familie Abitur hatte, von dem Tag an, als ich Bücher zu lesen, ins Theater zu gehen, mich für Filmgeschichte zu interessieren begann, wurde all dies schlagartig unmöglich. Plötzlich langweilte ich mich im Supermarkt, hasste die Nachmittage dort, empfand sie als Zeitverschwendung, verachtete Videospiele, hielt sie für dumm, begann zu sagen - den Satz hatte ich in der Uni aufgeschnappt -, dass es in Fastfoodrestaurants nach Frittierfett stinkt und das mir von dem Geruch schlecht wird.
Es schmerzt solche Passagen zu lesen, denn man bekommt wahrhaftig mit, wie sich Louis von seiner Familie lossagt, ja lossagen will, weil sie einfach nicht in sein neues Bildungsbürger-Leben passt - Klassismus at its best!
Schafft Louis Mutter dem Abwärtsstrudel aus Gewalt, finanzieller Abhängigkeit und co zu entkommen?!
Das müsst Ihr schon selber nachlesen in Monique bricht aus - was ich aber verraten möchte: Es lohnt sich, denn er hat das Buch aus einem besonderen Grund geschrieben: Es war der Wunsch seiner Mutter - sie wollte, dass wir Leser*innen erfahren, welche Wendung ihr Leben genommen hat. Denn es hat sich einiges getan seit Die Freiheit einer Frau - dem ersten Buch, dass Édouard Louis über seine Mutter schrieb.
Ich habe nicht entschieden es zu schreiben. Es war nicht meine Idee. Noch nie hat mir das Schreiben so große Freude bereitet.
Unbedingte Leseempfehlung!