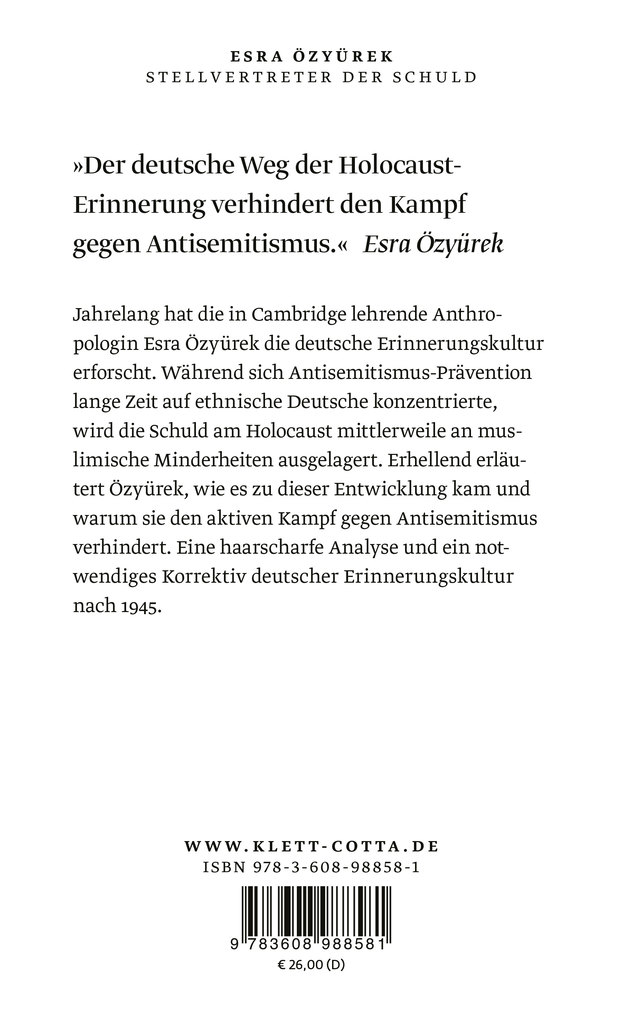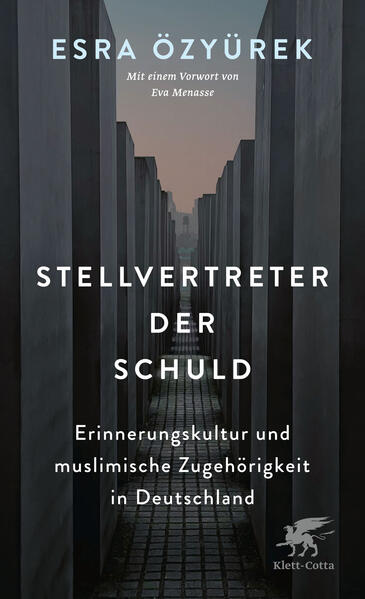
Zustellung: Mi, 23.04. - Fr, 25.04.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
»Der deutsche Weg der Holocaust-Erinnerung verhindert den Kampf gegen Antisemitismus. «
Jahrelang hat die in Cambridge lehrende Anthropologin Esra Özyürek die deutsche Erinnerungskultur erforscht. Während sich Antisemitismus-Prävention lange Zeit auf ethnische Deutsche konzentrierte, wird die Schuld am Holocaust mittlerweile an muslimische Minderheiten ausgelagert. »Stellvertreter der Schuld« erläutert, wie es zu dieser Entwicklung kam und warum sie den aktiven Kampf gegen Antisemitismus verhindert.
Um die Jahrhundertwende rückten muslimische Einwanderer, türkisch- und arabischstämmige Deutsche ins Zentrum des Holocaust-Gedenkens. Antisemitismus-Präventionsprogramme wurden speziell auf sie zugeschnitten, damit auch sie die Täterperspektive verstehen und demokratische Werte verinnerlichen - ein Paradox, in dem rassistische und kulturelle Vorurteile gegenüber Muslimen aufklaffen. Sich selbst stellt die deutsche Gesellschaft kaum noch infrage, der vermeintliche Antisemitismus anderer müsse nun bekämpft werden. Wie ein »magischer Schlüssel« (Eva Menasse) lässt sich Özyüreks Analyse für die jüngsten Debatten um Antisemitismus in Deutschland gebrauchen: Es wurde nicht so viel aus der Geschichte gelernt, wie erhofft. Antisemitismus wird nicht verhindert, sondern verschleiert und ausgelagert. Antimuslimische Haltungen verfestigen sich. Eine haarscharfe Analyse und ein notwendiges Korrektiv deutscher Erinnerungskultur nach 1945.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. März 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage 2025
Ausgabe
Ungekürzt
Seitenanzahl
320
Autor/Autorin
Esra Özyürek
Übersetzung
Elsbeth Ranke
Vorwort
Eva Menasse
Weitere Beteiligte
Eva Menasse
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
412 g
Größe (L/B/H)
206/130/30 mm
Sonstiges
gebunden mit Schutzumschlag
ISBN
9783608988581
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 19.03.2025
Besprechung vom 19.03.2025
Symbolische Schuldübertragung?
Esra Özyürek möchte Muslime als Stellvertreter deutscher Verantwortung für die Schoa ausmachen
Mit dem Wort "Gedächtnistheater" hat der Soziologe Michal Bodemann das Holocaust-Gedenken in Deutschland belegt: Die Deutschen wollten von Scham und Schuld befreit werden, was sie immer wieder zu theatralischen Akten der erinnernden Buße treibe. Die an der Universität Cambridge lehrende Soziologin Esra Özyürek knüpft daran den Verdacht, die Deutschen, nämlich jene ohne Migrationshintergrund, seien solcher Bußgänge müde und wollten Schuld und Scham an die Muslime im Land abschieben.
Das klingt recht abenteuerlich und bleibt es nach dreihundert Seiten Lektüre auch, denn die Autorin geizt mit Belegen. Ein Zitat von Ex-Kanzler Schröder, ein Tweet des CDU-Vorsitzenden Merz oder die Kommentarspalte in einer Wochenzeitung müssen herhalten, um den Verdacht zu säen. Der eine meinte, Deutschland habe die NS-Vergangenheit weitgehend aufgearbeitet und könne deshalb positiver mit ihr umgehen, der andere warnte vor rechtsextremem und importiertem Antisemitismus. Für Özyürek sind das schon Zeichen eines neuen Gesellschaftsvertrags, in dem hiesige Muslime die Rolle der Nachkriegsdeutschen übernehmen sollen, jener ungezogenen Kinder, die erst von anderen demokratisiert werden müssen. Erst durch die Anerkennung ihrer Schuld am Holocaust, meint die Autorin, würden Muslime hierzulande zu echten Deutschen, da das Holocaust-Gedenken nun einmal das hervorstechende zivilreligiöse Identifikationsmerkmal der Bundesrepublik sei.
Nun sind öffentliche Äußerungen, die Muslime in Haftung für den Holocaust nehmen, aus guten Gründen rar gesät. Am Holocaust waren nun einmal Deutsche und nicht Muslime schuld. Wie kommt die Autorin also zu ihrer These? Der erste Schritt der symbolischen Schuldübertragung besteht ihr zufolge darin, den Antisemitismus in der nichtmuslimischen deutschen Bevölkerung zu leugnen und den importierten muslimischen Antisemitismus hervorzuheben. Diese Tendenz liest die Autorin irrtümlich aus dem ersten Antisemitismusbericht des Bundesinnenministeriums von 2011 heraus. Ihre Behauptung, der Bericht enthalte keinerlei Hinweis auf rechtsextremen Antisemitismus, ist ebenso falsch wie ihre Klage, mehr als die Hälfte des Berichts widme sich Antisemitismus in türkischen und arabischen Medien. Vielmehr wird in dem Bericht der Rechtsextremismus als bedeutendste Trägergruppe genannt, und weniger als zehn Prozent der Seiten handeln von nahöstlichen Medien.
Ihre schiefen Befunde hält die Autorin ins Licht der Polizeistatistik, nach der rund neunzig Prozent der Straftaten auf das Konto des Rechtsextremismus gehen. Es ist jedoch allgemein bekannt, dass die Polizeistatistik alle unklaren Fälle, und das sind die meisten, bis zu ihrer 2021 in der Innenministerkonferenz beschlossenen Reform (F.A.Z. vom 18. Juni 2021) dem rechtsradikalen Lager zuschlug. 2023 lag die Quote rechtsextremistischer Straftaten "nur" noch bei 58 Prozent, und die vorherige Praxis spricht klar gegen die These, der Staat wolle Muslimen Schuld aufladen.
Die Autorin will jedoch schon in den Nullerjahren einen Transfer der Fördergelder bei der Antisemitismusprävention in Richtung von Muslimen beobachtet haben. Das kann, wenn es stimmt (Zahlen nennt die Autorin nicht), pragmatische Gründe haben und mit der steigenden Migration und dem starken Antisemitismus in muslimischen Milieus zu tun haben. Nach den Studien von Günther Jikeli ist Antisemitismus unter Muslimen in Europa rund doppelt so häufig anzutreffen wie im Rest der Gesellschaft. Und nach Studien der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und der Universität Bielefeld fühlen sich Juden in Europa von Muslimen bei Weitem am stärksten bedroht. Es ist sinnvoll, darauf zu reagieren.
Abwegig wäre die These, der muslimische Antisemitismus hebe die anderen Formen des Antisemitismus auf, was anders als die Autorin insinuiert auch in keiner ernst zu nehmenden Wortmeldung vertreten wird. Mit Sicherheit falsch ist die Behauptung, die Antisemitismusprävention würde heute "ausschließlich" auf Muslime ausgerichtet. Immer wieder flicht die Autorin apodiktische Aussagen in ihren Text, die von keiner Realität gestützt werden.
Als Anschauungsmaterial wählt sie das Projekt "Junge Muslime in Auschwitz", das Yilmaz Burak in Reaktion auf den Antisemitismus im türkischen Milieu von Duisburg ins Leben rief. Es begleitet Jahr für Jahr eine Gruppe muslimischer Jugendlicher auf der Fahrt in das Konzentrationslager, um sie dazu zu bewegen, Juden nicht als Täter, sondern als Opfer wahrzunehmen. Die dabei verwendete Pädagogik, die auf intensives Nacherleben setzt und die historisch bezeugte Kollaboration von Palästinensern mit dem NS-Regime betont, kann man überidentifikatorisch finden. Aber selbst dann ist das Projekt (wie die wenigen anderen erwähnten Projekte) viel zu klein für den Nachweis einer großflächigen Schuldübertragung.
Bemüht sind die Parallelen der Autorin zur Nachkriegszeit, die aufweisen sollen, Muslime von heute würden wie die Deutschen von damals als von einem patriarchalischen Ehrbegriff fehlgeleitete Problemfälle behandelt. Diese Sichtweise kreidet Özyürek immer wieder ohne Beleg namentlich nicht genannten muslimischstämmigen Intellektuellen an. Damit tritt ein grundsätzliches Problem in den Vordergrund: der Mangel an klaren Belegstellen, Zuordnungen, Eingrenzungen. Das Buch ist über weite Strecken ein einziges Raunen und Behaupten. Die Autorin nutzt die Leerstellen für großspurige Thesen und haarsträubende Simplifizierungen. Dazu gesellen sich zahlreiche Widersprüche. Benjamin Netanjahus fragwürdige Behauptung, erst der palästinensische Großmufti al-Husseini habe Hitler zum Holocaust getrieben, schreibt Özyürek beispielsweise, sei in Deutschland zurückgewiesen worden, habe dort aber trotzdem den Weg freigemacht für die Haftbarmachung von Muslimen für den Holocaust. Eine Zurückweisung macht den Weg frei - wie das? Das eigentlich Interessante an dem Buch ist am Ende die Beobachtung, wie weit der Klett-Cotta-Verlag seinen Anspruch zu senken bereit ist, wenn ihm ein Thema irgendwie in der Luft zu liegen scheint. THOMAS THIEL
Esra Özyürek: "Stellvertreter der Schuld". Erinnerungskultur und muslimische Zugehörigkeit in Deutschland. Mit einem Vorwort von Eva Menasse. Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 2025. 320 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Stellvertreter der Schuld" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.